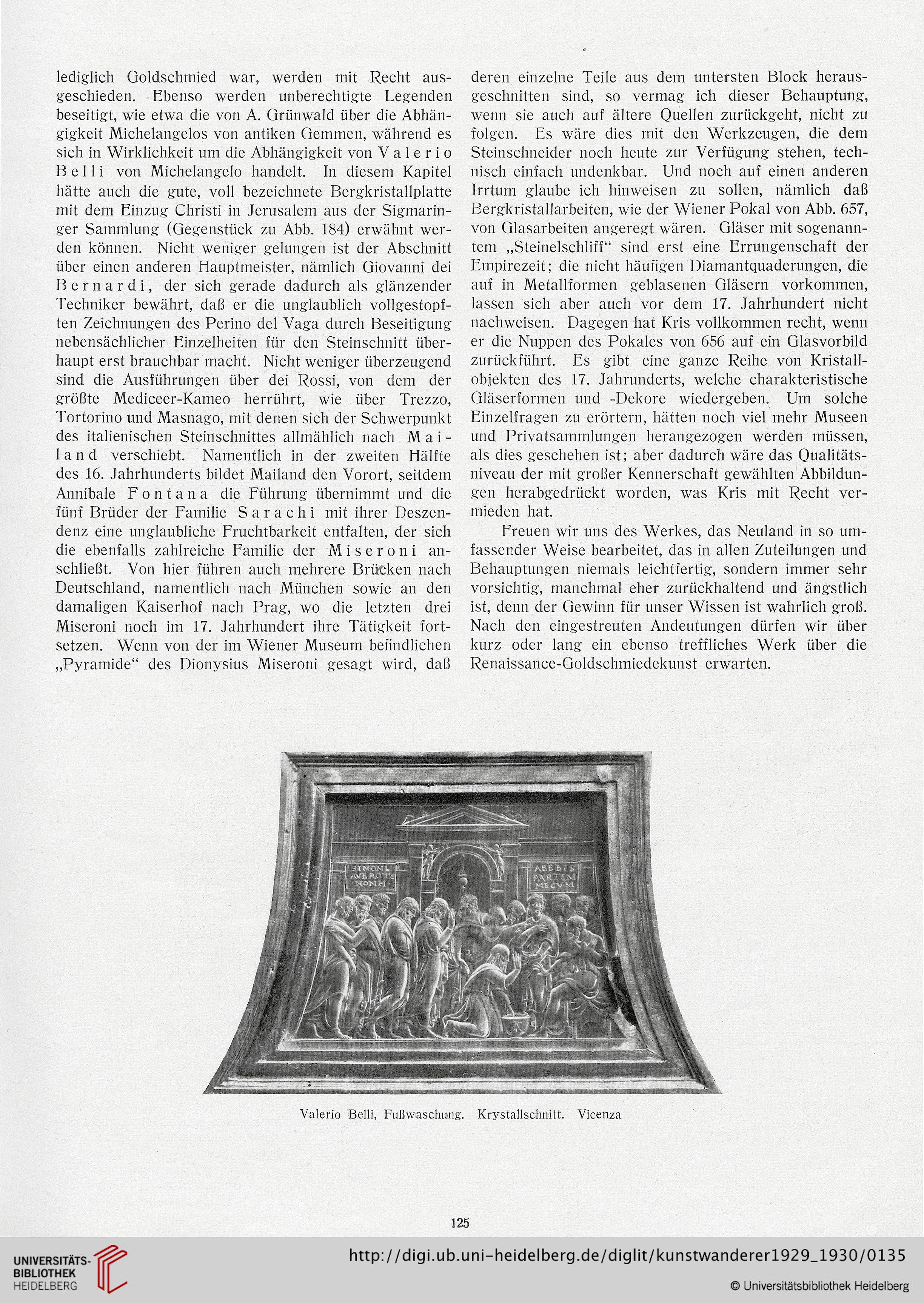lediglich Goldschmied war, werden mit Recht aus-
geschieden. Ebenso werden unberechtigte Legenden
beseitigt, wie etwa die von A. Grünwald über die Abhän-
gigkeit Michelangelos von antiken Gemmen, während es
sich in Wirklichkeit um die Abhängigkeit von V a 1 e r i o
Belli von Michelangelo handelt. In diesem Kapitel
hätte auch die gute, voll bezeichnete Bergkristallplatte
mit dem Einzug Christi in Jerusalem aus der Sigmarin-
ger Sammlung (Gegenstück zu Abb. 184) erwähnt wer-
den können. Nicht weniger gelungen ist der Abschnitt
über einen anderen Hauptmeister, nämlich Giovanni dei
B e r n a r d i, der sich gerade dadurch als glänzender
Techniker bewährt, daß er die unglaublich vollgestopf-
ten Zeichnungen des Perino dcl Vaga durch Beseitigung
nebensächlicher Einzelheiten für den Steinschnitt über-
haupt erst brauchbar macht. Nicht weniger überzeugend
sind die Ausführungen über dei Rossi, von dem der
größte Mediceer-Kameo herrührt, wie über Trezzo,
Tortorino und Masnago, mit denen sich der Schwerpunkt
des italienischen Steinschnittes allmählich nach Mai-
land verschiebt. Namentlich in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts bildet Mailand den Vorort, seitdem
Annibale Fontana die Führung übernimmt und die
fünf Brüder der Familie S a r a c h i mit ihrer Deszen-
denz eine unglaubliche Fruchtbarkeit entfalten, der sich
die ebenfalls zahlreiche Familie der M i s e r o n i an-
schließt. Von hier führen auch mehrere Brücken nach
Deutschland, namentlich nach München sowie an den
damaligen Kaiserhof nach Prag, wo die letzten drei
Miseroni noch im 17. Jahrhundert ihre Tätigkeit fort-
setzen. Wenn von der im Wiener Museum befindlichen
„Pyramide“ des Dionysius Miseroni gesagt wird, daß
deren einzelne Teile aus dem untersten Block heraus-
geschnitten sind, so vermag ich dieser Behauptung,
wenn sie auch auf ältere Quellen zurückgeht, nicht zu
folgen. Es wäre dies mit den Werkzeugen, die dem
Steinschneider noch heute zur Verfügung stehen, tech-
nisch einfach undenkbar. Und noch auf einen anderen
Irrtum glaube ich hinwcisen zu sollen, nämlich daß
Bergkristallarbeiten, wie der Wiener Pokal von Abb. 657,
von Glasarbeiten angeregt wären. Gläser mit sogenann-
tem „Steineischliff“ sind erst eine Errungenschaft der
Empirezeit; die nicht häufigen Diamantquaderungen, die
auf in Metallformen geblasenen Gläsern Vorkommen,
lassen sich aber auch vor dem 17. Jahrhundert nicht
nachweisen. Dagegen hat Kris vollkommen recht, wenn
er die Nuppen des Pokales von 656 auf ein Glasvorbild
zurückführt. Es gibt eine ganze Reihe von Kristall-
objekten des 17. Jahrunderts, welche charakteristische
Gläserformen und -Dekore wiedergeben. Um solche
Einzelfragen zu erörtern, hätten noch viel mehr Museen
und Privatsammlungen herangezogen werden müssen,
als dies geschehen ist; aber dadurch wäre das Qualitäts-
niveau der mit großer Kennerschaft gewählten Abbildun-
gen herabgedrückt worden, was Kris mit Recht ver-
mieden hat.
Freuen wir uns des Werkes, das Neuland in so um-
fassender Weise bearbeitet, das in allen Zuteilungen und
Behauptungen niemals leichtfertig, sondern immer sehr
vorsichtig, manchmal eher zurückhaltend und ängstlich
ist, denn der Gewinn für unser Wissen ist wahrlich groß.
Nach den eingestreuten Andeutungen dürfen wir über
kurz oder lang ein ebenso treffliches Werk über die
Renaissance-Goldschmiedekunst erwarten.
Valerio Belli, Fußwaschung. Krystallschnitt. Vicenza
125
geschieden. Ebenso werden unberechtigte Legenden
beseitigt, wie etwa die von A. Grünwald über die Abhän-
gigkeit Michelangelos von antiken Gemmen, während es
sich in Wirklichkeit um die Abhängigkeit von V a 1 e r i o
Belli von Michelangelo handelt. In diesem Kapitel
hätte auch die gute, voll bezeichnete Bergkristallplatte
mit dem Einzug Christi in Jerusalem aus der Sigmarin-
ger Sammlung (Gegenstück zu Abb. 184) erwähnt wer-
den können. Nicht weniger gelungen ist der Abschnitt
über einen anderen Hauptmeister, nämlich Giovanni dei
B e r n a r d i, der sich gerade dadurch als glänzender
Techniker bewährt, daß er die unglaublich vollgestopf-
ten Zeichnungen des Perino dcl Vaga durch Beseitigung
nebensächlicher Einzelheiten für den Steinschnitt über-
haupt erst brauchbar macht. Nicht weniger überzeugend
sind die Ausführungen über dei Rossi, von dem der
größte Mediceer-Kameo herrührt, wie über Trezzo,
Tortorino und Masnago, mit denen sich der Schwerpunkt
des italienischen Steinschnittes allmählich nach Mai-
land verschiebt. Namentlich in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts bildet Mailand den Vorort, seitdem
Annibale Fontana die Führung übernimmt und die
fünf Brüder der Familie S a r a c h i mit ihrer Deszen-
denz eine unglaubliche Fruchtbarkeit entfalten, der sich
die ebenfalls zahlreiche Familie der M i s e r o n i an-
schließt. Von hier führen auch mehrere Brücken nach
Deutschland, namentlich nach München sowie an den
damaligen Kaiserhof nach Prag, wo die letzten drei
Miseroni noch im 17. Jahrhundert ihre Tätigkeit fort-
setzen. Wenn von der im Wiener Museum befindlichen
„Pyramide“ des Dionysius Miseroni gesagt wird, daß
deren einzelne Teile aus dem untersten Block heraus-
geschnitten sind, so vermag ich dieser Behauptung,
wenn sie auch auf ältere Quellen zurückgeht, nicht zu
folgen. Es wäre dies mit den Werkzeugen, die dem
Steinschneider noch heute zur Verfügung stehen, tech-
nisch einfach undenkbar. Und noch auf einen anderen
Irrtum glaube ich hinwcisen zu sollen, nämlich daß
Bergkristallarbeiten, wie der Wiener Pokal von Abb. 657,
von Glasarbeiten angeregt wären. Gläser mit sogenann-
tem „Steineischliff“ sind erst eine Errungenschaft der
Empirezeit; die nicht häufigen Diamantquaderungen, die
auf in Metallformen geblasenen Gläsern Vorkommen,
lassen sich aber auch vor dem 17. Jahrhundert nicht
nachweisen. Dagegen hat Kris vollkommen recht, wenn
er die Nuppen des Pokales von 656 auf ein Glasvorbild
zurückführt. Es gibt eine ganze Reihe von Kristall-
objekten des 17. Jahrunderts, welche charakteristische
Gläserformen und -Dekore wiedergeben. Um solche
Einzelfragen zu erörtern, hätten noch viel mehr Museen
und Privatsammlungen herangezogen werden müssen,
als dies geschehen ist; aber dadurch wäre das Qualitäts-
niveau der mit großer Kennerschaft gewählten Abbildun-
gen herabgedrückt worden, was Kris mit Recht ver-
mieden hat.
Freuen wir uns des Werkes, das Neuland in so um-
fassender Weise bearbeitet, das in allen Zuteilungen und
Behauptungen niemals leichtfertig, sondern immer sehr
vorsichtig, manchmal eher zurückhaltend und ängstlich
ist, denn der Gewinn für unser Wissen ist wahrlich groß.
Nach den eingestreuten Andeutungen dürfen wir über
kurz oder lang ein ebenso treffliches Werk über die
Renaissance-Goldschmiedekunst erwarten.
Valerio Belli, Fußwaschung. Krystallschnitt. Vicenza
125