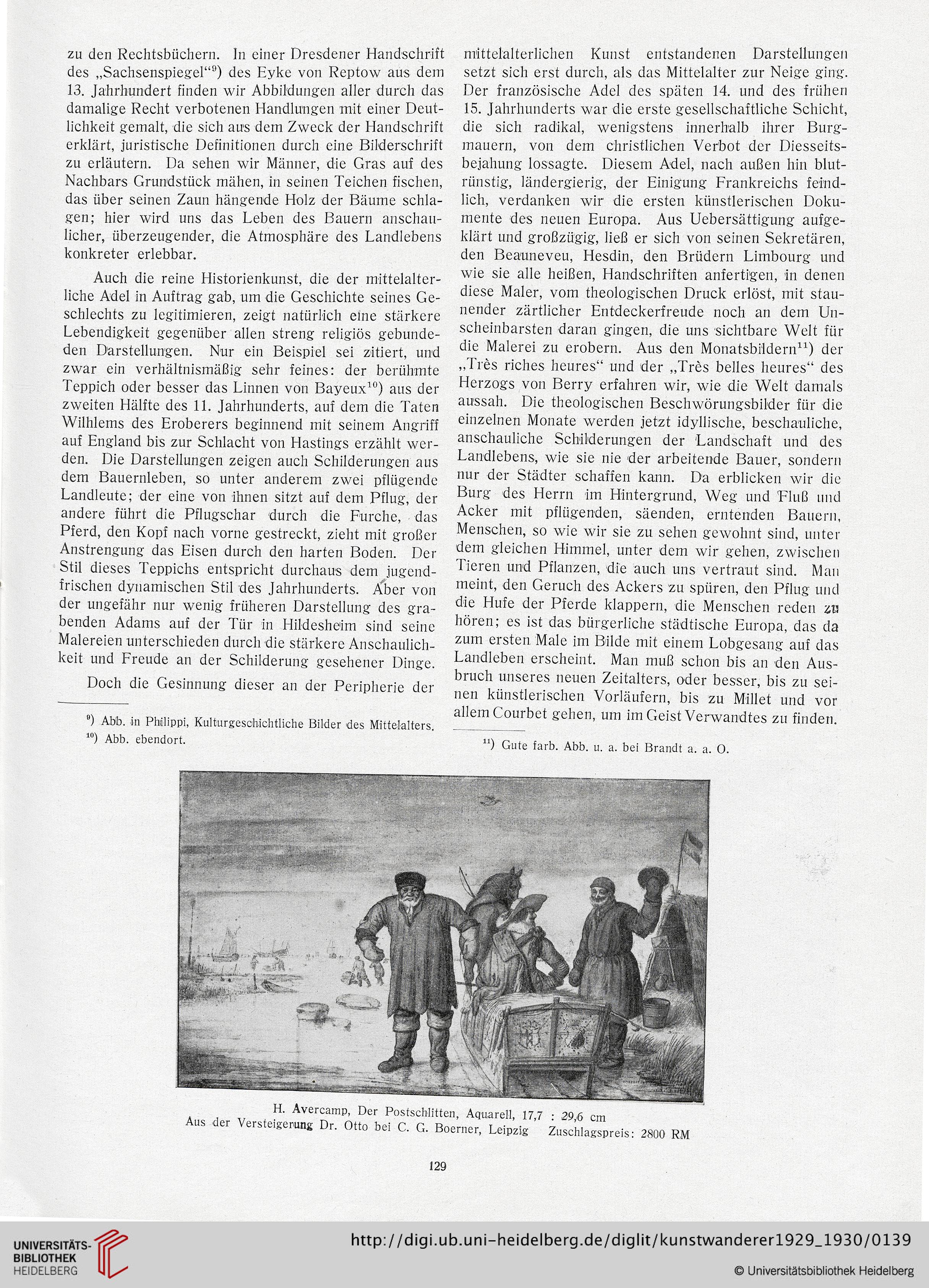zu den Rechtsbüchern. In einer Dresdener Handschrift
des „Sachsenspiegel“0) des Eykc von Reptow aus dem
13. Jahrhundert finden wir Abbildungen aller durch das
damalige Recht verbotenen Handlungen mit einer Deut-
lichkeit gemalt, die sich aus dem Zweck der Handschrift
erklärt, juristische Definitionen durch eine Bilderschrift
zu erläutern. Da sehen wir Männer, die Gras auf des
Nachbars Grundstück mähen, in seinen Teichen fischen,
das über seinen Zaun hängende Holz der Bäume schla-
gen; hier wird uns das Leben des Bauern anschau-
licher, überzeugender, die Atmosphäre des Landlebens
konkreter erlebbar.
Auch die reine Historienkunst, die der mittelalter-
liche Adel in Auftrag gab, um die Geschichte seines Ge-
schlechts zu legitimieren, zeigt natürlich eine stärkere
Lebendigkeit gegenüber allen streng religiös gebunde-
den Darstellungen. Nur ein Beispiel sei zitiert, und
zwar ein verhältnismäßig sehr feines: der berühmte
Teppich oder besser das Linnen von Bayeux10) aus der
zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, auf dem die Taten
Wilhlems des Eroberers beginnend mit seinem Angriff
auf England bis zur Schlacht von Hastings erzählt wer-
den. Die Darstellungen zeigen auch Schilderungen aus
dem Bauernleben, so unter anderem zwei pflügende
Landleute; der eine von ihnen sitzt auf dem Pflug, der
andere führt die Pflugschar durch die Furche, das
Pferd, den Kopf nach vorne gestreckt, zieht mit großer
Anstrengung das Eisen durch den harten Boden. Der
Stil dieses Teppichs entspricht durchaus dem jugend-
frischen dynamischen Stil des Jahrhunderts. Alter von
der ungefähr nur wenig früheren Darstellung des gra-
benden Adams auf der Tür in Hildesheim sind seine
Malereien unterschieden durch die stärkere Anschaulich-
keit und Freude an der Schilderung gesehener Dinge.
Doch die Gesinnung dieser an der Peripherie der
°) Abb. in Phiilippi, Kulturgeschichtliche Bilder 'des Mittelalters.
10) Abb. ebendort.
mittelalterlichen Kunst entstandenen Darstellungen
setzt sich erst durch, als das Mittelalter zur Neige ging.
Der französische Adel des späten 14. und des frühen
15. Jahrhunderts war die erste gesellschaftliche Schicht,
die sich radikal, wenigstens innerhalb ihrer Burg-
mauern, von dem christlichen Verbot der Diesseits-
bejahung lossagte. Diesem Adel, nach außen hin blut-
rünstig, ländergierig, der Einigung Frankreichs feind-
lich, verdanken wir die ersten künstlerischen Doku-
mente des neuen Europa. Aus Uebersättigung aufge-
klärt und großzügig, ließ er sich von seinen Sekretären,
den Beauneveu, Hesdin, den Brüdern Limbourg und
wie sie alle heißen, Handschriften anfertigen, in denen
diese Maler, vom theologischen Druck erlöst, mit stau-
nender zärtlicher Entdeckerfreude noch an dem Un-
scheinbarsten daran gingen, die uns sichtbare Welt für
die Malerei zu erobern. Aus den Monatsbildern11) der
„Tres riches heures“ und der „Tres belles heures“ des
Herzogs von Berry erfahren wir, wie die Welt damals
aussah. Die theologischen Beschwörungsbilder für die
einzelnen Monate werden jetzt idyllische, beschauliche,
anschauliche Schilderungen der Landschaft und des
Landlebens, wie sie nie der arbeitende Bauer, sondern
nur der Städter schaffen kann. Da erblicken wir die
Burg des Herrn im Hintergrund, Weg und Fluß und
Acker mit pflügenden, säenden, erntenden Bauern,
Menschen, so wie wir sie zu sehen gewohnt sind, unter
dem gleichen Himmel, unter dem wir gehen, zwischen
Tieren und Pflanzen, die auch uns vertraut sind. Man
meint, den Geruch des Ackers zu spüren, den Pflug und
die Hufe der Pferde klappern, die Menschen reden zu
hören; es ist das bürgerliche städtische Europa, das da
zum ersten Male im Bilde mit einem Lobgesang auf das
Landleben erscheint. Man muß schon bis an den Aus-
bruch unseres neuen Zeitalters, oder besser, bis zu sei-
nen künstlerischen Vorläufern, bis zu Millet und vor
allem Courbet gehen, um im Geist Verwandtes zu finden.
“) Gute färb. Abb. u. a. bei Brandt a. a. O.
H. Avercamp, Der Postschlitten, Aquarell, 17,7 • 29 6 cm
Aus der Versteigerung Dr. Otto bei C. G. Boerner, Leipzig Zuschlagspreis: 2800 RM
129
des „Sachsenspiegel“0) des Eykc von Reptow aus dem
13. Jahrhundert finden wir Abbildungen aller durch das
damalige Recht verbotenen Handlungen mit einer Deut-
lichkeit gemalt, die sich aus dem Zweck der Handschrift
erklärt, juristische Definitionen durch eine Bilderschrift
zu erläutern. Da sehen wir Männer, die Gras auf des
Nachbars Grundstück mähen, in seinen Teichen fischen,
das über seinen Zaun hängende Holz der Bäume schla-
gen; hier wird uns das Leben des Bauern anschau-
licher, überzeugender, die Atmosphäre des Landlebens
konkreter erlebbar.
Auch die reine Historienkunst, die der mittelalter-
liche Adel in Auftrag gab, um die Geschichte seines Ge-
schlechts zu legitimieren, zeigt natürlich eine stärkere
Lebendigkeit gegenüber allen streng religiös gebunde-
den Darstellungen. Nur ein Beispiel sei zitiert, und
zwar ein verhältnismäßig sehr feines: der berühmte
Teppich oder besser das Linnen von Bayeux10) aus der
zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, auf dem die Taten
Wilhlems des Eroberers beginnend mit seinem Angriff
auf England bis zur Schlacht von Hastings erzählt wer-
den. Die Darstellungen zeigen auch Schilderungen aus
dem Bauernleben, so unter anderem zwei pflügende
Landleute; der eine von ihnen sitzt auf dem Pflug, der
andere führt die Pflugschar durch die Furche, das
Pferd, den Kopf nach vorne gestreckt, zieht mit großer
Anstrengung das Eisen durch den harten Boden. Der
Stil dieses Teppichs entspricht durchaus dem jugend-
frischen dynamischen Stil des Jahrhunderts. Alter von
der ungefähr nur wenig früheren Darstellung des gra-
benden Adams auf der Tür in Hildesheim sind seine
Malereien unterschieden durch die stärkere Anschaulich-
keit und Freude an der Schilderung gesehener Dinge.
Doch die Gesinnung dieser an der Peripherie der
°) Abb. in Phiilippi, Kulturgeschichtliche Bilder 'des Mittelalters.
10) Abb. ebendort.
mittelalterlichen Kunst entstandenen Darstellungen
setzt sich erst durch, als das Mittelalter zur Neige ging.
Der französische Adel des späten 14. und des frühen
15. Jahrhunderts war die erste gesellschaftliche Schicht,
die sich radikal, wenigstens innerhalb ihrer Burg-
mauern, von dem christlichen Verbot der Diesseits-
bejahung lossagte. Diesem Adel, nach außen hin blut-
rünstig, ländergierig, der Einigung Frankreichs feind-
lich, verdanken wir die ersten künstlerischen Doku-
mente des neuen Europa. Aus Uebersättigung aufge-
klärt und großzügig, ließ er sich von seinen Sekretären,
den Beauneveu, Hesdin, den Brüdern Limbourg und
wie sie alle heißen, Handschriften anfertigen, in denen
diese Maler, vom theologischen Druck erlöst, mit stau-
nender zärtlicher Entdeckerfreude noch an dem Un-
scheinbarsten daran gingen, die uns sichtbare Welt für
die Malerei zu erobern. Aus den Monatsbildern11) der
„Tres riches heures“ und der „Tres belles heures“ des
Herzogs von Berry erfahren wir, wie die Welt damals
aussah. Die theologischen Beschwörungsbilder für die
einzelnen Monate werden jetzt idyllische, beschauliche,
anschauliche Schilderungen der Landschaft und des
Landlebens, wie sie nie der arbeitende Bauer, sondern
nur der Städter schaffen kann. Da erblicken wir die
Burg des Herrn im Hintergrund, Weg und Fluß und
Acker mit pflügenden, säenden, erntenden Bauern,
Menschen, so wie wir sie zu sehen gewohnt sind, unter
dem gleichen Himmel, unter dem wir gehen, zwischen
Tieren und Pflanzen, die auch uns vertraut sind. Man
meint, den Geruch des Ackers zu spüren, den Pflug und
die Hufe der Pferde klappern, die Menschen reden zu
hören; es ist das bürgerliche städtische Europa, das da
zum ersten Male im Bilde mit einem Lobgesang auf das
Landleben erscheint. Man muß schon bis an den Aus-
bruch unseres neuen Zeitalters, oder besser, bis zu sei-
nen künstlerischen Vorläufern, bis zu Millet und vor
allem Courbet gehen, um im Geist Verwandtes zu finden.
“) Gute färb. Abb. u. a. bei Brandt a. a. O.
H. Avercamp, Der Postschlitten, Aquarell, 17,7 • 29 6 cm
Aus der Versteigerung Dr. Otto bei C. G. Boerner, Leipzig Zuschlagspreis: 2800 RM
129