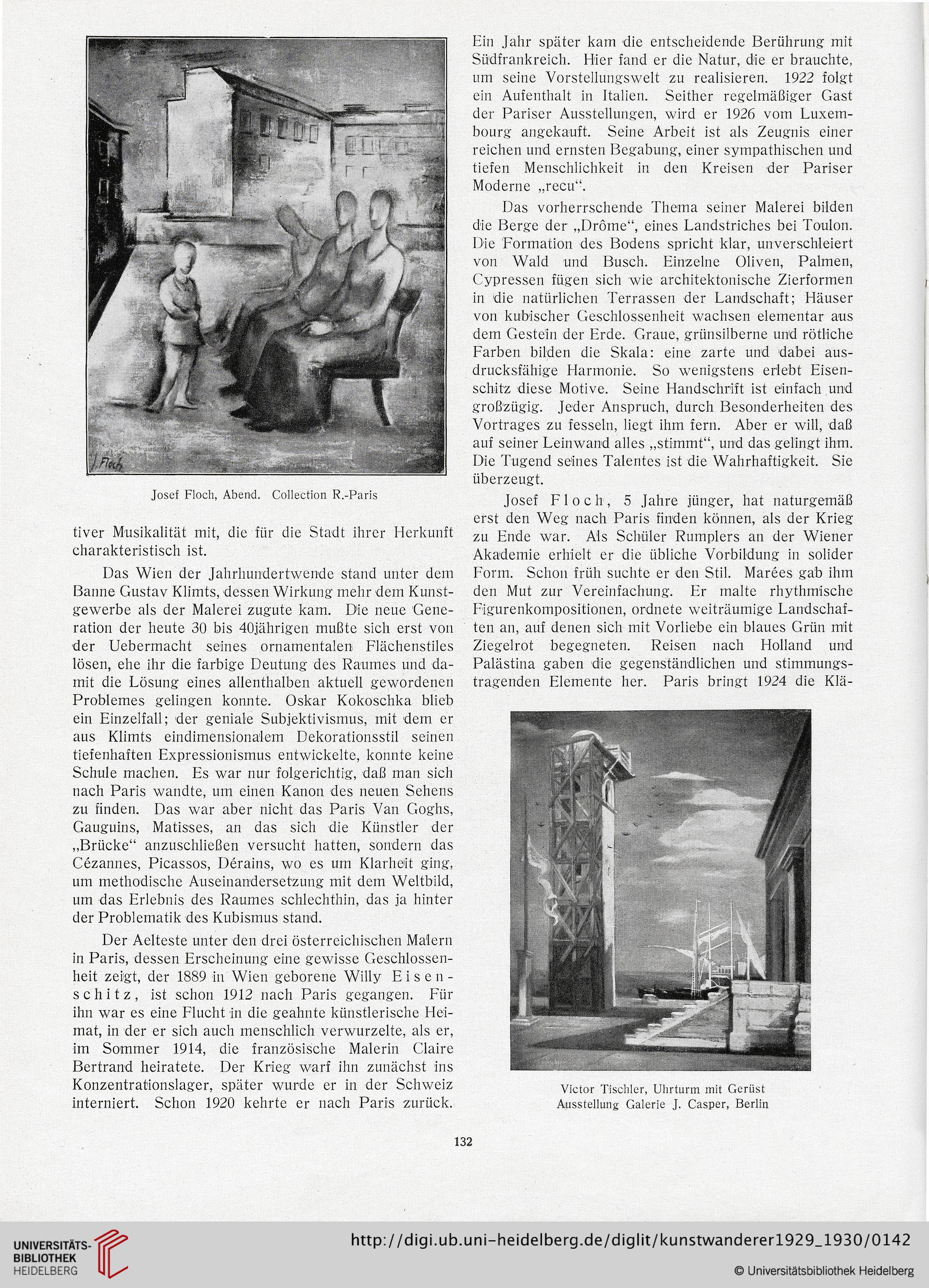Josef Floch, Abend. Collection R.-Paris
tiver Musikalität mit, die für die Stadt ihrer Herkunft
charakteristisch ist.
Das Wien der Jahrhundertwende stand unter dem
Banne Gustav Klimts, dessen Wirkung mehr dem Kunst-
gewerbe als der Malerei zugute kam. D'ie neue Gene-
ration der heute 30 bis 40jährigen mußte sich erst von
der Uebermacht seines ornamentalen Flächenstiles
lösen, ehe ihr die farbige Deutung des Raumes und da-
mit die Lösung eines allenthalben aktuell gewordenen
Problemes gelingen konnte. Oskar Kokoschka blieb
ein Einzelfall; der geniale Subjektivismus, mit dem er
aus Klimts eindimensionalem Dekorationsstil seinen
tiefenhaften Expressionismus entwickelte, konnte keine
Schule machen. Es war nur folgerichtig, daß man sich
nach Paris wandte, um einen Kanon des neuen Sehens
zu finden. Das war aber nicht das Paris Van Goghs,
Gauguins, Matisses, an das sich die Künstler der
„Brücke“ anzuschließen versucht hatten, sondern das
Cezannes, Picassos, Derains, wo es um Klarheit ging,
um methodische Auseinandersetzung mit dem Weltbild,
uin das Erlebnis des Raumes schlechthin, das ja hinter
der Problematik des Kubismus stand.
Der Aelteste unter den drei österreichischen Malern
in Paris, dessen Erscheinung eine gewisse Geschlossen-
heit zeigt, der 1889 in Wien geborene Willy Eisen-
s c h i t z , ist schon 1912 nach Paris gegangen. Für
ihn war es eine Flucht in die geahnte künstlerische Hei-
mat, in der er sich auch menschlich verwurzelte, als er,
im Sommer 1914, die französische Malerin Claire
Bertrand heiratete. Der Krieg warf ihn zunächst ins
Konzentrationslager, später wurde er in der Schweiz
interniert. Schon 1920 kehrte er nach Paris zurück.
Ein Jahr später kam die entscheidende Berührung mit
Südfrankreich. Hier fand er die Natur, die er brauchte,
um seine Vorstellungswelt zu realisieren. 1922 folgt
ein Aufenthalt in Italien. Seither regelmäßiger Gast
der Pariser Ausstellungen, wird er 1926 vom Luxem-
bourg angekauft. Seine Arbeit ist als Zeugnis einer
reichen und ernsten Begabung, einer sympathischen und
tiefen Menschlichkeit in den Kreisen der Pariser
Moderne „recu“.
Das vorherrschende Thema seiner Malerei bilden
die Berge der „Dröme“, eines Landstriches bei Toulon.
Die Formation des Bodens spricht klar, unverschleiert
von Wald und Busch. Einzelne Oliven, Palmen,
Cypressen fügen sich wie architektonische Zierformen
in die natürlichen Terrassen der Landschaft; Häuser
von kubischer Geschlossenheit wachsen elementar aus
dem Gestein der Erde. Graue, grünsilberne und rötliche
Farben bilden die Skala: eine zarte und dabei aus-
drucksfähige Harmonie. So wenigstens erlebt Eisen-
schitz diese Motive. Seine Handschrift ist einfach und
großzügig. Jeder Anspruch, durch Besonderheiten des
Vortrages zu fesseln, liegt ihm fern. Aber er will, daß
auf seiner Leinwand alles „stimmt“, und das gelingt ihm.
Die Tugend seines Talentes ist die Wahrhaftigkeit. Sie
überzeugt.
Josef Floch, 5 Jahre jünger, hat naturgemäß
erst den Weg nach Paris finden können, als der Krieg
zu Ende war. Als Schüler Rumplers an der Wiener
Akademie erhielt er die übliche Vorbildung in solider
Form. Schon früh suchte er den Stil. Marees gab ihm
den Mut zur Vereinfachung. Er malte rhythmische
Figurenkompositionen, ordnete weiträumige Landschaf-
ten an, auf denen sich mit Vorliebe ein blaues Grün mit
Ziegelrot begegneten. Reisen nach Holland und
Palästina gaben die gegenständlichen und stimmungs-
tragenden Elemente her. Paris bringt 1924 die Klä-
Victor Tischler, Uhrturm mit Gerüst
Ausstellung Galerie J. Casper, Berlin
132
tiver Musikalität mit, die für die Stadt ihrer Herkunft
charakteristisch ist.
Das Wien der Jahrhundertwende stand unter dem
Banne Gustav Klimts, dessen Wirkung mehr dem Kunst-
gewerbe als der Malerei zugute kam. D'ie neue Gene-
ration der heute 30 bis 40jährigen mußte sich erst von
der Uebermacht seines ornamentalen Flächenstiles
lösen, ehe ihr die farbige Deutung des Raumes und da-
mit die Lösung eines allenthalben aktuell gewordenen
Problemes gelingen konnte. Oskar Kokoschka blieb
ein Einzelfall; der geniale Subjektivismus, mit dem er
aus Klimts eindimensionalem Dekorationsstil seinen
tiefenhaften Expressionismus entwickelte, konnte keine
Schule machen. Es war nur folgerichtig, daß man sich
nach Paris wandte, um einen Kanon des neuen Sehens
zu finden. Das war aber nicht das Paris Van Goghs,
Gauguins, Matisses, an das sich die Künstler der
„Brücke“ anzuschließen versucht hatten, sondern das
Cezannes, Picassos, Derains, wo es um Klarheit ging,
um methodische Auseinandersetzung mit dem Weltbild,
uin das Erlebnis des Raumes schlechthin, das ja hinter
der Problematik des Kubismus stand.
Der Aelteste unter den drei österreichischen Malern
in Paris, dessen Erscheinung eine gewisse Geschlossen-
heit zeigt, der 1889 in Wien geborene Willy Eisen-
s c h i t z , ist schon 1912 nach Paris gegangen. Für
ihn war es eine Flucht in die geahnte künstlerische Hei-
mat, in der er sich auch menschlich verwurzelte, als er,
im Sommer 1914, die französische Malerin Claire
Bertrand heiratete. Der Krieg warf ihn zunächst ins
Konzentrationslager, später wurde er in der Schweiz
interniert. Schon 1920 kehrte er nach Paris zurück.
Ein Jahr später kam die entscheidende Berührung mit
Südfrankreich. Hier fand er die Natur, die er brauchte,
um seine Vorstellungswelt zu realisieren. 1922 folgt
ein Aufenthalt in Italien. Seither regelmäßiger Gast
der Pariser Ausstellungen, wird er 1926 vom Luxem-
bourg angekauft. Seine Arbeit ist als Zeugnis einer
reichen und ernsten Begabung, einer sympathischen und
tiefen Menschlichkeit in den Kreisen der Pariser
Moderne „recu“.
Das vorherrschende Thema seiner Malerei bilden
die Berge der „Dröme“, eines Landstriches bei Toulon.
Die Formation des Bodens spricht klar, unverschleiert
von Wald und Busch. Einzelne Oliven, Palmen,
Cypressen fügen sich wie architektonische Zierformen
in die natürlichen Terrassen der Landschaft; Häuser
von kubischer Geschlossenheit wachsen elementar aus
dem Gestein der Erde. Graue, grünsilberne und rötliche
Farben bilden die Skala: eine zarte und dabei aus-
drucksfähige Harmonie. So wenigstens erlebt Eisen-
schitz diese Motive. Seine Handschrift ist einfach und
großzügig. Jeder Anspruch, durch Besonderheiten des
Vortrages zu fesseln, liegt ihm fern. Aber er will, daß
auf seiner Leinwand alles „stimmt“, und das gelingt ihm.
Die Tugend seines Talentes ist die Wahrhaftigkeit. Sie
überzeugt.
Josef Floch, 5 Jahre jünger, hat naturgemäß
erst den Weg nach Paris finden können, als der Krieg
zu Ende war. Als Schüler Rumplers an der Wiener
Akademie erhielt er die übliche Vorbildung in solider
Form. Schon früh suchte er den Stil. Marees gab ihm
den Mut zur Vereinfachung. Er malte rhythmische
Figurenkompositionen, ordnete weiträumige Landschaf-
ten an, auf denen sich mit Vorliebe ein blaues Grün mit
Ziegelrot begegneten. Reisen nach Holland und
Palästina gaben die gegenständlichen und stimmungs-
tragenden Elemente her. Paris bringt 1924 die Klä-
Victor Tischler, Uhrturm mit Gerüst
Ausstellung Galerie J. Casper, Berlin
132