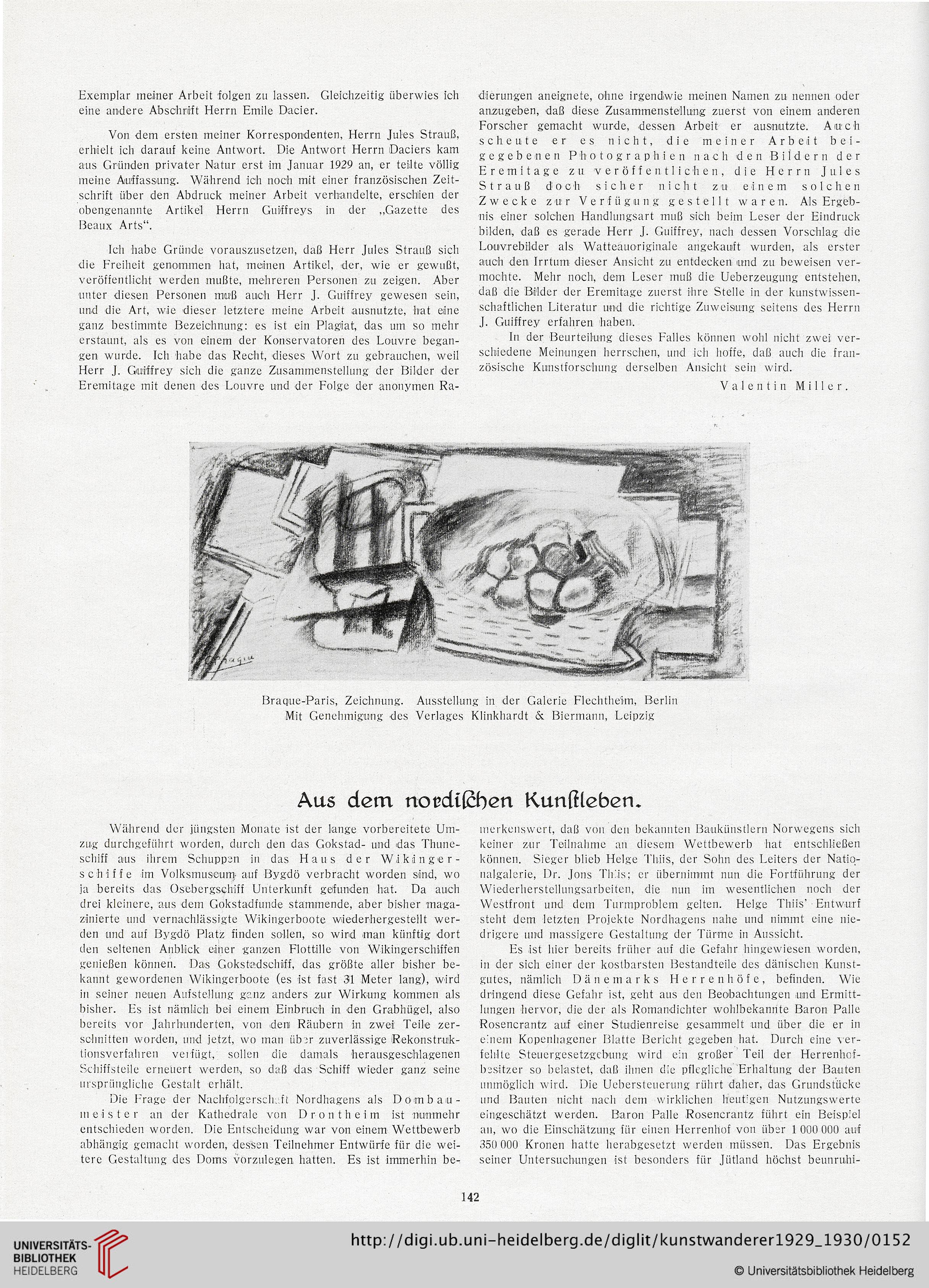Exemplar meiner Arbeit folgen zu lassen. Gleichzeitig überwies ich
eine andere Abschrift Herrn Enrile Dacier.
Von dem ersten meiner Korrespondenten, Herrn Jules Strauß,
erhielt ich darauf keine Antwort. Die Antwort Herrn Daciers kam
aus Gründen privater Natur erst im Januar 1929 an, er teilte völlig
meine Auffassung. Während ich noch mit einer französischen Zeit-
schrift über den Abdruck meiner Arbeit verhandelte, erschien der
obengenannte Artikel Herrn Guiffreys in der ,,Gazette des
Beaux Arts“.
Ich habe Gründe vorauszusetzen, daß Herr Jules Strauß sich
die Freiheit genommen hat, meinen Artikel, der, wie er gewußt,
veröffentlicht werden mußte, mehreren Personen zu zeigen. Aber
unter diesen Personen muß auch Herr J. Guiffrey gewesen sein,
und die Art, wie dieser letztere meine Arbeit ausnutzte, hat eine
ganz bestimmte Bezeichnung: es ist ein Plagiat, das um so mehr
erstaunt, als es von einem der Konservatoren des Louvre began-
gen wurde. Ich habe das Recht, dieses Wort zu gebrauchen, weil
Herr J. Guiffrey sich die ganze Zusammenstellung der Bilder der
Eremitage mit denen des Louvre und der Folge der anonymen Ra-
dierungen aneignete, ohne irgendwie meinen Namen zu nennen oder
anzugeben, daß diese Zusammenstellung zuerst von einem anderen
Forscher gemacht wurde, dessen Arbeit er ausoutzte. Auch
scheute er es nicht, die meiner Arbeit bei-
gegebenen Photographien nach den Bildern der
Eremitage zu veröffentlichen, die Herrn Jules
Strauß doch sicher nicht zu einem solchen
Zwecke zur Verfügung gestellt waren. Als Ergeb-
nis einer solchen Handlungsart muß sich beim Leser der Eindruck
bilden, daß es gerade Herr J. Guiffrey, nach dessen Vorschlag die
Louvrebilder als Watteauoriginale angekauft wurden, als erster
auch den Irrtum dieser Ansicht zu entdecken und zu beweisen ver-
mochte. Mehr noch, dem Leser muß die Ueberzeugung entstehen,
daß die Bilder der Eremitage zuerst ihre Stelle in der kunstwissen-
schaftlichen Literatur und die richtige Zuweisung seitens des Herrn
J. Guiffrey erfahren haben.
In der Beurteilung dieses Falles können wohl nicht zwei ver-
schiedene Meinungen herrschen, und ich hoffe, daß auch die fran-
zösische Kunstforschung derselben Ansicht sein wird.
Valentin Miller.
Braque-Paris, Zeichnung. Ausstellung in der Galerie Flechtheim, Berlin
Mit Genehmigung des Verlages Klinkhardt & Biermann, Leipzig
Aus dem nördlichen Kunffleben.
Wahrend der jüngsten Monate ist der lange vorbereitete Um-
zug durchgeführt worden, durch den das Gokstad- und das Thune-
schiff aus ihrem Schuppen in das Haus der W i klinge r-
schiffe im Volksmuseum auf Bygdö verbracht worden sind, wo
ja bereits das Osebergschiff Unterkunft gefunden hat. Da auch
drei kleinere, aus dem Gokstadfunde stammende, aber bisher maga-
zinierte und vernachlässigte Wikingerboote wiederhergestellt wer-
den und auf Bygdö Platz finden sollen, so wird man künftig dort
den seltenen Anblick einer ganzen Flottille von Wikingerschiffen
genießen können. Das Gokstedschiff, das größte aller bisher be-
kannt gewordenen Wikingerboote (es ist fast 31 Meter lang), wird
in seiner neuen Aufstellung ganz anders zur Wirkung kommen als
bisher. Es ist nämlich bei einem Einbruch in den Grabhügel, also
bereits vor Jahrhunderten, von den Räubern in zwei Teile zer-
schnitten worden, und jetzt, wo man über zuverlässige Rekonstruk-
tionsverfaliren verfügt, sollen die damals herausgeschlagenen
Schiffsteile erneuert werden, so daß das Schiff wieder ganz seine
ursprüngliche Gestalt erhält.
Die Frage der Nachfolgerschaft Nordhagens als Dombau-
m e i s t e r an der Kathedrale von Drontheim ist nunmehr
entschieden worden. Die Entscheidung war von einem Wettbewerb
abhängig gemacht worden, dessen Teilnehmer Entwürfe für die wei-
tere Gestaltung des Doms vorzulegen hatten. Es ist immerhin be-
merkenswert, daß von den bekannten Baukünstlern Norwegens sich
keiner zur Teilnahme au diesem Wettbewerb hat entschließen
können. Sieger blieb Helge Thiis, der Sohn des Leiters der Natiq»
nalgalerie, Dr. Jons Thiis; er übernimmt nun die Fortführung der
Wiederlierstellungsarbeiten, die nun im wesentlichen noch der
Westfront und dem Turmproblem gelten. Helge Thiis’ Entwurf
steht dem letzten Projekte Nordhagens nahe und nimmt eine nie-
drigere und massigere Gestaltung der Türme in Aussicht.
Es ist hier bereits früher auf die Gefahr hingewiesen worden,
in der sich einer der kostbarsten Bestandteile des dänischen Kunst-
gutes, nämlich Dänemarks Herrenhöfe, befinden. Wie
dringend diese Gefahr ist, geht aus den Beobachtungen uind Ermitt-
lungen hervor, die der als Romandichter wohlbekannte Baron Palle
Rosencrantz auf einer Studienreise gesammelt und über die er in
einem Kopenhagener Blatte Bericht gegeben hat. Durch eine ver-
fehlte Steuergesetzgebung wird ein großer Teil der Herrenhof-
besitzer so belastet, daß ihnen die pflegliche Erhaltung der Bauten
unmöglich wird. Die Uebersteuerung rührt daher, das Grundstücke
lind Bauten nicht nach dern wirklichen heutigen Nutzungswerte
eingeschätzt werden. Baron Palle Rosencrantz führt ein Beispiel
an, wo die Einschätzung für einen Herrenhof von über 1 000 000 auf
350 000 Kronen hatte herabgesetzt werden müssen. Das Ergebnis
seiner Untersuchungen ist besonders für Jütland höchst beunruhi-
142
eine andere Abschrift Herrn Enrile Dacier.
Von dem ersten meiner Korrespondenten, Herrn Jules Strauß,
erhielt ich darauf keine Antwort. Die Antwort Herrn Daciers kam
aus Gründen privater Natur erst im Januar 1929 an, er teilte völlig
meine Auffassung. Während ich noch mit einer französischen Zeit-
schrift über den Abdruck meiner Arbeit verhandelte, erschien der
obengenannte Artikel Herrn Guiffreys in der ,,Gazette des
Beaux Arts“.
Ich habe Gründe vorauszusetzen, daß Herr Jules Strauß sich
die Freiheit genommen hat, meinen Artikel, der, wie er gewußt,
veröffentlicht werden mußte, mehreren Personen zu zeigen. Aber
unter diesen Personen muß auch Herr J. Guiffrey gewesen sein,
und die Art, wie dieser letztere meine Arbeit ausnutzte, hat eine
ganz bestimmte Bezeichnung: es ist ein Plagiat, das um so mehr
erstaunt, als es von einem der Konservatoren des Louvre began-
gen wurde. Ich habe das Recht, dieses Wort zu gebrauchen, weil
Herr J. Guiffrey sich die ganze Zusammenstellung der Bilder der
Eremitage mit denen des Louvre und der Folge der anonymen Ra-
dierungen aneignete, ohne irgendwie meinen Namen zu nennen oder
anzugeben, daß diese Zusammenstellung zuerst von einem anderen
Forscher gemacht wurde, dessen Arbeit er ausoutzte. Auch
scheute er es nicht, die meiner Arbeit bei-
gegebenen Photographien nach den Bildern der
Eremitage zu veröffentlichen, die Herrn Jules
Strauß doch sicher nicht zu einem solchen
Zwecke zur Verfügung gestellt waren. Als Ergeb-
nis einer solchen Handlungsart muß sich beim Leser der Eindruck
bilden, daß es gerade Herr J. Guiffrey, nach dessen Vorschlag die
Louvrebilder als Watteauoriginale angekauft wurden, als erster
auch den Irrtum dieser Ansicht zu entdecken und zu beweisen ver-
mochte. Mehr noch, dem Leser muß die Ueberzeugung entstehen,
daß die Bilder der Eremitage zuerst ihre Stelle in der kunstwissen-
schaftlichen Literatur und die richtige Zuweisung seitens des Herrn
J. Guiffrey erfahren haben.
In der Beurteilung dieses Falles können wohl nicht zwei ver-
schiedene Meinungen herrschen, und ich hoffe, daß auch die fran-
zösische Kunstforschung derselben Ansicht sein wird.
Valentin Miller.
Braque-Paris, Zeichnung. Ausstellung in der Galerie Flechtheim, Berlin
Mit Genehmigung des Verlages Klinkhardt & Biermann, Leipzig
Aus dem nördlichen Kunffleben.
Wahrend der jüngsten Monate ist der lange vorbereitete Um-
zug durchgeführt worden, durch den das Gokstad- und das Thune-
schiff aus ihrem Schuppen in das Haus der W i klinge r-
schiffe im Volksmuseum auf Bygdö verbracht worden sind, wo
ja bereits das Osebergschiff Unterkunft gefunden hat. Da auch
drei kleinere, aus dem Gokstadfunde stammende, aber bisher maga-
zinierte und vernachlässigte Wikingerboote wiederhergestellt wer-
den und auf Bygdö Platz finden sollen, so wird man künftig dort
den seltenen Anblick einer ganzen Flottille von Wikingerschiffen
genießen können. Das Gokstedschiff, das größte aller bisher be-
kannt gewordenen Wikingerboote (es ist fast 31 Meter lang), wird
in seiner neuen Aufstellung ganz anders zur Wirkung kommen als
bisher. Es ist nämlich bei einem Einbruch in den Grabhügel, also
bereits vor Jahrhunderten, von den Räubern in zwei Teile zer-
schnitten worden, und jetzt, wo man über zuverlässige Rekonstruk-
tionsverfaliren verfügt, sollen die damals herausgeschlagenen
Schiffsteile erneuert werden, so daß das Schiff wieder ganz seine
ursprüngliche Gestalt erhält.
Die Frage der Nachfolgerschaft Nordhagens als Dombau-
m e i s t e r an der Kathedrale von Drontheim ist nunmehr
entschieden worden. Die Entscheidung war von einem Wettbewerb
abhängig gemacht worden, dessen Teilnehmer Entwürfe für die wei-
tere Gestaltung des Doms vorzulegen hatten. Es ist immerhin be-
merkenswert, daß von den bekannten Baukünstlern Norwegens sich
keiner zur Teilnahme au diesem Wettbewerb hat entschließen
können. Sieger blieb Helge Thiis, der Sohn des Leiters der Natiq»
nalgalerie, Dr. Jons Thiis; er übernimmt nun die Fortführung der
Wiederlierstellungsarbeiten, die nun im wesentlichen noch der
Westfront und dem Turmproblem gelten. Helge Thiis’ Entwurf
steht dem letzten Projekte Nordhagens nahe und nimmt eine nie-
drigere und massigere Gestaltung der Türme in Aussicht.
Es ist hier bereits früher auf die Gefahr hingewiesen worden,
in der sich einer der kostbarsten Bestandteile des dänischen Kunst-
gutes, nämlich Dänemarks Herrenhöfe, befinden. Wie
dringend diese Gefahr ist, geht aus den Beobachtungen uind Ermitt-
lungen hervor, die der als Romandichter wohlbekannte Baron Palle
Rosencrantz auf einer Studienreise gesammelt und über die er in
einem Kopenhagener Blatte Bericht gegeben hat. Durch eine ver-
fehlte Steuergesetzgebung wird ein großer Teil der Herrenhof-
besitzer so belastet, daß ihnen die pflegliche Erhaltung der Bauten
unmöglich wird. Die Uebersteuerung rührt daher, das Grundstücke
lind Bauten nicht nach dern wirklichen heutigen Nutzungswerte
eingeschätzt werden. Baron Palle Rosencrantz führt ein Beispiel
an, wo die Einschätzung für einen Herrenhof von über 1 000 000 auf
350 000 Kronen hatte herabgesetzt werden müssen. Das Ergebnis
seiner Untersuchungen ist besonders für Jütland höchst beunruhi-
142