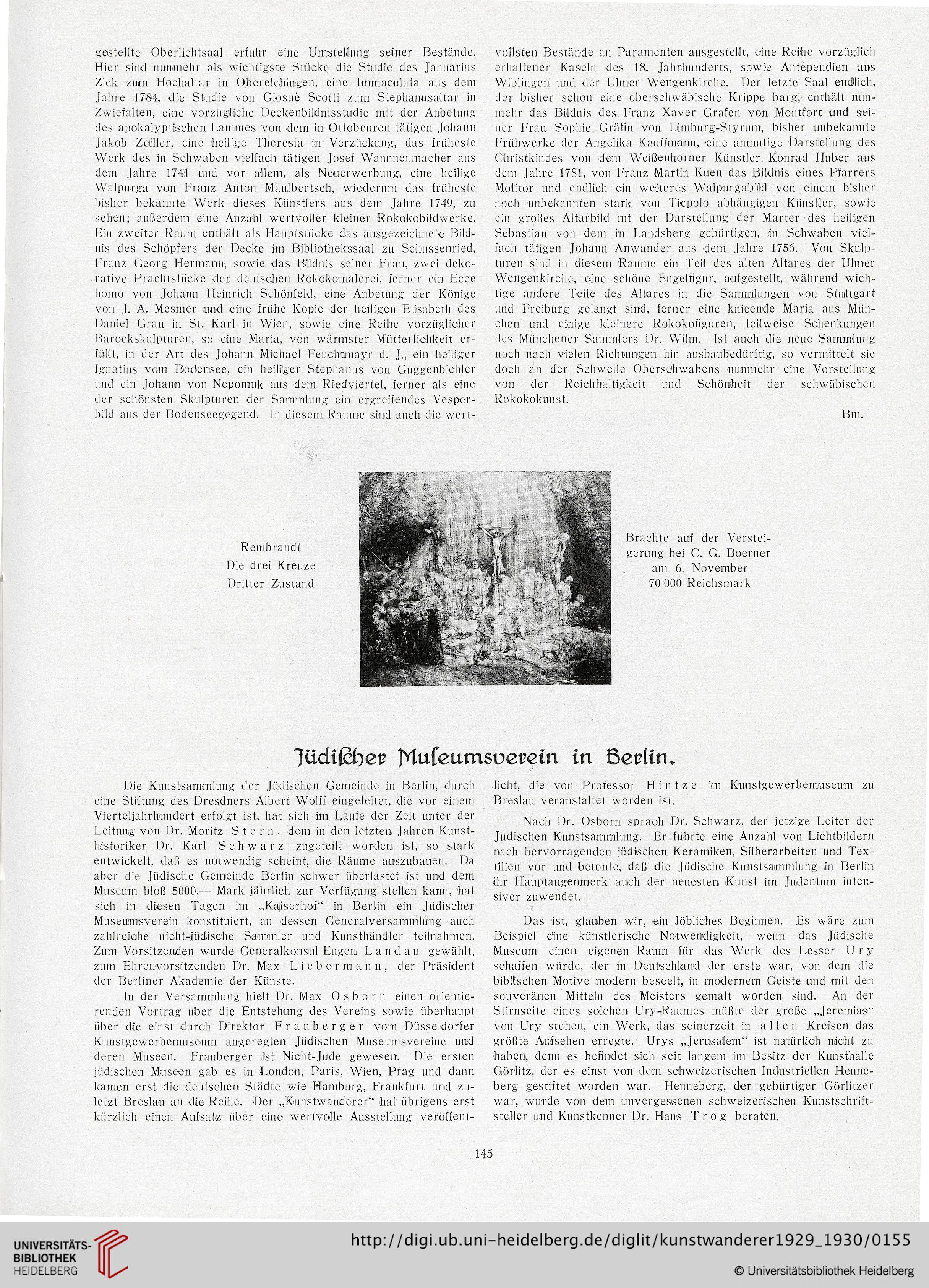gestellte OberHchtsaal erfuhr eine Umstellung seiner Bestände.
Hier sind nunmehr als wichtigste Stücke die Studie des Januarius
Zick zum Hochaltar in Oberelchingen, eine Immaculata aus dem
Jahre 1784, die Studie von Gi-osue Scotti zum. Stephauusaltar in
Zwiefalten, eine vorzügliche Deckenbildnisstiidie mit der Anbetung
des apokalyptischen Lammes von dem in Ottobeuren tätigen Johann
Jakob Zeill-er, eine heilige Theresia in Verzückung, das früheste
Werk des in Schwaben vielfach tätigen Josef Wannneninacher aus
dem Jahre 17411 und vor allem, als Neuerwerbung, eine heilige
Walpurga von Franz Anton Mau,Iberisch, wiederum das früheste
bisher bekannte Werk dieses Künstlers aus dem Jahre 1749, zu
sehen; außerdem eine Anzahl wertvoller kleiner Rokokobildwerke.
Lin zweiter Raum enthält als Hauptstücke das ausgezeichnete Bild-
nis des Schöpfers der Decke im Bibliothekssaal zu Sclmssenried,
Franz Georg Hermann, sowie das Bildnis seiner Frau, zwei deko-
rative Prachtstücke der deutschen Rokokomalerei, ferner ein Ecce
liomo von Johann Heinrich Schönfeld, eine Anbetung der Könige
von J. A. Mesmer und eine frühe Kopie der heiligen Elisabeth des
Daniel Gran in St. Karl in Wien, sowie eine Reihe vorzüglicher
Barockskulpturen, so eine Maria, von wärmster Mütterlichkeit er-
füllt, in der Art des Johann Michael Feuchtmayr d. J„ ein heiliger
Ignatius vom Bodensee, ein heiliger Stephanus von Guggenbichler
und ein Johann von Nepomuk aus dem Riedviertel, ferner als eine
der schönsten Skulpturen der Sammlung ein ergreifendes Vesper-
bild aus der Bodenseegegend. In diesem Raume sind auch die wert-
vollsten Bestände an Paramenten ausgestellt, eine Reihe vorzüglich
erhaltener Kasein des 18. Jahrhunderts, sowie Antependien aus
Wiblingen und der Dimer Wengenkirche. Der letzte Saal endlich,
der bisher schon eine oberschwäbische Krippe barg, enthält nun-
mehr das Bildnis des Franz Xaver Grafen von Montfort und sei-
ner Frau Sophie Gräfin von Limburg-Styrum, bisher unbekannte
Frühwerke der Angelika Kauffmann, eine anmutige Darstellung des
Christkindes von dem Weißenhorner Künstler. Konrad Huber aus
dem Jahre 1784, von Franz Martin Kuen das Bildnis eines Pfarrers
Molitor und endlich ein weiteres WalpurgabM von einem bisher
noch unbekannten stark von Ticpolo abhängigen Künstler, sowie
ein großes Altarbild mt der Darstellung der Marter des heiligen
Sebastian von dem in Landsberg gebürtigen, in Schwaben viel-
fach tätigen Johann Anwander aus dem Jahre 1756. Von Skulp-
turen sind in diesem Raume ein Teil des alten Altares der Ulmer
Wengenkirche, eine schöne Engelfigur, aufgestellt, während wich-
tige andere Teile des Altares in die Sammlungen von Stuttgart
und Freiburg gelangt sind, ferner eine knieende Maria ans Mün-
chen und einige kleinere Rokokofiguren, teilweise Schenkungen
des Münchener Sammlers Dr. W'ilm. Ist auch die neue Sammlung
noch nach vielen Richtungen hin ausbaubedürftig, so vermittelt sie
doch an der Schwelle Obersdrwabens nunmehr eine Vorstellung
von der Reichhaltigkeit und Schönheit der schwäbischen
Rokokokunst.
Bin.
Rembrandt
Die drei Kreuze
Dritter Zustand
Brachte auf der Verstei-
gerung bei C. G. Boerner
am 6. November
70 000 Reichsmark
lüdiücbec Mufeumsüet’ein in Beeliru
Die Kunstsammlung der Jüdischen Gemeinde in Berlin, durch
eine Stiftung des Dresdners Albert Wolff eingeleitet, die vor einem
Vierteljahrhundert erfolgt ist, hat sich im Laufe der Zeit unter der
Leitung von Dr. Moritz Stern, dem in den ietzten Jahren Kunst-
historiker Dr. Karl Schwarz zugeteilt worden ist, so stark
entwickelt, daß es notwendig scheint, die Räume auszubauen. Da
aber die Jüdische Gemeinde Berlin schwer überlastet ist und dem
Museum bloß 5000,— Mark jährlich zur Verfügung stellen kann, hat
sich: in diesen Tagen im „Kaiiserhof“ in Berlin ein Jüdischer
Museumsverein konstituiert, au dessen Generalversammlung auch
zahlreiche nicht-jüdische Sammler und Kunsthändler teilnahmen.
Zum Vorsitzenden wurde Generalkonsul Eugen Landau gewählt,
zum Ehrenvorsitzenden Dr. Max Li ebermann, der Präsident
der Berliner Akademie der Künste.
In der Versammlung hielt Dr. Max Osborn einen orientie-
renden Vortrag über die Entstehung des Vereins sowie überhaupt
über die einst durch Direktor Frauberger vom Düsseldorfer
Kunstgewerbemuseum angeregten Jüdischen Museumsvereine und
deren Museen. Frauberger ist Nicht-Jude gewesen. Die ersten
jüdischen Museen gab es in London, Paris, Wien, Prag und dann
kamen erst die deutschen Städte wie Hamburg, Frankfurt und zu-
letzt Breslau an die Reihe. Der „Kunstwanderer“ hat übrigens erst
kürzlich einen Aufsatz über eine wertvolle Ausstellung veröffent-
licht, die von Professor H i n t z e im Kunstgewerbemuseum zu
Breslau veranstaltet worden ist.
Nach Dr. Osborn sprach Dr. Schwarz, der jetzige Leiter der
Jüdischen Kunstsammlung. Er führte eine Anzahl von Lichtbildern
nach hervorragenden jüdischen Keramiken, Silberarbeiten und Tex-
tilien vor und betonte, daß die Jüdische Kunstsammlung in Berlin
ihr Hauptaugenmerk auch der neuesten Kunst im Judentum inten-
siver zuwendet.
Das ist, glauben wir, ein löbliches Beginnen. Es wäre zum
Beispiel eine künstlerische Notwendigkeit, wenn das Jüdische
Museum einen eigenen Raum für das Werk des Lesser Ury
schaffen würde, der in Deutschland der erste war, von dem die
bibitschen Motive modern beseelt, in modernem Geiste und -mit den
souveränen Mitteln des Meisters gemalt worden sind. An der
Stirnseite eines solchen Ury-Raumes müßte der große „Jeremias“
von Ury stehen, ein Werk, das seinerzeit in allen Kreisen das
größte Aufsehen erregte. Urys „Jerusalem“ ist natürlich nicht zu
-haben, denn es befindet sich seit langem im Besitz der Kunsthalle
Görlitz, der es einst von -dem schweizerischen Industriellen Henne-
berg gestiftet worden war. Henneberg, der gebürtiger Görlitzer
war, wurde von dem unvergessenen schweizerischen Kunstschrift-
steiler und Kunstkenner Dr. Hans T r o g beraten.
145
Hier sind nunmehr als wichtigste Stücke die Studie des Januarius
Zick zum Hochaltar in Oberelchingen, eine Immaculata aus dem
Jahre 1784, die Studie von Gi-osue Scotti zum. Stephauusaltar in
Zwiefalten, eine vorzügliche Deckenbildnisstiidie mit der Anbetung
des apokalyptischen Lammes von dem in Ottobeuren tätigen Johann
Jakob Zeill-er, eine heilige Theresia in Verzückung, das früheste
Werk des in Schwaben vielfach tätigen Josef Wannneninacher aus
dem Jahre 17411 und vor allem, als Neuerwerbung, eine heilige
Walpurga von Franz Anton Mau,Iberisch, wiederum das früheste
bisher bekannte Werk dieses Künstlers aus dem Jahre 1749, zu
sehen; außerdem eine Anzahl wertvoller kleiner Rokokobildwerke.
Lin zweiter Raum enthält als Hauptstücke das ausgezeichnete Bild-
nis des Schöpfers der Decke im Bibliothekssaal zu Sclmssenried,
Franz Georg Hermann, sowie das Bildnis seiner Frau, zwei deko-
rative Prachtstücke der deutschen Rokokomalerei, ferner ein Ecce
liomo von Johann Heinrich Schönfeld, eine Anbetung der Könige
von J. A. Mesmer und eine frühe Kopie der heiligen Elisabeth des
Daniel Gran in St. Karl in Wien, sowie eine Reihe vorzüglicher
Barockskulpturen, so eine Maria, von wärmster Mütterlichkeit er-
füllt, in der Art des Johann Michael Feuchtmayr d. J„ ein heiliger
Ignatius vom Bodensee, ein heiliger Stephanus von Guggenbichler
und ein Johann von Nepomuk aus dem Riedviertel, ferner als eine
der schönsten Skulpturen der Sammlung ein ergreifendes Vesper-
bild aus der Bodenseegegend. In diesem Raume sind auch die wert-
vollsten Bestände an Paramenten ausgestellt, eine Reihe vorzüglich
erhaltener Kasein des 18. Jahrhunderts, sowie Antependien aus
Wiblingen und der Dimer Wengenkirche. Der letzte Saal endlich,
der bisher schon eine oberschwäbische Krippe barg, enthält nun-
mehr das Bildnis des Franz Xaver Grafen von Montfort und sei-
ner Frau Sophie Gräfin von Limburg-Styrum, bisher unbekannte
Frühwerke der Angelika Kauffmann, eine anmutige Darstellung des
Christkindes von dem Weißenhorner Künstler. Konrad Huber aus
dem Jahre 1784, von Franz Martin Kuen das Bildnis eines Pfarrers
Molitor und endlich ein weiteres WalpurgabM von einem bisher
noch unbekannten stark von Ticpolo abhängigen Künstler, sowie
ein großes Altarbild mt der Darstellung der Marter des heiligen
Sebastian von dem in Landsberg gebürtigen, in Schwaben viel-
fach tätigen Johann Anwander aus dem Jahre 1756. Von Skulp-
turen sind in diesem Raume ein Teil des alten Altares der Ulmer
Wengenkirche, eine schöne Engelfigur, aufgestellt, während wich-
tige andere Teile des Altares in die Sammlungen von Stuttgart
und Freiburg gelangt sind, ferner eine knieende Maria ans Mün-
chen und einige kleinere Rokokofiguren, teilweise Schenkungen
des Münchener Sammlers Dr. W'ilm. Ist auch die neue Sammlung
noch nach vielen Richtungen hin ausbaubedürftig, so vermittelt sie
doch an der Schwelle Obersdrwabens nunmehr eine Vorstellung
von der Reichhaltigkeit und Schönheit der schwäbischen
Rokokokunst.
Bin.
Rembrandt
Die drei Kreuze
Dritter Zustand
Brachte auf der Verstei-
gerung bei C. G. Boerner
am 6. November
70 000 Reichsmark
lüdiücbec Mufeumsüet’ein in Beeliru
Die Kunstsammlung der Jüdischen Gemeinde in Berlin, durch
eine Stiftung des Dresdners Albert Wolff eingeleitet, die vor einem
Vierteljahrhundert erfolgt ist, hat sich im Laufe der Zeit unter der
Leitung von Dr. Moritz Stern, dem in den ietzten Jahren Kunst-
historiker Dr. Karl Schwarz zugeteilt worden ist, so stark
entwickelt, daß es notwendig scheint, die Räume auszubauen. Da
aber die Jüdische Gemeinde Berlin schwer überlastet ist und dem
Museum bloß 5000,— Mark jährlich zur Verfügung stellen kann, hat
sich: in diesen Tagen im „Kaiiserhof“ in Berlin ein Jüdischer
Museumsverein konstituiert, au dessen Generalversammlung auch
zahlreiche nicht-jüdische Sammler und Kunsthändler teilnahmen.
Zum Vorsitzenden wurde Generalkonsul Eugen Landau gewählt,
zum Ehrenvorsitzenden Dr. Max Li ebermann, der Präsident
der Berliner Akademie der Künste.
In der Versammlung hielt Dr. Max Osborn einen orientie-
renden Vortrag über die Entstehung des Vereins sowie überhaupt
über die einst durch Direktor Frauberger vom Düsseldorfer
Kunstgewerbemuseum angeregten Jüdischen Museumsvereine und
deren Museen. Frauberger ist Nicht-Jude gewesen. Die ersten
jüdischen Museen gab es in London, Paris, Wien, Prag und dann
kamen erst die deutschen Städte wie Hamburg, Frankfurt und zu-
letzt Breslau an die Reihe. Der „Kunstwanderer“ hat übrigens erst
kürzlich einen Aufsatz über eine wertvolle Ausstellung veröffent-
licht, die von Professor H i n t z e im Kunstgewerbemuseum zu
Breslau veranstaltet worden ist.
Nach Dr. Osborn sprach Dr. Schwarz, der jetzige Leiter der
Jüdischen Kunstsammlung. Er führte eine Anzahl von Lichtbildern
nach hervorragenden jüdischen Keramiken, Silberarbeiten und Tex-
tilien vor und betonte, daß die Jüdische Kunstsammlung in Berlin
ihr Hauptaugenmerk auch der neuesten Kunst im Judentum inten-
siver zuwendet.
Das ist, glauben wir, ein löbliches Beginnen. Es wäre zum
Beispiel eine künstlerische Notwendigkeit, wenn das Jüdische
Museum einen eigenen Raum für das Werk des Lesser Ury
schaffen würde, der in Deutschland der erste war, von dem die
bibitschen Motive modern beseelt, in modernem Geiste und -mit den
souveränen Mitteln des Meisters gemalt worden sind. An der
Stirnseite eines solchen Ury-Raumes müßte der große „Jeremias“
von Ury stehen, ein Werk, das seinerzeit in allen Kreisen das
größte Aufsehen erregte. Urys „Jerusalem“ ist natürlich nicht zu
-haben, denn es befindet sich seit langem im Besitz der Kunsthalle
Görlitz, der es einst von -dem schweizerischen Industriellen Henne-
berg gestiftet worden war. Henneberg, der gebürtiger Görlitzer
war, wurde von dem unvergessenen schweizerischen Kunstschrift-
steiler und Kunstkenner Dr. Hans T r o g beraten.
145