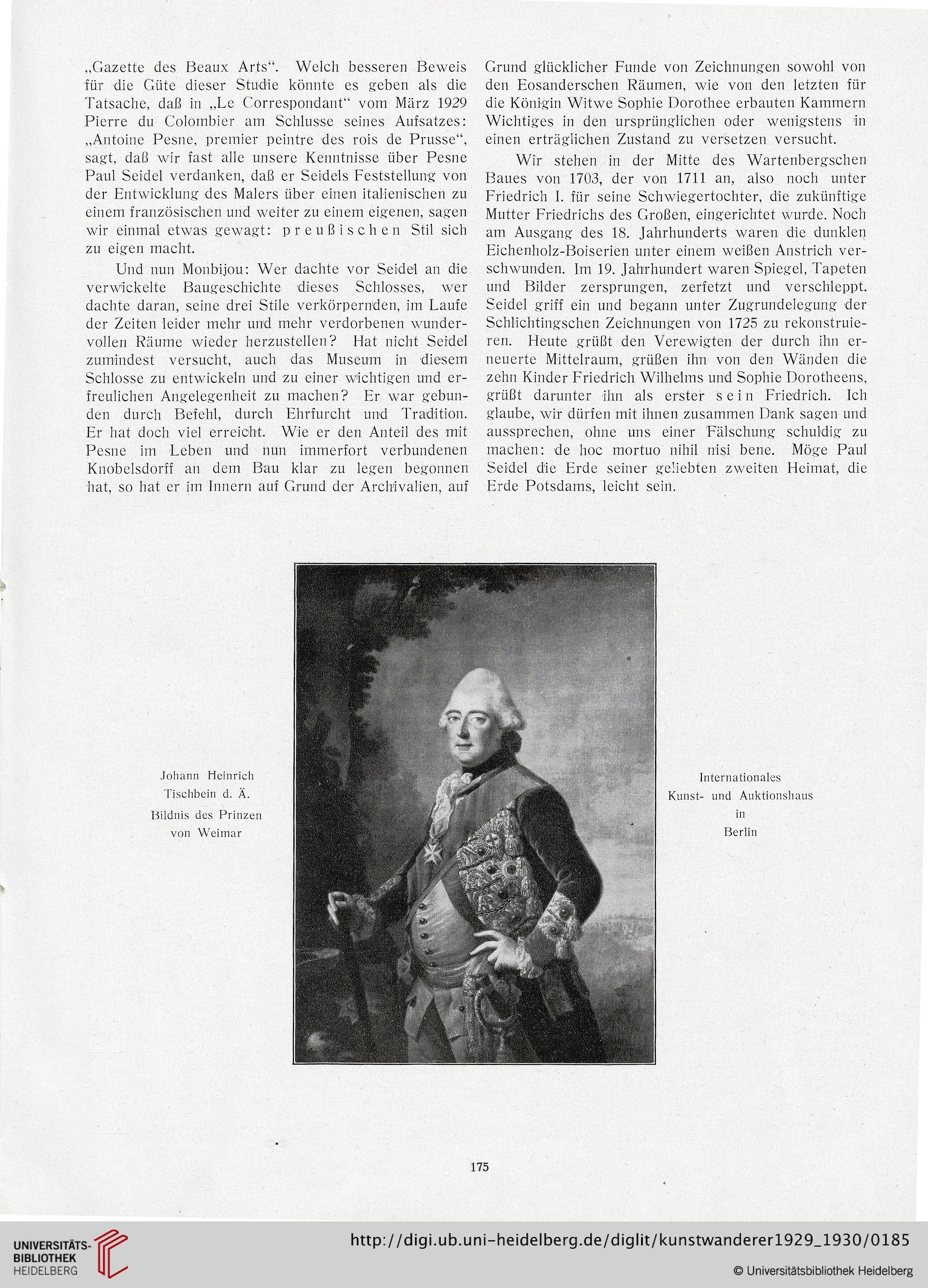Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 11./12.1929/30
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26238#0185
DOI Heft:
1./2. Januarheft
DOI Artikel:Hildebrand, Arnold: Paul Seidel †
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26238#0185
„Gazette des Beaux Arts“. Welch besseren Beweis
für die Güte dieser Studie konnte es geben als die
Tatsache, daß in „Le Correspondant“ vom März 1929
Pierre du Colombier am Schlüsse seines Aufsatzes:
„Antoine Pesne, premier peintre des rois de Prusse“,
sagt, daß wir fast alle unsere Kenntnisse über Pesne
Paul Seidel verdanken, daß er Seidels Feststellung von
der Entwicklung des Malers über einen italienischen zu
einem französischen und weiter zu einem eigenen, sagen
wir einmal etwas gewagt: preußischen Stil sich
zu eigen macht.
Und nun Monbijou: Wer dachte vor Seidel an die
verwickelte Baugeschichte dieses Schlosses, wer
dachte daran, seine drei Stile verkörpernden, im Laufe
der Zeiten leider mehr und mehr verdorbenen wunder-
vollen Räume wieder herzustellen? Hat nicht Seidel
zumindest versucht, auch das Museum in diesem
Schlosse zu entwickeln und zu einer Wichtigen und er-
freulichen Angelegenheit zu machen? Er war gebun-
den durch Befehl, durch Ehrfurcht und Tradition.
Er hat doch viel erreicht. Wie er den Anteil des mit
Pesne im Leben und nun immerfort verbundenen
Knobelsdorff an dem Bau klar zu legen begonnen
hat, so hat er im Innern auf Grund der Arch'ivalien, auf
Grund glücklicher Funde von Zeichnungen sowohl von
den Eosanderschen Räumen, wie von den letzten für
die Königin Witwe Sophie Dorothee erbauten Kammern
Wichtiges in den ursprünglichen oder wenigstens in
einen erträglichen Zustand zu versetzen versucht.
Wir stehen in der Mitte des Wartenbergschen
Baues von 1703, der von 1711 an, also noch unter
Friedrich I. für seine Schwiegertochter, die zukünftige
Mutter Friedrichs des Großen, eingerichtet wurde. Noch
am Ausgang des 18. Jahrhunderts waren die dunklen
Eichenholz-Boiserien unter einem weißen Anstrich ver-
schwunden. Im 19. Jahrhundert waren Spiegel, Tapeten
und Bilder zersprungen, zerfetzt und verschleppt.
Seidel griff ein und begann unter Zugrundelegung der
Schlichtingschen Zeichnungen von 1725 zu rekonstruie-
ren. Heute grüßt den Verewigten der durch ihn er-
neuerte Mittelraum, grüßen ihn von den Wänden die
zehn Kinder Friedrich Wilhelms und Sophie Dorotheens,
grüßt darunter ihn als erster sein Friedrich. Ich
glaube, wir dürfen mit ihnen zusammen Dank sagen und
aussprechen, ohne uns einer Fälschung schuldig zu
machen: de hoc mortuo nihil nisi bene. Möge Paul
Seidel die Erde seiner geliebten zweiten Heimat, die
Erde Potsdams, leicht sein.
Johann Heinrich
Tischbein d. Ä.
Bildnis des Prinzen
von Weimar
Internationales
Kunst- und Auktionshaus
in
Berlin
175
für die Güte dieser Studie konnte es geben als die
Tatsache, daß in „Le Correspondant“ vom März 1929
Pierre du Colombier am Schlüsse seines Aufsatzes:
„Antoine Pesne, premier peintre des rois de Prusse“,
sagt, daß wir fast alle unsere Kenntnisse über Pesne
Paul Seidel verdanken, daß er Seidels Feststellung von
der Entwicklung des Malers über einen italienischen zu
einem französischen und weiter zu einem eigenen, sagen
wir einmal etwas gewagt: preußischen Stil sich
zu eigen macht.
Und nun Monbijou: Wer dachte vor Seidel an die
verwickelte Baugeschichte dieses Schlosses, wer
dachte daran, seine drei Stile verkörpernden, im Laufe
der Zeiten leider mehr und mehr verdorbenen wunder-
vollen Räume wieder herzustellen? Hat nicht Seidel
zumindest versucht, auch das Museum in diesem
Schlosse zu entwickeln und zu einer Wichtigen und er-
freulichen Angelegenheit zu machen? Er war gebun-
den durch Befehl, durch Ehrfurcht und Tradition.
Er hat doch viel erreicht. Wie er den Anteil des mit
Pesne im Leben und nun immerfort verbundenen
Knobelsdorff an dem Bau klar zu legen begonnen
hat, so hat er im Innern auf Grund der Arch'ivalien, auf
Grund glücklicher Funde von Zeichnungen sowohl von
den Eosanderschen Räumen, wie von den letzten für
die Königin Witwe Sophie Dorothee erbauten Kammern
Wichtiges in den ursprünglichen oder wenigstens in
einen erträglichen Zustand zu versetzen versucht.
Wir stehen in der Mitte des Wartenbergschen
Baues von 1703, der von 1711 an, also noch unter
Friedrich I. für seine Schwiegertochter, die zukünftige
Mutter Friedrichs des Großen, eingerichtet wurde. Noch
am Ausgang des 18. Jahrhunderts waren die dunklen
Eichenholz-Boiserien unter einem weißen Anstrich ver-
schwunden. Im 19. Jahrhundert waren Spiegel, Tapeten
und Bilder zersprungen, zerfetzt und verschleppt.
Seidel griff ein und begann unter Zugrundelegung der
Schlichtingschen Zeichnungen von 1725 zu rekonstruie-
ren. Heute grüßt den Verewigten der durch ihn er-
neuerte Mittelraum, grüßen ihn von den Wänden die
zehn Kinder Friedrich Wilhelms und Sophie Dorotheens,
grüßt darunter ihn als erster sein Friedrich. Ich
glaube, wir dürfen mit ihnen zusammen Dank sagen und
aussprechen, ohne uns einer Fälschung schuldig zu
machen: de hoc mortuo nihil nisi bene. Möge Paul
Seidel die Erde seiner geliebten zweiten Heimat, die
Erde Potsdams, leicht sein.
Johann Heinrich
Tischbein d. Ä.
Bildnis des Prinzen
von Weimar
Internationales
Kunst- und Auktionshaus
in
Berlin
175