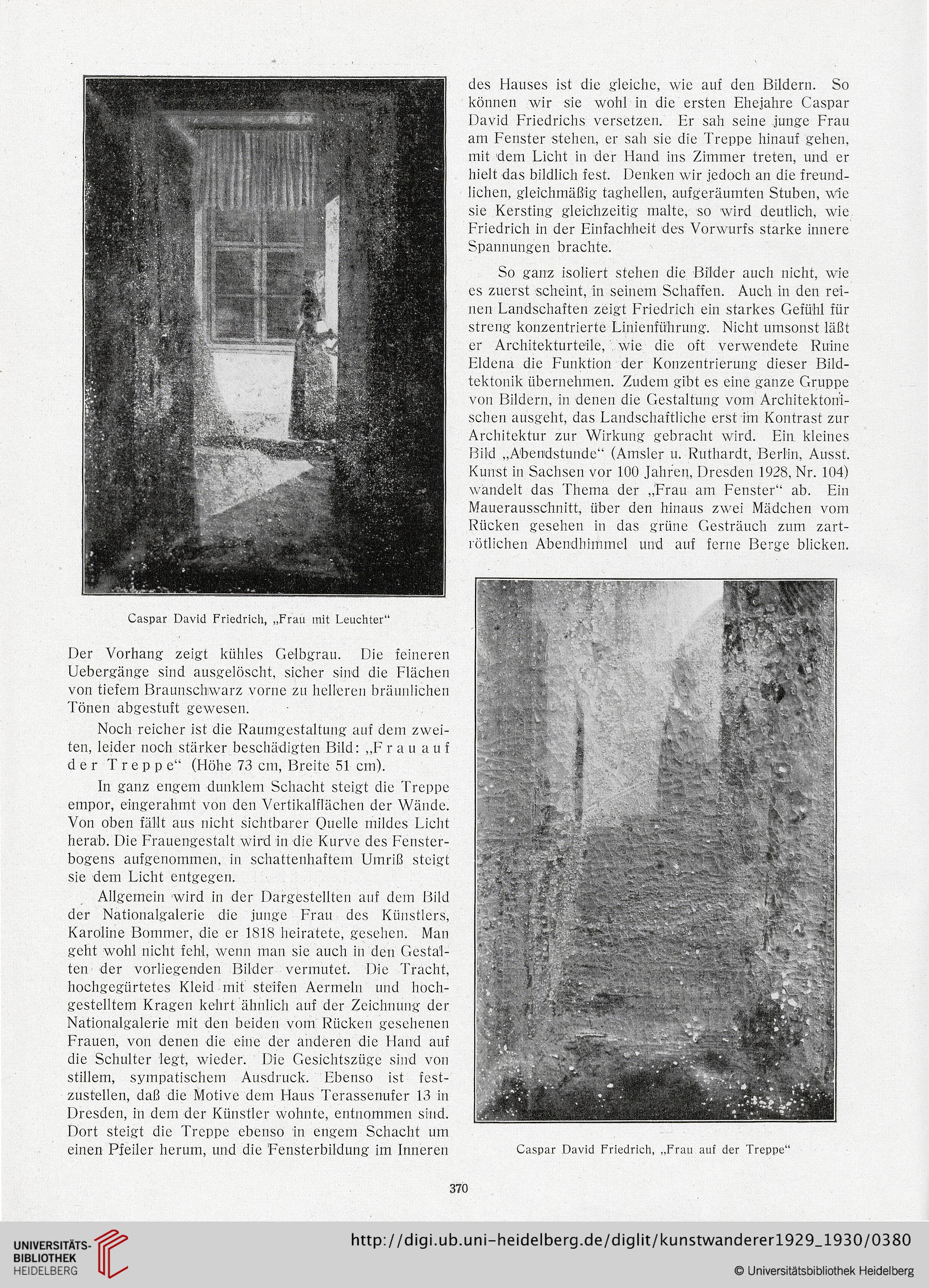Caspar David Friedrich, „Frau mit Leuchter“
Der Vorhang zeigt kühles Gelbgrau. Die feineren
Uebergänge sind ausgelöscht, sicher sind die Flächen
von tiefem Braunschwarz vorne zu helleren bräunlichen
Tönen abgestuft gewesen.
Noch reicher ist die Raumgestaltung auf dem zwei-
ten, leider noch stärker beschädigten Bild: „F r a u a u f
der Treppe“ (Höhe 73 cm, Breite 51 cm).
In ganz engem dunklem Schacht steigt die Treppe
empor, eingerahmt von den Vertikalflächen der Wände.
Von oben fällt aus nicht sichtbarer Quelle mildes Licht
herab. Die Frauengestalt wird in die Kurve des Fenster-
bogens aufgenommen, iu schattenhaftem Umriß steigt
sie dem Licht entgegen.
Allgemein wird in der Dargestellten auf dem Bild
der Nationalgalerie die junge Frau des Künstlers,
Karoline Bommer, die er 1818 heiratete, gesehen. Man
geht wohl nicht fehl, wenn man sie auch in den Gestal-
ten der vorliegenden Bilder vermutet. Die Tracht,
hochgegürtetes Kleid mit steifen Aermeln und hoch-
gestelltem Kragen kehrt ähnlich auf der Zeichnung der
Nationalgalerie mit den beiden vorn Rücken gesehenen
Frauen, von denen die eine der anderen die Hand auf
die Schulter legt, wieder. Die Gesichtszüge sind von
stillem, sympatischem Ausdruck. Ebenso ist fest-
zustellen, daß die Motive dem Haus Terassenufer 13 in
Dresden, in dem der Künstler wohnte, entnommen sind.
Dort steigt die Treppe ebenso in engem Schacht um
einen Pfeiler herum, und die Fensterbildung im Inneren
des Hauses ist die gleiche, wie auf den Bildern. So
können wir sie wohl in die ersten Ehejahre Caspar
David Friedrichs versetzen. Er sah seine junge Frau
am Fenster stehen, er sah sie die Treppe hinauf gehen,
mit dem Licht in der Hand ins Zimmer treten, und er
hielt das bildlich fest. Denken wir jedoch an die freund-
lichen, gleichmäßig taghellen, aufgeräumten Stuben, wie
sie Kersting gleichzeitig malte, so wird deutlich, wie
Friedrich in der Einfachheit des Vorwurfs starke innere
Spannungen brachte.
So ganz isoliert stehen die Bilder auch nicht, wie
es zuerst scheint, in seinem Schaffen. Auch in den rei-
nen Landschaften zeigt Friedrich ein starkes Gefühl für
streng konzentrierte Linienführung. Nicht umsonst läßt
er Architekturteile, wie die oft verwendete Ruine
Eldena die Funktion der Konzentrierung dieser Bild-
tektonik übernehmen. Zudem gibt es eine ganze Gruppe
von Bildern, in denen die Gestaltung vom Architektoni-
schen ausgeht, das Landschaftliche erst im Kontrast zur
Architektur zur Wirkung gebracht wird. Ein. kleines
Bild „Abendstunde“ (Amsler u. Ruthardt, Berlin, Ausst.
Kunst in Sachsen vor 100 Jahren, Dresden 1928, Nr. 104)
wandelt das Thema der „Frau am Fenster“ ab. Ein
Mauerausschnitt, über den hinaus zwei Mädchen vom
Rücken gesehen in das grüne Gesträuch zum zart-
rötlichen Abendhimmel und auf ferne Berge blicken.
Caspar David Friedrich, „Frau auf der Treppe“
370
Der Vorhang zeigt kühles Gelbgrau. Die feineren
Uebergänge sind ausgelöscht, sicher sind die Flächen
von tiefem Braunschwarz vorne zu helleren bräunlichen
Tönen abgestuft gewesen.
Noch reicher ist die Raumgestaltung auf dem zwei-
ten, leider noch stärker beschädigten Bild: „F r a u a u f
der Treppe“ (Höhe 73 cm, Breite 51 cm).
In ganz engem dunklem Schacht steigt die Treppe
empor, eingerahmt von den Vertikalflächen der Wände.
Von oben fällt aus nicht sichtbarer Quelle mildes Licht
herab. Die Frauengestalt wird in die Kurve des Fenster-
bogens aufgenommen, iu schattenhaftem Umriß steigt
sie dem Licht entgegen.
Allgemein wird in der Dargestellten auf dem Bild
der Nationalgalerie die junge Frau des Künstlers,
Karoline Bommer, die er 1818 heiratete, gesehen. Man
geht wohl nicht fehl, wenn man sie auch in den Gestal-
ten der vorliegenden Bilder vermutet. Die Tracht,
hochgegürtetes Kleid mit steifen Aermeln und hoch-
gestelltem Kragen kehrt ähnlich auf der Zeichnung der
Nationalgalerie mit den beiden vorn Rücken gesehenen
Frauen, von denen die eine der anderen die Hand auf
die Schulter legt, wieder. Die Gesichtszüge sind von
stillem, sympatischem Ausdruck. Ebenso ist fest-
zustellen, daß die Motive dem Haus Terassenufer 13 in
Dresden, in dem der Künstler wohnte, entnommen sind.
Dort steigt die Treppe ebenso in engem Schacht um
einen Pfeiler herum, und die Fensterbildung im Inneren
des Hauses ist die gleiche, wie auf den Bildern. So
können wir sie wohl in die ersten Ehejahre Caspar
David Friedrichs versetzen. Er sah seine junge Frau
am Fenster stehen, er sah sie die Treppe hinauf gehen,
mit dem Licht in der Hand ins Zimmer treten, und er
hielt das bildlich fest. Denken wir jedoch an die freund-
lichen, gleichmäßig taghellen, aufgeräumten Stuben, wie
sie Kersting gleichzeitig malte, so wird deutlich, wie
Friedrich in der Einfachheit des Vorwurfs starke innere
Spannungen brachte.
So ganz isoliert stehen die Bilder auch nicht, wie
es zuerst scheint, in seinem Schaffen. Auch in den rei-
nen Landschaften zeigt Friedrich ein starkes Gefühl für
streng konzentrierte Linienführung. Nicht umsonst läßt
er Architekturteile, wie die oft verwendete Ruine
Eldena die Funktion der Konzentrierung dieser Bild-
tektonik übernehmen. Zudem gibt es eine ganze Gruppe
von Bildern, in denen die Gestaltung vom Architektoni-
schen ausgeht, das Landschaftliche erst im Kontrast zur
Architektur zur Wirkung gebracht wird. Ein. kleines
Bild „Abendstunde“ (Amsler u. Ruthardt, Berlin, Ausst.
Kunst in Sachsen vor 100 Jahren, Dresden 1928, Nr. 104)
wandelt das Thema der „Frau am Fenster“ ab. Ein
Mauerausschnitt, über den hinaus zwei Mädchen vom
Rücken gesehen in das grüne Gesträuch zum zart-
rötlichen Abendhimmel und auf ferne Berge blicken.
Caspar David Friedrich, „Frau auf der Treppe“
370