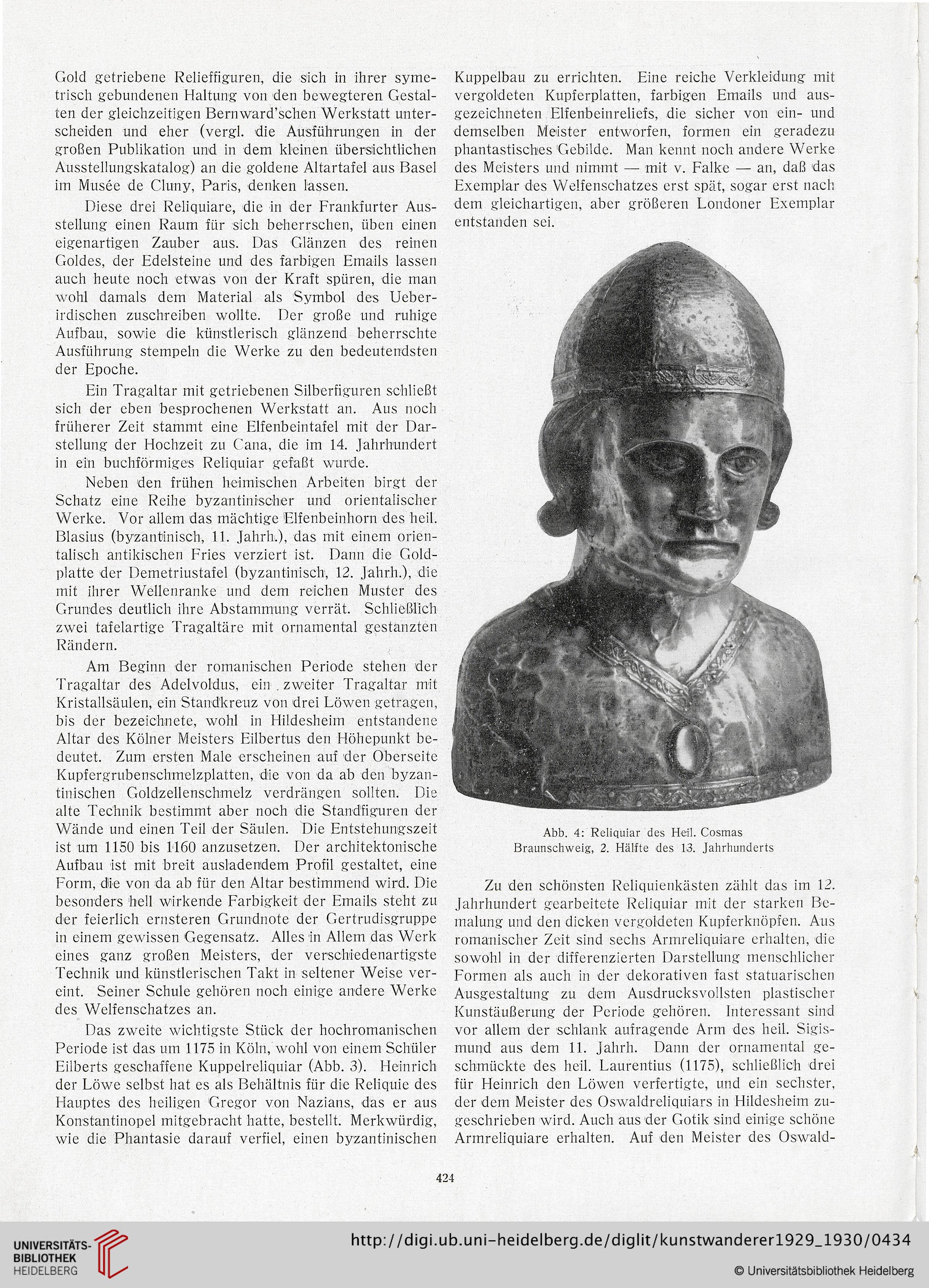Gold getriebene Relieffiguren, die sich in ihrer syme-
trisch gebundenen Haltung von den bewegteren Gestal-
ten der gleichzeitigen Bernward’schen Werkstatt unter-
scheiden und eher (vergl. die Ausführungen in der
großen Publikation und in dem kleinen übersichtlichen
Ausstellungskatalog) an die goldene Altartafel aus Basel
im Musee de Cluny, Paris, denken lassen.
Diese drei Reliquiare, die in der Frankfurter Aus-
stellung einen Raum für sich beherrschen, üben einen
eigenartigen Zauber aus. Das Glänzen des reinen
Goldes, der Edelsteine und des farbigen Emails lassen
auch heute noch etwas von der Kraft spüren, die man
wohl damals dem Material als Symbol des Ueber-
irdischen zuschreiben wollte. Der große und ruhige
Aufbau, sowie die künstlerisch glänzend beherrschte
Ausführung stempeln die Werke zu den bedeutendsten
der Epoche.
Ein Tragaltar mit getriebenen Silberfiguren schließt
sich der eben besprochenen Werkstatt an. Aus noch
früherer Zeit stammt eine Elfenbeintafel mit der Dar-
stellung der Hochzeit zu Cana, die im 14. Jahrhundert
in ein buchförmiges Reliquiar gefaßt wurde.
Neben den frühen heimischen Arbeiten birgt der
Schatz eine Reihe byzantinischer und orientalischer
Werke. Vor allem das mächtige Elfenbeinhorn des heil.
Blasius (byzantinisch, 11. Jahrh.), das mit einem orien-
talisch antikischen Fries verziert ist. Dann die Gold-
platte der Demetriustafel (byzantinisch, 12. Jahrh.), die
mit ihrer Wellenranke und dem reichen Muster des
Grundes deutlich ihre Abstammung verrät. Schließlich
zwei tafelartigc Tragaltäre mit ornamental gestanzten
Rändern.
Am Beginn der romanischen Periode stehen der
Tragaltar des Adelvoldus, ein . zweiter Tragaltar mit
Kristallsäulen, ein Standkreuz von drei Löwen getragen,
bis der bezeichnete, wohl in Hildesheim entstandene
Altar des Kölner Meisters Eilbertus den Höhepunkt be-
deutet. Zum ersten Male erscheinen auf der Oberseite
Kupfergrubenschmelzplatten, die von da ab den byzan-
tinischen Goldzellenschmelz verdrängen sollten. Die
alte Technik bestimmt aber noch die Standfiguren der
Wände und einen Teil der Säulen. Die Entstehungszeit
ist um 1150 bis 1160 anzusetzen. Der architektonische
Aufbau ist mit breit ausladendem Profil gestaltet, eine
Form, dlie von da ab für den Altar bestimmend wird. Die
besonders hell wirkende Farbigkeit der Emails steht zu
der feierlich ernsteren Grundnote der Gertrudisgruppe
in einem gewissen Gegensatz. Alles in Allem das Werk
eines ganz großen Meisters, der verschiedenartigste
Technik und künstlerischen Takt in seltener Weise ver-
eint. Seiner Schule gehören noch einige andere Werke
des Weifenschatzes an.
Das zweite wichtigste Stück der hochromanischen
Periode ist das um 1175 in Köln, wohl von einem Schüler
Eilberts geschaffene Kuppclreliquiar (Abb. 3). Heinrich
der Löwe selbst hat es als Behältnis für die Reliquie des
Hauptes des heiligen Gregor von Nazians, das er aus
Konstantinopel mitgebracht hatte, bestellt. Merkwürdig,
wie die Phantasie darauf verfiel, einen byzantinischen
Kuppelbau zu errichten. Eine reiche Verkleidung mit
vergoldeten Kupferplatten, farbigen Emails und aus-
gezeichneten Elfenbeinreliefs, die sicher von ein- und
demselben Meister entworfen, formen ein geradezu
phantastisches Gebilde. Man kennt noch andere Werke
des Meisters und nimmt — mit v. Falke — an, daß das
Exemplar des Weifenschatzes erst spät, sogar erst nach
dem gleichartigen, aber größeren Londoner Exemplar
entstanden sei.
Abb. 4: Reliquiar des Heil. Cosmas
Braunschweig, 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts
Zu den schönsten Reliquienkästen zählt das im 12.
Jahrhundert gearbeitete Reliquiar mit der starken Be-
malung und den dicken vergoldeten Kupferknöpfen. Aus
romanischer Zeit sind sechs Armreliquiare erhalten, die
sowohl in der differenzierten Darstellung menschlicher
Formen als auch in der dekorativen fast statuarischen
Ausgestaltung zu dem Ausdrucksvollsten plastischer
Kunstäußerung der Periode gehören. Interessant sind
vor allem der schlank aufragende Arm des heil. Sigis-
mund aus dem 11. Jahrh. Dann der ornamental ge-
schmückte des heil. Laurentius (1175), schließlich drei
für Heinrich den Löwen verfertigte, und ein sechster,
der dem Meister des Oswaldreliquiars in Hildesheim zu-
geschrieben wird. Auch aus der Gotik sind einige schöne
Armreliquiare erhalten. Auf den Meister des Oswald-
424
trisch gebundenen Haltung von den bewegteren Gestal-
ten der gleichzeitigen Bernward’schen Werkstatt unter-
scheiden und eher (vergl. die Ausführungen in der
großen Publikation und in dem kleinen übersichtlichen
Ausstellungskatalog) an die goldene Altartafel aus Basel
im Musee de Cluny, Paris, denken lassen.
Diese drei Reliquiare, die in der Frankfurter Aus-
stellung einen Raum für sich beherrschen, üben einen
eigenartigen Zauber aus. Das Glänzen des reinen
Goldes, der Edelsteine und des farbigen Emails lassen
auch heute noch etwas von der Kraft spüren, die man
wohl damals dem Material als Symbol des Ueber-
irdischen zuschreiben wollte. Der große und ruhige
Aufbau, sowie die künstlerisch glänzend beherrschte
Ausführung stempeln die Werke zu den bedeutendsten
der Epoche.
Ein Tragaltar mit getriebenen Silberfiguren schließt
sich der eben besprochenen Werkstatt an. Aus noch
früherer Zeit stammt eine Elfenbeintafel mit der Dar-
stellung der Hochzeit zu Cana, die im 14. Jahrhundert
in ein buchförmiges Reliquiar gefaßt wurde.
Neben den frühen heimischen Arbeiten birgt der
Schatz eine Reihe byzantinischer und orientalischer
Werke. Vor allem das mächtige Elfenbeinhorn des heil.
Blasius (byzantinisch, 11. Jahrh.), das mit einem orien-
talisch antikischen Fries verziert ist. Dann die Gold-
platte der Demetriustafel (byzantinisch, 12. Jahrh.), die
mit ihrer Wellenranke und dem reichen Muster des
Grundes deutlich ihre Abstammung verrät. Schließlich
zwei tafelartigc Tragaltäre mit ornamental gestanzten
Rändern.
Am Beginn der romanischen Periode stehen der
Tragaltar des Adelvoldus, ein . zweiter Tragaltar mit
Kristallsäulen, ein Standkreuz von drei Löwen getragen,
bis der bezeichnete, wohl in Hildesheim entstandene
Altar des Kölner Meisters Eilbertus den Höhepunkt be-
deutet. Zum ersten Male erscheinen auf der Oberseite
Kupfergrubenschmelzplatten, die von da ab den byzan-
tinischen Goldzellenschmelz verdrängen sollten. Die
alte Technik bestimmt aber noch die Standfiguren der
Wände und einen Teil der Säulen. Die Entstehungszeit
ist um 1150 bis 1160 anzusetzen. Der architektonische
Aufbau ist mit breit ausladendem Profil gestaltet, eine
Form, dlie von da ab für den Altar bestimmend wird. Die
besonders hell wirkende Farbigkeit der Emails steht zu
der feierlich ernsteren Grundnote der Gertrudisgruppe
in einem gewissen Gegensatz. Alles in Allem das Werk
eines ganz großen Meisters, der verschiedenartigste
Technik und künstlerischen Takt in seltener Weise ver-
eint. Seiner Schule gehören noch einige andere Werke
des Weifenschatzes an.
Das zweite wichtigste Stück der hochromanischen
Periode ist das um 1175 in Köln, wohl von einem Schüler
Eilberts geschaffene Kuppclreliquiar (Abb. 3). Heinrich
der Löwe selbst hat es als Behältnis für die Reliquie des
Hauptes des heiligen Gregor von Nazians, das er aus
Konstantinopel mitgebracht hatte, bestellt. Merkwürdig,
wie die Phantasie darauf verfiel, einen byzantinischen
Kuppelbau zu errichten. Eine reiche Verkleidung mit
vergoldeten Kupferplatten, farbigen Emails und aus-
gezeichneten Elfenbeinreliefs, die sicher von ein- und
demselben Meister entworfen, formen ein geradezu
phantastisches Gebilde. Man kennt noch andere Werke
des Meisters und nimmt — mit v. Falke — an, daß das
Exemplar des Weifenschatzes erst spät, sogar erst nach
dem gleichartigen, aber größeren Londoner Exemplar
entstanden sei.
Abb. 4: Reliquiar des Heil. Cosmas
Braunschweig, 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts
Zu den schönsten Reliquienkästen zählt das im 12.
Jahrhundert gearbeitete Reliquiar mit der starken Be-
malung und den dicken vergoldeten Kupferknöpfen. Aus
romanischer Zeit sind sechs Armreliquiare erhalten, die
sowohl in der differenzierten Darstellung menschlicher
Formen als auch in der dekorativen fast statuarischen
Ausgestaltung zu dem Ausdrucksvollsten plastischer
Kunstäußerung der Periode gehören. Interessant sind
vor allem der schlank aufragende Arm des heil. Sigis-
mund aus dem 11. Jahrh. Dann der ornamental ge-
schmückte des heil. Laurentius (1175), schließlich drei
für Heinrich den Löwen verfertigte, und ein sechster,
der dem Meister des Oswaldreliquiars in Hildesheim zu-
geschrieben wird. Auch aus der Gotik sind einige schöne
Armreliquiare erhalten. Auf den Meister des Oswald-
424