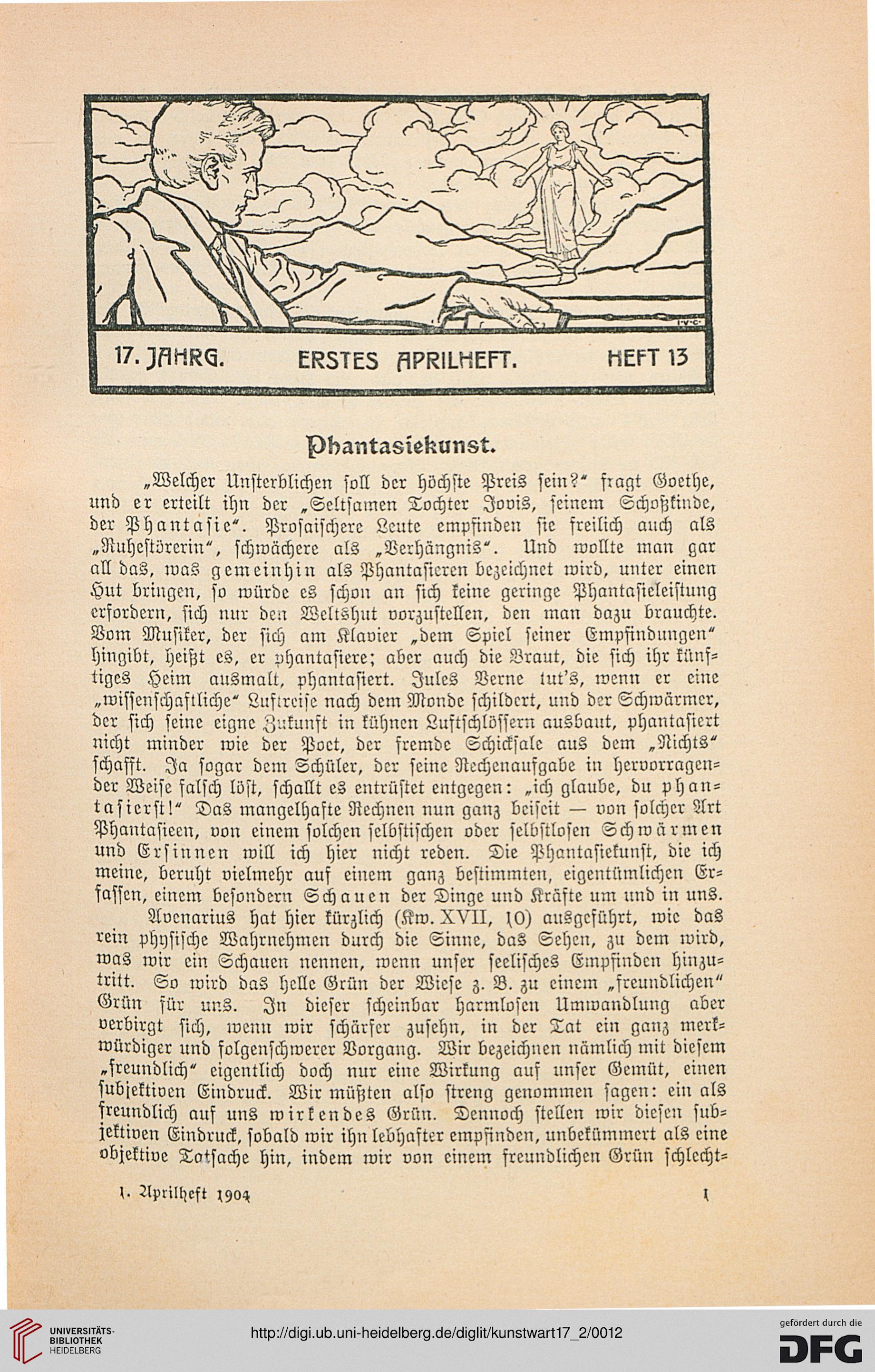17. DMH.
?k?5ie5
-I1Z 8
L,V..'.z....-.^
^kLntasiekunst.
„Welcher Unsterblichen soll der höchste Preis sein?" fragt Goethe,
und er erteilt ihn der „Seltsamen Tochter Jovis, seinem Schoßkiiide,
der Phantasie". Prosaischere Leute empfinden sie freilich auch als
„Ruhestörerin", schwächere als „Verhängnis". Und wollte man gar
all das, was gemcinhin als Phantasicren bezcichnct wird, unter einen
Hut Lringen, so würde es schon an sich keine geringe Phantasieleistung
crfordern, sich nur den Weltshut vorzustellen, den man dazu brauchte.
Vom Musiker, der sich am Klavier „dem Spiel seiner Empfindungen"
hingibt, heißt es, er phantasiere; aber auch die Braut, die sich ihr künf-
tiges Heim ausmalt, phantasiert. Jules Verne tut's, wenn er eine
„wissenschaslliche" Luflreise nach dem Mondc schildcrt, und der Schwürmer,
der sich seine eignc Zukunft in kühnen Luftschlössern ausbaut, phantasiert
nicht minder wie der Poet, der fremde Schicksale aus dem „Nichts"'
schasit. Ja sogar dcm Schüler, der seine Nechenaufgabe in hervorragen-
der Weise falsch lvst, schallt es entrüstet entgegcn: „ich glaube, du phan-
tasierst!" Das mangelhafte Rechnen nun ganz bciseit — von solcher Art
Phantasieen, von einem solchen selbstischen oder selbstloscn Schwärmen
und Ersinnen will ich hier nicht reden. Die Phantasiekunst, die ich
meine, beruht vielmehr auf einem ganz bestimmten, eigentümlichcn Er-
fafsen, einem besondern Schauen der Dinge und Krüfte um und in uns.
Avenarius hat hier kürzlich (Kw. XVII, (0) ausgcführt, wic das
rein phrsiische Wahrnehmen durch die Sinne, das Sehen, zu dem wird,
was wir ein Schauen nennen, wenn unser seclisches Empfinden hinzu-
tritt. So wird das hclle Grün der Wiese z. B. zu einem „freundlichen"
Grün für uns. Jn dicser scheinbar harmlosen Umwandlung aber
verbirgt sich, wenn wir schärfcr zusehn, in der Tat ein ganz merk-
würdiger und folgenschwercr Vorgang. Wir bezeichnen nümlich mit dicsem
„freundlich" eigentlich doch nur eiuc Wirkung auf unscr Gemüt, einen
fubjektiven Eindruck. Wir müßten also streng genommen sagen: ein als
freundlich auf uns wirkendes Grüu. Dennoch stellen wir diesen sub-
jektiven Eindruck, sobald wir ihn leühafter empfinden, unbckümmcrt als eine
objektive Totsache hin, indem wir von cinem freundlichen Grün schlecht-
t- Aprilheft zg04 t
?k?5ie5
-I1Z 8
L,V..'.z....-.^
^kLntasiekunst.
„Welcher Unsterblichen soll der höchste Preis sein?" fragt Goethe,
und er erteilt ihn der „Seltsamen Tochter Jovis, seinem Schoßkiiide,
der Phantasie". Prosaischere Leute empfinden sie freilich auch als
„Ruhestörerin", schwächere als „Verhängnis". Und wollte man gar
all das, was gemcinhin als Phantasicren bezcichnct wird, unter einen
Hut Lringen, so würde es schon an sich keine geringe Phantasieleistung
crfordern, sich nur den Weltshut vorzustellen, den man dazu brauchte.
Vom Musiker, der sich am Klavier „dem Spiel seiner Empfindungen"
hingibt, heißt es, er phantasiere; aber auch die Braut, die sich ihr künf-
tiges Heim ausmalt, phantasiert. Jules Verne tut's, wenn er eine
„wissenschaslliche" Luflreise nach dem Mondc schildcrt, und der Schwürmer,
der sich seine eignc Zukunft in kühnen Luftschlössern ausbaut, phantasiert
nicht minder wie der Poet, der fremde Schicksale aus dem „Nichts"'
schasit. Ja sogar dcm Schüler, der seine Nechenaufgabe in hervorragen-
der Weise falsch lvst, schallt es entrüstet entgegcn: „ich glaube, du phan-
tasierst!" Das mangelhafte Rechnen nun ganz bciseit — von solcher Art
Phantasieen, von einem solchen selbstischen oder selbstloscn Schwärmen
und Ersinnen will ich hier nicht reden. Die Phantasiekunst, die ich
meine, beruht vielmehr auf einem ganz bestimmten, eigentümlichcn Er-
fafsen, einem besondern Schauen der Dinge und Krüfte um und in uns.
Avenarius hat hier kürzlich (Kw. XVII, (0) ausgcführt, wic das
rein phrsiische Wahrnehmen durch die Sinne, das Sehen, zu dem wird,
was wir ein Schauen nennen, wenn unser seclisches Empfinden hinzu-
tritt. So wird das hclle Grün der Wiese z. B. zu einem „freundlichen"
Grün für uns. Jn dicser scheinbar harmlosen Umwandlung aber
verbirgt sich, wenn wir schärfcr zusehn, in der Tat ein ganz merk-
würdiger und folgenschwercr Vorgang. Wir bezeichnen nümlich mit dicsem
„freundlich" eigentlich doch nur eiuc Wirkung auf unscr Gemüt, einen
fubjektiven Eindruck. Wir müßten also streng genommen sagen: ein als
freundlich auf uns wirkendes Grüu. Dennoch stellen wir diesen sub-
jektiven Eindruck, sobald wir ihn leühafter empfinden, unbckümmcrt als eine
objektive Totsache hin, indem wir von cinem freundlichen Grün schlecht-
t- Aprilheft zg04 t