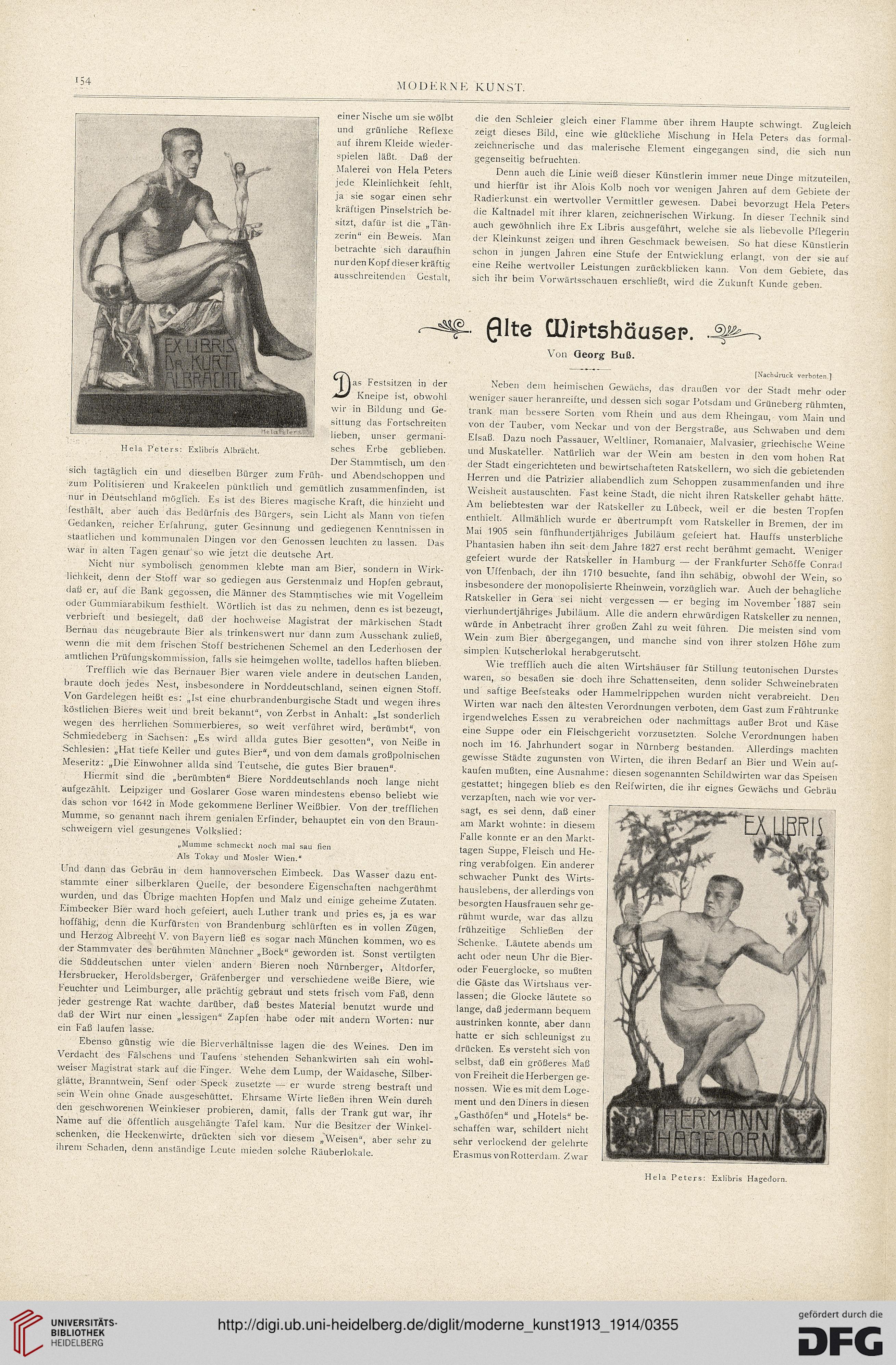154
MODER N E KUNST.
1 Jas Festsitzen iij der
Kneipe ist, obwohl
wir in Bildung und Ge-
sittung das Fortschreiten
lieben, unser germani-
Hcla Peters: Exlibris Albrächt. sches Erbe geblieben.
Der Stammtisch, um den
sich tagtäglich ein und dieselben Bürger zum Früh- und Abendschoppen und
zum Politisieren und Krakeelen pünktlich und gemütlich zusammenfinden, ist
nur in Deutschland möglich. Es ist des Bieres magische Kraft, die hinzieht und
festhält, aber auch das Bedürfnis des Bürgers, sein Licht als Mann von tiefen
Gedanken, reicher Erfahrung, guter Gesinnung und gediegenen Kenntnissen in
staatlichen und kommunalen Dingen vor den Genossen leuchten zu lassen. Das
war in alten Tagen genau'so wie jetzt die deutsche Art.
Nicht nur symbolisch genommen klebte man am Bier, sondern in Wirk-
lichkeit, denn der Stoff war so gediegen aus Gerstenmalz und Hopfen gebraut,
daß er, auf die Bank gegossen, die Männer des Stammtisches wie mit Vogelleim
oder Gummiarabikum festhielt. Wörtlich ist das zu nehmen, denn es ist bezeugt,
verbrieft und besiegelt, daß der hochweise Magistrat der märkischen Stadt
Bernau das neugebraute Bier als trinkenswert nur dann zum Ausschank zuließ,
wenn die mit dem frischen Stoff bestrichenen Schemel an den Lederhosen der
amtlichen Prüfungskommission, falls sie heimgehen wollte, tadellos haften blieben.
Trefflich wie das Bernauer Bier waren viele andere in deutschen Landen,
braute doch jedes Nest, insbesondere in Norddeutschland, seinen eignen Stoff.
Von Gardelegen heißt es: „Ist eine churbrandenburgische Stadt und wegen ihres
köstlichen Bieres weit und breit bekannt“, von Zerbst in Anhalt: „Ist sonderlich
wegen des herrlichen Sommerbieres, so weit verführet wird, berümbt“, von
Schmiedeberg in Sachsen: „Es wird allda gutes Bier gesotten“, von Neiße in
Schlesien: „Hat tiefe Keller und gutes Bier“, und von dem damals großpolnischen
Meseritz: „Die Einwohner allda sind Teutsche, die gutes Bier brauen“.
Hiermit sind die „berümbten“ Biere Norddeutschlands noch lange nicht
aufgezählt. Leipziger und Goslarer Gose waren mindestens ebenso beliebt wie
das schon vor 1642 in Mode gekommene Berliner Weißbier. Von der trefflichen
Mumme, so genannt nach ihrem genialen Erfinder, behauptet ein von den Braun-
schweigern viel gesungenes Volkslied:
einer Nische um sie wölbt
und grünliche Reflexe
auf ihrem Kleide wieder-
spielen läßt. Daß der
Malerei von Heia Peters
jede Kleinlichkeit fehlt,
ja sie sogar einen sehr
kräftigen Pinselstrich be-
sitzt, dafür ist die „Tän-
zerin“ ein Beweis. Man
betrachte sich daraufhin
nur den Kopf dieser kräftig
ausschreitenden Gestalt,
„Mumme schmeckt noch mal sau fien
Als Tokay und Mosler Wien.“
Und dann das Gebräu in dem hannoverschen Eimbeck. Das Wasser dazu ent-
stammte einer silberklaren Quelle, der besondere Eigenschaften nachgerühmt
wurden, und das Übrige machten Hopfen und Malz und einige geheime Zutaten.
Eimbecker Bier ward hoch gefeiert, auch Luther trank und pries es, ja es war
hoffähig, denn die Kurfürsten von Brandenburg schlürften es in vollen Zügen,
und Herzog Albrecht V. von Bayern ließ es sogar nach München kommen, wo es
der Stammvater des berühmten Münchner „Bock“ geworden ist. Sonst vertilgten
die Süddeutschen unter vielen andern Bieren noch Nürnberger, Altdorfer,
Hersbrucker, Heroldsberger, Gräfenberger und verschiedene weiße Biere, wie
Feuchter und Leimburger, alle prächtig gebraut und stets frisch vom Faß, denn
jeder gestrenge Rat wachte darüber, daß bestes Material benutzt wurde und
daß der Wirt nur einen „lessigen“ Zapfen habe oder mit andern Worten: nur
ein Faß laufen lasse.
Ebenso günstig wie die Bierverhältnisse lagen die des Weines. Den im
Verdacht des Fälschens und Taufens stehenden Schankwirten sah ein wohl-
weiser Magistrat stark auf die Finger. Wehe dem Lump, der Waidasche, Silber-
glätte, Branntwein, Senf oder Speck zusetzte — er wurde streng bestraft und
sein Wein ohne Gnade ausgeschüttet. Ehrsame Wirte ließen ihren Wein durch
den geschworenen Weinkieser probieren, damit, falls der Trank gut war, ihr
Name auf die öffentlich ausgehängte Tafel kam. Nur die Besitzer der Winkel-
schenken, die Heckenwirte, drückten sich vor diesem „Weisen“, aber sehr zu
ihrem Schaden, denn anständige Leute mieden solche Räuberlokale.
die den Schleier gleich einer Flamme über ihrem Haupte schwingt. Zugleich
zeigt dieses Bild, eine wie glückliche Mischung in Heia Peters das formal-
zeichnerische und das malerische Element eingegangen sind, die sich nun
gegenseitig befruchten.
Denn auch die Linie weiß dieser Künstlerin immer neue Dinge mitzuteilen,
und hierfür ist ihr Alois Kolb noch vor wenigen Jahren auf dem Gebiete der
Radierkunst ein wertvoller Vermittler gewesen. Dabei bevorzugt Heia Peters
die Kaltnadel mit ihrer klaren, zeichnerischen Wirkung. In dieser Technik sind
auch gewöhnlich ihre Ex Libris ausgeführt, welche sie als liebevolle Pflegerin
der Kleinkunst zeigen und ihren Geschmack beweisen. So hat diese Künstlerin
schon in jungen Jahren eine Stufe der Entwicklung erlangt, von der sie auf
eine Reihe wertvoller Leistungen zurückblicken kann. Von dem Gebiete, das
sich ihr beim Vorwärtsschauen erschließt, wird die Zukunft Kunde geben.
@lte CDiptshäusep.
Von Georg Buß.
~~ [Nachdruck verboten.]
Neben dem heimischen Gewächs, das draußen vor der Stadt mehr oder
weniger sauer heranreifte, und dessen sich sogar Potsdam und Grüneberg rühmten,
trank man bessere Sorten vom Rhein und aus dem Rheingau, vom Main und
von der Tauber, vom Neckar und von der Bergstraße, aus Schwaben und dem
Elsaß. Dazu noch Passauer, Weltliner, Romanaier, Malvasier, griechische Weine
und Muskateller. Natürlich war der Wein am besten in den vom hohen Rat
der Stadt eingerichteten und bewirtschafteten Ratskellern, wo sich die gebietenden
Herren und die Patrizier allabendlich zum Schoppen zusammenfanden und ihre
Weisheit austauschten. Fast keine Stadt, die nicht ihren Ratskeller gehabt hätte.
Am beliebtesten war der Ratskeller zu Lübeck, weil er die besten Tropfen
enthielt. Allmählich wurde er übertrumpft vom Ratskeller in Bremen, der im
Mai 1905 sein fünfhundertjähriges Jubiläum gefeiert hat. Hauffs unsterbliche
Phantasien haben ihn seit dem Jahre 1827 erst recht berühmt gemacht. Weniger
gefeiert wurde der Ratskeller in Hamburg — der Frankfurter Schöffe Conrad
von Uffenbach, der ihn 1710 besuchte, fand ihn schäbig, obwohl der Wein, so
insbesondere der monopolisierte Rheinwein, vorzüglich war. Auch der behagliche
Ratskeller in Gera sei nicht vergessen — er beging im November 1887 sein
vierhundertjähriges Jubiläum. Alle die andern ehrwürdigen Ratskeller zu nennen,
würde in Anbetracht ihrer großen Zahl zu weit führen. Die meisten sind vom
Wein zum Bier übergegangen, und manche sind von ihrer stolzen Höhe zum
simplen Kutscherlokal herabgerutscht.
Wie trefflich auch die alten Wirtshäuser für Stillung teutonischen Durstes
waren, so besaßen sie doch ihre Schattenseiten, denn solider Schweinebraten
und saftige Beefsteaks oder Hammelrippchen wurden nicht verabreicht. Den
Wirten war nach den ältesten Verordnungen verboten, dem Gast zum Frühtrunke
irgendwelches Essen zu verabreichen oder nachmittags außer Brot und Käse
eine Suppe oder ein Fleischgericht vorzusetzten. Solche Verordnungen haben
noch im 16. Jahrhundert sogar in Nürnberg bestanden. Allerdings machten
gewisse Städte zugunsten von Wirten, die ihren Bedarf an Bier und Wein auf-
kaufen mußten, eine Ausnahme: diesen sogenannten Schild wirten war das Speisen
gestattet; hingegen blieb es den Reifwirten, die ihr eignes Gewächs und Gebräu
verzapften, nach wie vor ver-
sagt, es sei denn, daß einer
am Markt wohnte: in diesem
Falle konnte er an den Markt-
tagen Suppe, Fleisch und He-
ring verabfolgen. Ein anderer
schwacher Punkt des Wirts-
hauslebens, der allerdings von
besorgten Hausfrauen sehr ge-
rühmt wurde, war das allzu
frühzeitige Schließen der
Schenke. Läutete abends um
acht oder neun Uhr die Bier-
oder Feuerglocke, so mußten
die Gäste das Wirtshaus ver-
lassen; die Glocke läutete so
lange, daß jedermann bequem
austrinken konnte, aber dann
hatte er sich schleunigst zu
drücken. Es versteht sich von
selbst, daß ein größeres Maß
von Freiheit die Herbergen ge-
nossen. Wie es mit dem Loge-
ment und den Diners in diesen
„Gasthöfen“ und „Hotels“ be-
schaffen war, schildert nicht
sehr verlockend der gelehrte
Erasmus von Rotterdam. Zwar
Heia Peters: Exlibris Hagedorn.
MODER N E KUNST.
1 Jas Festsitzen iij der
Kneipe ist, obwohl
wir in Bildung und Ge-
sittung das Fortschreiten
lieben, unser germani-
Hcla Peters: Exlibris Albrächt. sches Erbe geblieben.
Der Stammtisch, um den
sich tagtäglich ein und dieselben Bürger zum Früh- und Abendschoppen und
zum Politisieren und Krakeelen pünktlich und gemütlich zusammenfinden, ist
nur in Deutschland möglich. Es ist des Bieres magische Kraft, die hinzieht und
festhält, aber auch das Bedürfnis des Bürgers, sein Licht als Mann von tiefen
Gedanken, reicher Erfahrung, guter Gesinnung und gediegenen Kenntnissen in
staatlichen und kommunalen Dingen vor den Genossen leuchten zu lassen. Das
war in alten Tagen genau'so wie jetzt die deutsche Art.
Nicht nur symbolisch genommen klebte man am Bier, sondern in Wirk-
lichkeit, denn der Stoff war so gediegen aus Gerstenmalz und Hopfen gebraut,
daß er, auf die Bank gegossen, die Männer des Stammtisches wie mit Vogelleim
oder Gummiarabikum festhielt. Wörtlich ist das zu nehmen, denn es ist bezeugt,
verbrieft und besiegelt, daß der hochweise Magistrat der märkischen Stadt
Bernau das neugebraute Bier als trinkenswert nur dann zum Ausschank zuließ,
wenn die mit dem frischen Stoff bestrichenen Schemel an den Lederhosen der
amtlichen Prüfungskommission, falls sie heimgehen wollte, tadellos haften blieben.
Trefflich wie das Bernauer Bier waren viele andere in deutschen Landen,
braute doch jedes Nest, insbesondere in Norddeutschland, seinen eignen Stoff.
Von Gardelegen heißt es: „Ist eine churbrandenburgische Stadt und wegen ihres
köstlichen Bieres weit und breit bekannt“, von Zerbst in Anhalt: „Ist sonderlich
wegen des herrlichen Sommerbieres, so weit verführet wird, berümbt“, von
Schmiedeberg in Sachsen: „Es wird allda gutes Bier gesotten“, von Neiße in
Schlesien: „Hat tiefe Keller und gutes Bier“, und von dem damals großpolnischen
Meseritz: „Die Einwohner allda sind Teutsche, die gutes Bier brauen“.
Hiermit sind die „berümbten“ Biere Norddeutschlands noch lange nicht
aufgezählt. Leipziger und Goslarer Gose waren mindestens ebenso beliebt wie
das schon vor 1642 in Mode gekommene Berliner Weißbier. Von der trefflichen
Mumme, so genannt nach ihrem genialen Erfinder, behauptet ein von den Braun-
schweigern viel gesungenes Volkslied:
einer Nische um sie wölbt
und grünliche Reflexe
auf ihrem Kleide wieder-
spielen läßt. Daß der
Malerei von Heia Peters
jede Kleinlichkeit fehlt,
ja sie sogar einen sehr
kräftigen Pinselstrich be-
sitzt, dafür ist die „Tän-
zerin“ ein Beweis. Man
betrachte sich daraufhin
nur den Kopf dieser kräftig
ausschreitenden Gestalt,
„Mumme schmeckt noch mal sau fien
Als Tokay und Mosler Wien.“
Und dann das Gebräu in dem hannoverschen Eimbeck. Das Wasser dazu ent-
stammte einer silberklaren Quelle, der besondere Eigenschaften nachgerühmt
wurden, und das Übrige machten Hopfen und Malz und einige geheime Zutaten.
Eimbecker Bier ward hoch gefeiert, auch Luther trank und pries es, ja es war
hoffähig, denn die Kurfürsten von Brandenburg schlürften es in vollen Zügen,
und Herzog Albrecht V. von Bayern ließ es sogar nach München kommen, wo es
der Stammvater des berühmten Münchner „Bock“ geworden ist. Sonst vertilgten
die Süddeutschen unter vielen andern Bieren noch Nürnberger, Altdorfer,
Hersbrucker, Heroldsberger, Gräfenberger und verschiedene weiße Biere, wie
Feuchter und Leimburger, alle prächtig gebraut und stets frisch vom Faß, denn
jeder gestrenge Rat wachte darüber, daß bestes Material benutzt wurde und
daß der Wirt nur einen „lessigen“ Zapfen habe oder mit andern Worten: nur
ein Faß laufen lasse.
Ebenso günstig wie die Bierverhältnisse lagen die des Weines. Den im
Verdacht des Fälschens und Taufens stehenden Schankwirten sah ein wohl-
weiser Magistrat stark auf die Finger. Wehe dem Lump, der Waidasche, Silber-
glätte, Branntwein, Senf oder Speck zusetzte — er wurde streng bestraft und
sein Wein ohne Gnade ausgeschüttet. Ehrsame Wirte ließen ihren Wein durch
den geschworenen Weinkieser probieren, damit, falls der Trank gut war, ihr
Name auf die öffentlich ausgehängte Tafel kam. Nur die Besitzer der Winkel-
schenken, die Heckenwirte, drückten sich vor diesem „Weisen“, aber sehr zu
ihrem Schaden, denn anständige Leute mieden solche Räuberlokale.
die den Schleier gleich einer Flamme über ihrem Haupte schwingt. Zugleich
zeigt dieses Bild, eine wie glückliche Mischung in Heia Peters das formal-
zeichnerische und das malerische Element eingegangen sind, die sich nun
gegenseitig befruchten.
Denn auch die Linie weiß dieser Künstlerin immer neue Dinge mitzuteilen,
und hierfür ist ihr Alois Kolb noch vor wenigen Jahren auf dem Gebiete der
Radierkunst ein wertvoller Vermittler gewesen. Dabei bevorzugt Heia Peters
die Kaltnadel mit ihrer klaren, zeichnerischen Wirkung. In dieser Technik sind
auch gewöhnlich ihre Ex Libris ausgeführt, welche sie als liebevolle Pflegerin
der Kleinkunst zeigen und ihren Geschmack beweisen. So hat diese Künstlerin
schon in jungen Jahren eine Stufe der Entwicklung erlangt, von der sie auf
eine Reihe wertvoller Leistungen zurückblicken kann. Von dem Gebiete, das
sich ihr beim Vorwärtsschauen erschließt, wird die Zukunft Kunde geben.
@lte CDiptshäusep.
Von Georg Buß.
~~ [Nachdruck verboten.]
Neben dem heimischen Gewächs, das draußen vor der Stadt mehr oder
weniger sauer heranreifte, und dessen sich sogar Potsdam und Grüneberg rühmten,
trank man bessere Sorten vom Rhein und aus dem Rheingau, vom Main und
von der Tauber, vom Neckar und von der Bergstraße, aus Schwaben und dem
Elsaß. Dazu noch Passauer, Weltliner, Romanaier, Malvasier, griechische Weine
und Muskateller. Natürlich war der Wein am besten in den vom hohen Rat
der Stadt eingerichteten und bewirtschafteten Ratskellern, wo sich die gebietenden
Herren und die Patrizier allabendlich zum Schoppen zusammenfanden und ihre
Weisheit austauschten. Fast keine Stadt, die nicht ihren Ratskeller gehabt hätte.
Am beliebtesten war der Ratskeller zu Lübeck, weil er die besten Tropfen
enthielt. Allmählich wurde er übertrumpft vom Ratskeller in Bremen, der im
Mai 1905 sein fünfhundertjähriges Jubiläum gefeiert hat. Hauffs unsterbliche
Phantasien haben ihn seit dem Jahre 1827 erst recht berühmt gemacht. Weniger
gefeiert wurde der Ratskeller in Hamburg — der Frankfurter Schöffe Conrad
von Uffenbach, der ihn 1710 besuchte, fand ihn schäbig, obwohl der Wein, so
insbesondere der monopolisierte Rheinwein, vorzüglich war. Auch der behagliche
Ratskeller in Gera sei nicht vergessen — er beging im November 1887 sein
vierhundertjähriges Jubiläum. Alle die andern ehrwürdigen Ratskeller zu nennen,
würde in Anbetracht ihrer großen Zahl zu weit führen. Die meisten sind vom
Wein zum Bier übergegangen, und manche sind von ihrer stolzen Höhe zum
simplen Kutscherlokal herabgerutscht.
Wie trefflich auch die alten Wirtshäuser für Stillung teutonischen Durstes
waren, so besaßen sie doch ihre Schattenseiten, denn solider Schweinebraten
und saftige Beefsteaks oder Hammelrippchen wurden nicht verabreicht. Den
Wirten war nach den ältesten Verordnungen verboten, dem Gast zum Frühtrunke
irgendwelches Essen zu verabreichen oder nachmittags außer Brot und Käse
eine Suppe oder ein Fleischgericht vorzusetzten. Solche Verordnungen haben
noch im 16. Jahrhundert sogar in Nürnberg bestanden. Allerdings machten
gewisse Städte zugunsten von Wirten, die ihren Bedarf an Bier und Wein auf-
kaufen mußten, eine Ausnahme: diesen sogenannten Schild wirten war das Speisen
gestattet; hingegen blieb es den Reifwirten, die ihr eignes Gewächs und Gebräu
verzapften, nach wie vor ver-
sagt, es sei denn, daß einer
am Markt wohnte: in diesem
Falle konnte er an den Markt-
tagen Suppe, Fleisch und He-
ring verabfolgen. Ein anderer
schwacher Punkt des Wirts-
hauslebens, der allerdings von
besorgten Hausfrauen sehr ge-
rühmt wurde, war das allzu
frühzeitige Schließen der
Schenke. Läutete abends um
acht oder neun Uhr die Bier-
oder Feuerglocke, so mußten
die Gäste das Wirtshaus ver-
lassen; die Glocke läutete so
lange, daß jedermann bequem
austrinken konnte, aber dann
hatte er sich schleunigst zu
drücken. Es versteht sich von
selbst, daß ein größeres Maß
von Freiheit die Herbergen ge-
nossen. Wie es mit dem Loge-
ment und den Diners in diesen
„Gasthöfen“ und „Hotels“ be-
schaffen war, schildert nicht
sehr verlockend der gelehrte
Erasmus von Rotterdam. Zwar
Heia Peters: Exlibris Hagedorn.