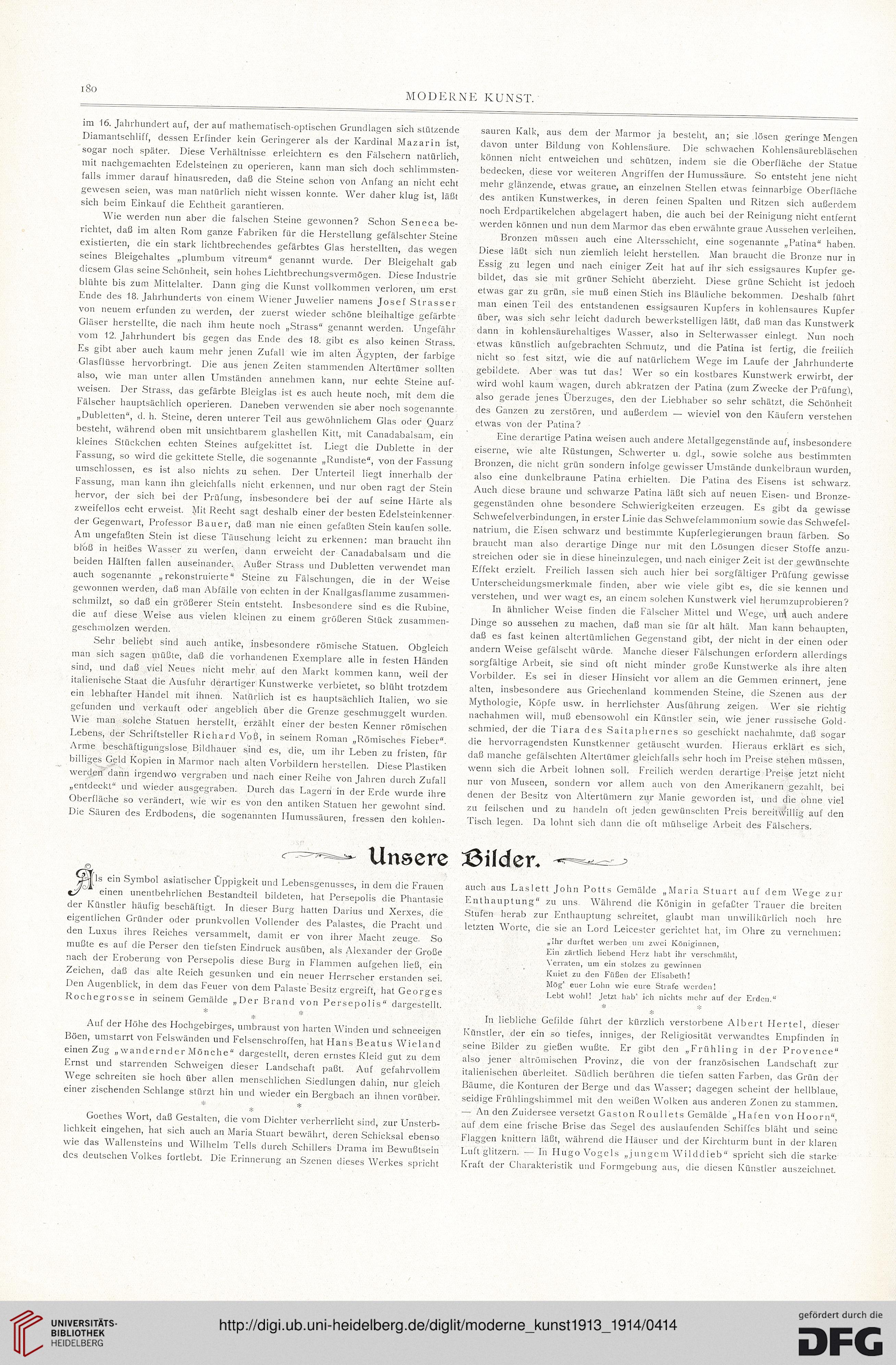i8o
MODERNE KUNST.
im 16. Jahrhundert auf, der auf mathematisch-optischen Grundlagen sich stützende
Diamantschliff, dessen Erfinder kein Geringerer als der Kardinal Mazarin ist,
sogar noch später. Diese Verhältnisse erleichtern es den Fälschern natürlich,
mit nachgemachten Edelsteinen zu operieren, kann man sich doch schlimmsten-
falls immer darauf hinausreden, daß die Steine schon von Anfang an nicht echt
gewesen seien, was man natürlich nicht wissen konnte. Wer daher klug ist, läßt
sich beim Einkauf die Echtheit garantieren.
Wie werden nun aber die falschen Steine gewonnen? Schon Seneca be-
richtet, daß im alten Rom ganze Fabriken für die Herstellung gefälschter Steine
existierten, die ein stark lichtbrechendes gefärbtes Glas herstellten, das wegen
seines Bleigehaltes „plumbum vitreum“ genannt wurde. Der Bleigehalt gab
diesem Glas seine Schönheit, sein hohes Lichtbrechungsvermögen. Diese Industrie
blühte bis zum Mittelalter. Dann ging die Kunst vollkommen verloren, um erst
Ende des 18. Jahrhunderts von einem Wiener Juwelier namens Josef Strassen
von neuem erfunden zu werden, der zuerst wieder schöne bleihaltige gefärbte
Gläser herstellte, die nach ihm heute noch „Strass“ genannt werden. Ungefähr
vom 12. Jahrhundert bis gegen das Ende des 18. gibt es also keinen Strass.
Es gibt aber auch kaum mehr jenen Zufall wie im alten Ägypten, der farbige
Glasflüsse hervorbringt. Die aus jenen Zeiten stammenden Altertümer sollten
also, wie man unter allen Umständen annehmen kann, nur echte Steine auf-
weisen. Der Strass, das gefärbte Bleiglas ist es auch heute noch, mit dem die
Fälscher hauptsächlich operieren. Daneben verwenden sie aber noch sogenannte
„Dubletten“, d. h. Steine, deren unterer Teil aus gewöhnlichem Glas oder Quarz
besteht, während oben mit unsichtbarem glashellen Kitt, mit Canadabalsam, ein
kleines Stückchen echten Steines aufgekittet ist. Liegt die Dublette in der
Fassung, so wird die gekittete Stelle, die sogenannte „Rundiste“, von der Fassung
umschlossen, es ist also nichts zu sehen. Der Unterteil liegt innerhalb der
Fassung, man kann ihn gleichfalls nicht erkennen, und nur oben ragt der Stein
hervor, der sich bei der Prüfung, insbesondere bei der auf seine Härte als
zweifellos echt erweist, lyiit Recht sagt deshalb einer der besten Edelsteinkenner
der Gegenwart, Professor Bauer, daß man nie einen gefaßten Stein kaufen solle.
Am ungefaßten Stein ist diese Täuschung leicht zu erkennen: man braucht ihn
bl'öß in heißes Wasser zu werfen, dann erweicht der Canadabalsam und die
beiden Hälften fallen auseinander.. Außer Strass und Dubletten verwendet man
auch sogenannte „ rekonstruierte “ Steine zu Fälschungen, die in der Weise
gewonnen werden, daß man Abfälle von echten in der Knallgasflamme zusammen-
schmilzt, so daß ein größerer Stein entsteht. Insbesondere sind es die Rubine,
die auf diese Weise aus vielen kleinen zu einem größeren Stück zusammen-
geschmolzen werden.
Sehr beliebt sind auch antike, insbesondere römische Statuen. Obgleich
man sich sagen müßte, daß die vorhandenen Exemplare alle in festen Händen
sind, und daß viel Neues nicht mehr auf den Markt kommen kann, weil der
italienische Staat die Ausfuhr derartiger Kunstwerke verbietet, so blüht trotzdem
ein lebhafter Handel mit ihnen. Natürlich ist es hauptsächlich Italien, wo sie
gefunden und verkauft oder angeblich über die Grenze geschmuggelt wurden.
Wie man solche Statuen herstellt, erzählt einer der besten Kenner römischen
Lebens, der Schriftsteller Richard Voß, in seinem Roman „Römisches Fieber“.
Arme beschäftigungslose Bildhauer sind es, die, um ihr Leben zu fristen, für
billiges Geld Kopien in Marmor nach alten Vorbildern hersteilen. Diese Plastiken
werden dann irgendwo vergraben und nach einer Reihe von Jahren durch Zufall
„entdeckt“ und wieder ausgegraben. Durch das Lagern in der Erde wurde ihre
Oberfläche so verändert, wie wir es von den antiken Statuen her gewohnt sind.
Die Säuren des Erdbodens, die sogenannten Humussäuren, fressen den kohlen-
sauren Kalk, aus dem der Marmor ja besteht, an; sie lösen geringe Mengen
davon unter Bildung von Kohlensäure. Die schwachen Kohlensäurebläschen
können nicht entweichen und schützen, indem sie die Oberfläche der Statue
bedecken, diese vor weiteren Angriffen der Humussäure. So entsteht jene nicht
mehr glänzende, etwas graue, an einzelnen Stellen etwas feinnarbige Oberfläche
des antiken Kunstwerkes, in deren feinen Spalten und Ritzen sich außerdem
noch Erdpartikelchen abgelagert haben, die auch bei der Reinigung nicht entfernt
werden können und nun dem Marmor das eben erwähnte graue Aussehen verleihen.
Bronzen müssen auch eine Altersschicht, eine sogenannte „Patina“ haben.
Diese läßt sich nun ziemlich leicht herstellen. Man braucht die Bronze nur in
Essig zu legen und nach einiger Zeit hat auf ihr sich essigsaures Kupfer ge-
bildet, das sie mit grüner Schicht überzieht. Diese grüne Schicht ist jedoch
etwas gar zu grün, sie muß einen Stich ins Bläuliche bekommen. Deshalb führt
man einen Teil des entstandenen essigsauren Kupfers in kohlensaures Kupfer
über, was sich sehr leicht dadurch bewerkstelligen läßt, daß man das Kunstwerk
dann in kohlensäurehaltiges Wasser, also in Selterwasser einlegt. Nun noch
etwas künstlich aufgebrachten Schmutz, und die Patina ist fertig, die freilich
nicht so fest sitzt, wie die auf natürlichem Wege im Laufe der Jahrhunderte
gebildete. Aber was tut das! Wer so ein kostbares Kunstwerk erwirbt, der
wird wohl kaum wagen, durch abkratzen der Patina (zum Zwecke der Prüfung),
also gerade jenes Überzuges, den der Liebhaber so sehr schätzt, die Schönheit
des Ganzen zu zerstören, und außerdem — wieviel von den Käufern verstehen
etwas von der Patina?
Eine derartige Patina weisen auch andere Metallgegenstände auf, insbesondere
eiserne, wie alte Rüstungen, Schwerter u. dgl., sowie solche aus bestimmten
Bronzen, die nicht grün sondern infolge gewisser Umstände dunkelbraun wurden,
also eine dunkelbraune Patina erhielten. Die Patina des Eisens ist schwarz.
Auch diese braune und schwarze Patina läßt sich auf neuen Eisen- und Bronze-
gegenständen ohne besondere Schwierigkeiten erzeugen. Es gibt da gewisse
Schwefelverbindungen, in erster Linie das Schwefelammonium sowie das Schwefel-
natrium, die Eisen schwarz und bestimmte Kupferlegierungen braun färben. So
braucht man also derartige Dinge nur mit den Lösungen dieser Stoffe anzu-
streichen oder sie in diese hineinzulegen, und nach einiger Zeit ist der.gewünschte
Effekt erzielt. Freilich lassen sich auch hier bei sorgfältiger Prüfung gewisse
Unterscheidungsmerkmale finden, aber wie viele gibt es, die sie kennen und
verstehen, und wer wagt es, an einem solchen Kunstwerk viel herumzuprobieren?
In ähnlicher Weise finden die Fälscher Mittel und Wege, un\ auch andere
Dinge so aussehen zu machen, daß man sie für alt hält. Man kann behaupten,
daß es fast keinen altertümlichen Gegenstand gibt, der nicht in der einen oder
andern Weise gefälscht würde. Manche dieser Fälschungen erfordern allerdings
sorgfältige Arbeit, sie sind oft nicht minder große Kunstwerke als ihre alten
Vorbilder. Es sei in dieser Hinsicht vor allem an die Gemmen erinnert, jene
alten, insbesondere aus Griechenland kommenden Steine, die Szenen aus der
Mythologie, Köpfe usw. in herrlichster Ausführung zeigen. Wer sie richtig
nachahmen will, muß ebensowohl ein Künstler sein, wie jener russische Gold-
schmied, der die Tiara des Saitaphernes so geschickt nachahmte, daß sogar
die hervorragendsten Kunstkenner getäuscht wurden. Hieraus erklärt es sich,
daß manche gefälschten Altertümer gleichfalls sehr hoch im Preise stehen müssen,
wenn sich die Arbeit lohnen soll. Freilich werden derartige Preise jetzt nicht
nur von Museen, sondern vor allem auch von den Amerikanern gezahlt, bei
denen der Besitz von Altertümern zur Manie geworden ist, und die ohne viel
zu feilschen und zu handeln oft jeden gewünschten Preis bereitwillig auf den
Tisch legen. Da lohnt sich dann die oft mühselige Arbeit des Fälschers.
Unsere
ls ein Symbol asiatischer Üppigkeit und Lebensgenusses, in dem die Frauen
einen unentbehrlichen Bestandteil bildeten, hat Persepolis die Phantasie
der Künstler häufig beschäftigt. In dieser Burg hatten Darius und Xerxes, die
eigentlichen Gründer oder prunkvollen Vollender des Palastes, die Pracht und
den Luxus ihres Reiches versammelt, damit er von ihrer Macht zeuge. So
mußte es auf die Perser den tiefsten Eindruck ausüben, als Alexander der Große
nach der Eroberung von Persepolis diese Burg in Flammen aufgehen ließ, ein
Zeichen, daß das alte Reich gesunken und ein neuer Herrscher erstanden sei.
Den Augenblick, in dem das Feuer von dem Palaste Besitz ergreift, hat Georges
Rochegrosse in seinem Gemälde „Der Brand von Persepolis“ dargestellt.
Auf der Höhe des Hochgebirges, umbraust von harten Winken und schneeigen
Böen, umstarrt von Felswänden und Felsenschroffen, hat Hans Beatus Wieland
einen Zug „ wandernder Mönche“ dargestellt, deren ernstes Kleid gut zu dem
Ernst und starrenden Schweigen dieser Landschaft paßt. Auf gefahrvollem
Wege schreiten sie hoch über allen menschlichen Siedlungen dahin, nur gleich
einer zischenden Schlange stürzt hin und wieder ein Bergbach an ihnen vorüber.
* *
Goethes Wort, daß Gestalten, die vom Dichter verherrlicht sind,, zur Unsterb-
lichkeit eingehen, hat sich auch an Maria Stuart bewährt, deren Schicksal ebenso
wie das Wallensteins und Wilhelm Teils durch Schillers Drama im Bewußtsein
des deutschen Volkes fortlebt. Die Erinnerung an Szenen dieses Werkes spricht
ßilder.
auch aus Laslett John Potts Gemälde „Maria Stuart auf dem Wege zur
Enthauptung“ zu uns. Während die Königin in gefaßter Trauer die breiten
Stufen herab zur Enthauptung schreitet, glaubt man unwillkürlich noch hre
letzten Worte, die sie an Lord Leicestcr gerichtet hat, im Ohre zu vernehmen:
„Ihr durftet werben lim zwei Königinnen,
Ein zärtlich liebend Herz liebt ihr verschmäht,
Verraten, um ein stolzes zu gewinnen
Kniet zu den Füßen der Elisabeth!
Mög' euer Lohn wie eure Strafe werden!
Lebt wohl! Jetzt heb' ich nichts mehr auf der Erden.“
In liebliche Gefilde führt der kürzlich verstorbene Albert Hertel, dieser
Künstler, der ein so tiefes, inniges, der Religiosität verwandtes Empfinden in
seine Bilder zu gießen wußte. Er gibt den „Frühling in der Provence“
also jener äl(römischen Provinz, die von der französischen Landschaft zur
italienischen überleitet. Südlich berühren die tiefen satten Farben, das Grün der
Bäume, die Konturen der Berge und das Wasser; dagegen scheint der hellblaue,
seidige Frühlingshimmel mit den weißen Wolken aus anderen Zonen zu stammen.
—- An den Zuidersee versetzt Gaston Roullets Gemälde „Hafen von Hoorn“,
auf dem eine frische Brise das Segel des auslaufenden Schiffes bläht und seine
Flaggen knittern läßt, während die Häuser und der Kirchturm bunt in der klaren
Luft glitzern. — In Hugo Vogels '„jungem Wilddieb''“' spricht sich die starke
Kraft der Charakteristik und Formgebung aus, die diesen Künstler auszeichnet.
MODERNE KUNST.
im 16. Jahrhundert auf, der auf mathematisch-optischen Grundlagen sich stützende
Diamantschliff, dessen Erfinder kein Geringerer als der Kardinal Mazarin ist,
sogar noch später. Diese Verhältnisse erleichtern es den Fälschern natürlich,
mit nachgemachten Edelsteinen zu operieren, kann man sich doch schlimmsten-
falls immer darauf hinausreden, daß die Steine schon von Anfang an nicht echt
gewesen seien, was man natürlich nicht wissen konnte. Wer daher klug ist, läßt
sich beim Einkauf die Echtheit garantieren.
Wie werden nun aber die falschen Steine gewonnen? Schon Seneca be-
richtet, daß im alten Rom ganze Fabriken für die Herstellung gefälschter Steine
existierten, die ein stark lichtbrechendes gefärbtes Glas herstellten, das wegen
seines Bleigehaltes „plumbum vitreum“ genannt wurde. Der Bleigehalt gab
diesem Glas seine Schönheit, sein hohes Lichtbrechungsvermögen. Diese Industrie
blühte bis zum Mittelalter. Dann ging die Kunst vollkommen verloren, um erst
Ende des 18. Jahrhunderts von einem Wiener Juwelier namens Josef Strassen
von neuem erfunden zu werden, der zuerst wieder schöne bleihaltige gefärbte
Gläser herstellte, die nach ihm heute noch „Strass“ genannt werden. Ungefähr
vom 12. Jahrhundert bis gegen das Ende des 18. gibt es also keinen Strass.
Es gibt aber auch kaum mehr jenen Zufall wie im alten Ägypten, der farbige
Glasflüsse hervorbringt. Die aus jenen Zeiten stammenden Altertümer sollten
also, wie man unter allen Umständen annehmen kann, nur echte Steine auf-
weisen. Der Strass, das gefärbte Bleiglas ist es auch heute noch, mit dem die
Fälscher hauptsächlich operieren. Daneben verwenden sie aber noch sogenannte
„Dubletten“, d. h. Steine, deren unterer Teil aus gewöhnlichem Glas oder Quarz
besteht, während oben mit unsichtbarem glashellen Kitt, mit Canadabalsam, ein
kleines Stückchen echten Steines aufgekittet ist. Liegt die Dublette in der
Fassung, so wird die gekittete Stelle, die sogenannte „Rundiste“, von der Fassung
umschlossen, es ist also nichts zu sehen. Der Unterteil liegt innerhalb der
Fassung, man kann ihn gleichfalls nicht erkennen, und nur oben ragt der Stein
hervor, der sich bei der Prüfung, insbesondere bei der auf seine Härte als
zweifellos echt erweist, lyiit Recht sagt deshalb einer der besten Edelsteinkenner
der Gegenwart, Professor Bauer, daß man nie einen gefaßten Stein kaufen solle.
Am ungefaßten Stein ist diese Täuschung leicht zu erkennen: man braucht ihn
bl'öß in heißes Wasser zu werfen, dann erweicht der Canadabalsam und die
beiden Hälften fallen auseinander.. Außer Strass und Dubletten verwendet man
auch sogenannte „ rekonstruierte “ Steine zu Fälschungen, die in der Weise
gewonnen werden, daß man Abfälle von echten in der Knallgasflamme zusammen-
schmilzt, so daß ein größerer Stein entsteht. Insbesondere sind es die Rubine,
die auf diese Weise aus vielen kleinen zu einem größeren Stück zusammen-
geschmolzen werden.
Sehr beliebt sind auch antike, insbesondere römische Statuen. Obgleich
man sich sagen müßte, daß die vorhandenen Exemplare alle in festen Händen
sind, und daß viel Neues nicht mehr auf den Markt kommen kann, weil der
italienische Staat die Ausfuhr derartiger Kunstwerke verbietet, so blüht trotzdem
ein lebhafter Handel mit ihnen. Natürlich ist es hauptsächlich Italien, wo sie
gefunden und verkauft oder angeblich über die Grenze geschmuggelt wurden.
Wie man solche Statuen herstellt, erzählt einer der besten Kenner römischen
Lebens, der Schriftsteller Richard Voß, in seinem Roman „Römisches Fieber“.
Arme beschäftigungslose Bildhauer sind es, die, um ihr Leben zu fristen, für
billiges Geld Kopien in Marmor nach alten Vorbildern hersteilen. Diese Plastiken
werden dann irgendwo vergraben und nach einer Reihe von Jahren durch Zufall
„entdeckt“ und wieder ausgegraben. Durch das Lagern in der Erde wurde ihre
Oberfläche so verändert, wie wir es von den antiken Statuen her gewohnt sind.
Die Säuren des Erdbodens, die sogenannten Humussäuren, fressen den kohlen-
sauren Kalk, aus dem der Marmor ja besteht, an; sie lösen geringe Mengen
davon unter Bildung von Kohlensäure. Die schwachen Kohlensäurebläschen
können nicht entweichen und schützen, indem sie die Oberfläche der Statue
bedecken, diese vor weiteren Angriffen der Humussäure. So entsteht jene nicht
mehr glänzende, etwas graue, an einzelnen Stellen etwas feinnarbige Oberfläche
des antiken Kunstwerkes, in deren feinen Spalten und Ritzen sich außerdem
noch Erdpartikelchen abgelagert haben, die auch bei der Reinigung nicht entfernt
werden können und nun dem Marmor das eben erwähnte graue Aussehen verleihen.
Bronzen müssen auch eine Altersschicht, eine sogenannte „Patina“ haben.
Diese läßt sich nun ziemlich leicht herstellen. Man braucht die Bronze nur in
Essig zu legen und nach einiger Zeit hat auf ihr sich essigsaures Kupfer ge-
bildet, das sie mit grüner Schicht überzieht. Diese grüne Schicht ist jedoch
etwas gar zu grün, sie muß einen Stich ins Bläuliche bekommen. Deshalb führt
man einen Teil des entstandenen essigsauren Kupfers in kohlensaures Kupfer
über, was sich sehr leicht dadurch bewerkstelligen läßt, daß man das Kunstwerk
dann in kohlensäurehaltiges Wasser, also in Selterwasser einlegt. Nun noch
etwas künstlich aufgebrachten Schmutz, und die Patina ist fertig, die freilich
nicht so fest sitzt, wie die auf natürlichem Wege im Laufe der Jahrhunderte
gebildete. Aber was tut das! Wer so ein kostbares Kunstwerk erwirbt, der
wird wohl kaum wagen, durch abkratzen der Patina (zum Zwecke der Prüfung),
also gerade jenes Überzuges, den der Liebhaber so sehr schätzt, die Schönheit
des Ganzen zu zerstören, und außerdem — wieviel von den Käufern verstehen
etwas von der Patina?
Eine derartige Patina weisen auch andere Metallgegenstände auf, insbesondere
eiserne, wie alte Rüstungen, Schwerter u. dgl., sowie solche aus bestimmten
Bronzen, die nicht grün sondern infolge gewisser Umstände dunkelbraun wurden,
also eine dunkelbraune Patina erhielten. Die Patina des Eisens ist schwarz.
Auch diese braune und schwarze Patina läßt sich auf neuen Eisen- und Bronze-
gegenständen ohne besondere Schwierigkeiten erzeugen. Es gibt da gewisse
Schwefelverbindungen, in erster Linie das Schwefelammonium sowie das Schwefel-
natrium, die Eisen schwarz und bestimmte Kupferlegierungen braun färben. So
braucht man also derartige Dinge nur mit den Lösungen dieser Stoffe anzu-
streichen oder sie in diese hineinzulegen, und nach einiger Zeit ist der.gewünschte
Effekt erzielt. Freilich lassen sich auch hier bei sorgfältiger Prüfung gewisse
Unterscheidungsmerkmale finden, aber wie viele gibt es, die sie kennen und
verstehen, und wer wagt es, an einem solchen Kunstwerk viel herumzuprobieren?
In ähnlicher Weise finden die Fälscher Mittel und Wege, un\ auch andere
Dinge so aussehen zu machen, daß man sie für alt hält. Man kann behaupten,
daß es fast keinen altertümlichen Gegenstand gibt, der nicht in der einen oder
andern Weise gefälscht würde. Manche dieser Fälschungen erfordern allerdings
sorgfältige Arbeit, sie sind oft nicht minder große Kunstwerke als ihre alten
Vorbilder. Es sei in dieser Hinsicht vor allem an die Gemmen erinnert, jene
alten, insbesondere aus Griechenland kommenden Steine, die Szenen aus der
Mythologie, Köpfe usw. in herrlichster Ausführung zeigen. Wer sie richtig
nachahmen will, muß ebensowohl ein Künstler sein, wie jener russische Gold-
schmied, der die Tiara des Saitaphernes so geschickt nachahmte, daß sogar
die hervorragendsten Kunstkenner getäuscht wurden. Hieraus erklärt es sich,
daß manche gefälschten Altertümer gleichfalls sehr hoch im Preise stehen müssen,
wenn sich die Arbeit lohnen soll. Freilich werden derartige Preise jetzt nicht
nur von Museen, sondern vor allem auch von den Amerikanern gezahlt, bei
denen der Besitz von Altertümern zur Manie geworden ist, und die ohne viel
zu feilschen und zu handeln oft jeden gewünschten Preis bereitwillig auf den
Tisch legen. Da lohnt sich dann die oft mühselige Arbeit des Fälschers.
Unsere
ls ein Symbol asiatischer Üppigkeit und Lebensgenusses, in dem die Frauen
einen unentbehrlichen Bestandteil bildeten, hat Persepolis die Phantasie
der Künstler häufig beschäftigt. In dieser Burg hatten Darius und Xerxes, die
eigentlichen Gründer oder prunkvollen Vollender des Palastes, die Pracht und
den Luxus ihres Reiches versammelt, damit er von ihrer Macht zeuge. So
mußte es auf die Perser den tiefsten Eindruck ausüben, als Alexander der Große
nach der Eroberung von Persepolis diese Burg in Flammen aufgehen ließ, ein
Zeichen, daß das alte Reich gesunken und ein neuer Herrscher erstanden sei.
Den Augenblick, in dem das Feuer von dem Palaste Besitz ergreift, hat Georges
Rochegrosse in seinem Gemälde „Der Brand von Persepolis“ dargestellt.
Auf der Höhe des Hochgebirges, umbraust von harten Winken und schneeigen
Böen, umstarrt von Felswänden und Felsenschroffen, hat Hans Beatus Wieland
einen Zug „ wandernder Mönche“ dargestellt, deren ernstes Kleid gut zu dem
Ernst und starrenden Schweigen dieser Landschaft paßt. Auf gefahrvollem
Wege schreiten sie hoch über allen menschlichen Siedlungen dahin, nur gleich
einer zischenden Schlange stürzt hin und wieder ein Bergbach an ihnen vorüber.
* *
Goethes Wort, daß Gestalten, die vom Dichter verherrlicht sind,, zur Unsterb-
lichkeit eingehen, hat sich auch an Maria Stuart bewährt, deren Schicksal ebenso
wie das Wallensteins und Wilhelm Teils durch Schillers Drama im Bewußtsein
des deutschen Volkes fortlebt. Die Erinnerung an Szenen dieses Werkes spricht
ßilder.
auch aus Laslett John Potts Gemälde „Maria Stuart auf dem Wege zur
Enthauptung“ zu uns. Während die Königin in gefaßter Trauer die breiten
Stufen herab zur Enthauptung schreitet, glaubt man unwillkürlich noch hre
letzten Worte, die sie an Lord Leicestcr gerichtet hat, im Ohre zu vernehmen:
„Ihr durftet werben lim zwei Königinnen,
Ein zärtlich liebend Herz liebt ihr verschmäht,
Verraten, um ein stolzes zu gewinnen
Kniet zu den Füßen der Elisabeth!
Mög' euer Lohn wie eure Strafe werden!
Lebt wohl! Jetzt heb' ich nichts mehr auf der Erden.“
In liebliche Gefilde führt der kürzlich verstorbene Albert Hertel, dieser
Künstler, der ein so tiefes, inniges, der Religiosität verwandtes Empfinden in
seine Bilder zu gießen wußte. Er gibt den „Frühling in der Provence“
also jener äl(römischen Provinz, die von der französischen Landschaft zur
italienischen überleitet. Südlich berühren die tiefen satten Farben, das Grün der
Bäume, die Konturen der Berge und das Wasser; dagegen scheint der hellblaue,
seidige Frühlingshimmel mit den weißen Wolken aus anderen Zonen zu stammen.
—- An den Zuidersee versetzt Gaston Roullets Gemälde „Hafen von Hoorn“,
auf dem eine frische Brise das Segel des auslaufenden Schiffes bläht und seine
Flaggen knittern läßt, während die Häuser und der Kirchturm bunt in der klaren
Luft glitzern. — In Hugo Vogels '„jungem Wilddieb''“' spricht sich die starke
Kraft der Charakteristik und Formgebung aus, die diesen Künstler auszeichnet.