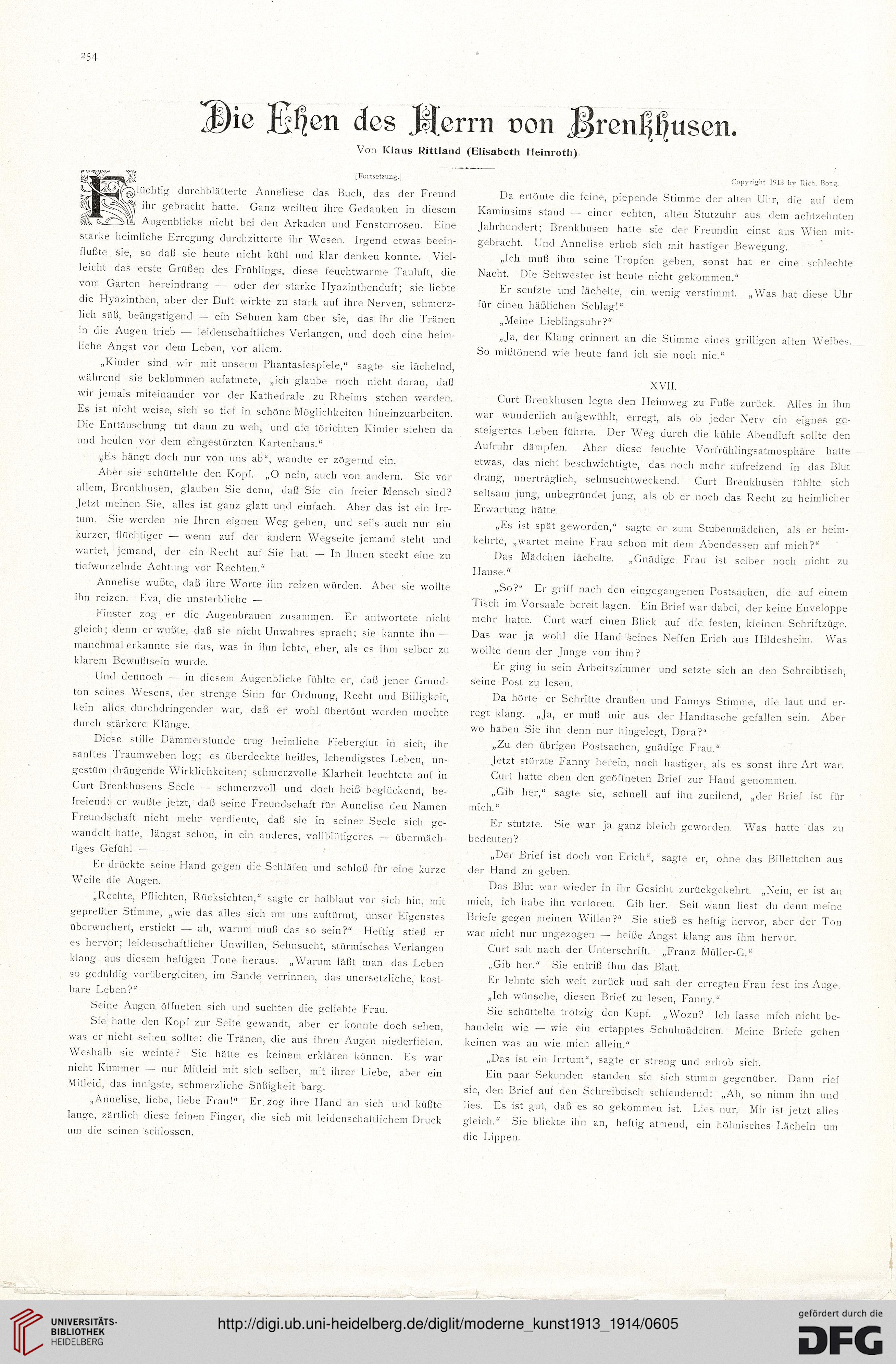254
des JHerrn r>on J>rßnl|l|usßn.
Von Klaus Rittland (Elisabeth Heinroth)
[Fortsetzung.]
Richtig durchblätterte Anneliese das Buch, das der Freund
ihr gebracht hatte. Ganz weilten ihre Gedanken in diesem
Augenblicke nicht bei den Arkaden und Fensterrosen. Eine
starke heimliche Erregung durchzitterte ihr Wesen. Irgend etwas beein-
flußte sie, so daß sie heute nicht kühl und klar denken konnte. Viel-
leicht das erste Grüßen des Frühlings, diese feuchtwarme Tauluft, die
vom Garten hereindrang — oder der starke Hyazinthenduft; sie liebte
die Hyazinthen, aber der Duft wirkte zu stark auf ihre Nerven, schmerz-
lich süß, beängstigend — ein Sehnen kam über sie, das ihr die Tränen
in die Augen trieb — leidenschaftliches Verlangen, und doch eine heim-
liche Angst vor dem Leben, vor allem.
„Kinder sind wir mit unserm Phantasiespiele,“ sagte sie lächelnd,
während sie beklommen aufatmete, „ich glaube noch nicht daran, daß
wir jemals miteinander vor der Kathedrale zu Rheims stehen werden.
Es ist nicht weise, sich so tief in schöne Möglichkeiten hineinzuarbeiten.
Die Enttäuschung tut dann zu weh, und die törichten Kinder stehen da
und heulen vor dem eingestürzten Kartenhaus.“
„Es hängt doch nur von uns ab“, wandte er zögernd ein.
Aber sie schütteltte den Kopf. „O nein, auch von andern. Sie vor
allem, Brenkhusen, glauben Sie denn, daß Sie ein freier Mensch sind?
Jetzt meinen Sie, alles ist ganz glatt und einfach. Aber das ist ein Irr-
tum. Sie werden nie Ihren eignen Weg gehen, und sei’s auch nur ein
kurzer, flüchtiger — wenn auf der andern Wegseite jemand steht und
wartet, jemand, der ein Recht auf Sie hat. — In Ihnen steckt eine zu
tiefwurzelnde Achtung vor Rechten.“
Annelise wußte, daß ihre Worte ihn reizen würden. Aber sie wollte
ihn reizen. Eva, die unsterbliche —
Finster zog er die Augenbrauen zusammen. Er antwortete nicht
gleich; denn er wußte, daß sie nicht Unwahres sprach; sie kannte ihn —
manchmal erkannte sie das, was in ihm lebte, eher, als es ihm selber zu
klarem Bewußtsein wurde.
Und dennoch — in diesem Augenblicke fühlte er, daß jener Grund-
ton seines Wesens, der strenge Sinn für Ordnung, Recht und Billigkeit,
kein alles durchdringender war, daß er wohl übertönt werden mochte
durch stärkere Klänge.
Diese stille Dämmerstunde trug heimliche Fieberglut in sich, ihr
sanftes Traumweben log; es überdeckte heißes, lebendigstes Leben, un-
gestüm drängende Wirklichkeiten; schmerzvolle Klarheit leuchtete auf in
Gurt Brenkhusens Seele — schmerzvoll und doch heiß beglückend, be-
freiend: er wußte jetzt, daß seine Freundschaft für Annelise den Namen
Freundschaft nicht mehr verdiente, daß sie in seiner Seele sich ge-
wandelt hatte, längst schon, in ein anderes, vollblütigeres — übermäch-
tiges Gefühl — —
Er drückte seine Hand gegen die Schläfen und schloß für eine kurze
WTeile die Augen.
„Rechte, Pflichten, Rücksichten,“ sagte er halblaut vor sich hin, mit
gepreßter Stimme, „wie das alles sich um uns auftürmt, unser Eigenstes
überwuchert, erstickt — ah, warum muß das so sein?“ Heftig stieß er
es hervor; leidenschaftlicher Unwillen, Sehnsucht, stürmisches Verlangen
klang aus diesem heftigen Tone heraus. „Warum läßt man das Leben
so geduldig vorübergleiten, im Sande verrinnen, das unersetzliche, kost-
bare Leben?“
Seine Augen öffneten sich und suchten die geliebte Frau.
Sie hatte den Kopf zur Seite gewandt, aber er konnte doch sehen,
was er nicht sehen sollte; die Tränen, die aus ihren Augen niederfielen.
Weshalb sie weinte? Sie hätte es keinem erklären können. Es war
nicht Kummer — nur Mitleid mit sich selber, mit ihrer Liebe, aber ein
Mitleid, das innigste, schmerzliche Süßigkeit barg.
„Annelise, liebe, liebe Frau!“ Er. zog ihre Hand an sich und küßte
lange, zärtlich diese feinen Finger, die sich mit leidenschaftlichem Druck
um die seinen schlossen.
Copyright 1913 bv Rieh. Bong.
Da ertönte die feine, piepende Stimme der alten Uhr, die auf dem
Kaminsims stand — einer echten, alten Stutzuhr aus dem achtzehnten
Jahrhundert; Brenkhusen hatte sie der Freundin einst aus Wien mit-
gebracht. Und Annelise erhob sich mit hastiger Bewegung.
„Ich muß ihm seine Tropfen geben, sonst hat er eine schlechte
Nacht. Die Schwester ist heute nicht gekommen.“
Er seufzte und lächelte, ein wenig verstimmt. „Was hat diese Uhr
für einen häßlichen Schlag!“
„Meine Lieblingsuhr?“
„Ja, der Klang erinnert an die Stimme eines grilligen alten Weibes.
So mißtönend wie heute fand ich sie noch nie.“
XVII.
Curt Brenkhusen legte den Heimweg zu Fuße zurück. Alles in ihm
war wunderlich aufgewühlt, erregt, als ob jeder Nerv ein eignes ge-
steigertes Leben führte. Der Weg durch die kühle Abendluft sollte den
Aufruhr dämpfen. Aber diese feuchte Vorfrühlingsatmosphäre hatte
etwas, das nicht beschwichtigte, das noch mehr aufreizend in das Blut
drang, unerträglich, sehnsuchtweckend. Curt Brenkhusen fühlte sich
seltsam jung, unbegründet jung, als ob er noch das Recht zu heimlicher
Erwartung hätte.
„Es ist spät geworden,“ sagte er zum Stubenmädchen, als er heim-
kehrte, „wartet meine Frau schon mit dem Abendessen auf mich?“
Das Mädchen lächelte. „Gnädige Frau ist selber noch nicht zu
Hause.“
„So?“ Er griff nach den eingegangenen Postsachen, die auf einem
Tisch im Vorsaale bereit lagen. Ein Brief war dabei, der keine Enveloppe
mehr hatte. Curt warf einen Blick auf die festen, kleinen Schriftzüge.
Das war ja wohl die Hand seines Neffen Erich aus Hildesheim. Was
wollte denn der Junge von ihm?
Er ging in sein Arbeitszimmer und setzte sich an den Schreibtisch,
seine Post zu lesen.
Da hörte er Schritte draußen und Fannj's Stimme, die laut und er-
regt klang. „Ja, er muß mir aus der Handtasche gefallen sein. Aber
wo haben Sie ihn denn nur hingelegt, Dora?“
„Zu den übrigen Postsachen, gnädige Frau.“
Jetzt stürzte Fanny herein, noch hastiger, als es sonst ihre Art war.
Curt hatte eben den geöffneten Brief zur Hand genommen.
„Gib her,“ sagte sie, schnell auf ihn zueilend, „der Brief ist für
mich.“
Er stutzte. Sie war ja ganz bleich geworden. Was hatte das zu
bedeuten?
„Der Brief ist doch von Erich“, sagte er, ohne das Billettchen aus
der Hand zu geben.
Das Blut war wieder in ihr Gesicht zurückgekehrt. „Nein, er ist an
mich, ich habe ihn verloren. Gib her. Seit wann liest du denn meine
Briefe gegen meinen Willen?“ Sie stieß es heftig hervor, aber der Ton
war nicht nur ungezogen — heiße Angst klang aus ihm hervor.
Curt sah nach der Unterschrift. „Franz Müller-G.“
„Gib her.“ Sie entriß ihm das Blatt.
Er lehnte sich weit zurück und sah der erregten Frau fest ins Auge.
„Ich wünsche, diesen Brief zu lesen, Fanny.“
Sie schüttelte trotzig den Kopf. „Wozu? Ich lasse mich nicht be-
handeln wie. — wie ein ertapptes Schulmädchen. Meine Briefe gehen
keinen was an wie mich allein.“
„Das ist ein Irrtum“, sagte er streng und erhob sich.
Ein paar Sekunden standen sie sich stumm gegenüber. Dann rief
sie, den Brief auf den Schreibtisch schleudernd: „Ah, so nimm ihn und
lies. Es ist gut, daß es so gekommen ist. Lies nur. Mir ist jetzt alles
gleich.“ Sie blickte ihn an, heftig atmend, ein höhnisches Lächeln um
die Lippen.
des JHerrn r>on J>rßnl|l|usßn.
Von Klaus Rittland (Elisabeth Heinroth)
[Fortsetzung.]
Richtig durchblätterte Anneliese das Buch, das der Freund
ihr gebracht hatte. Ganz weilten ihre Gedanken in diesem
Augenblicke nicht bei den Arkaden und Fensterrosen. Eine
starke heimliche Erregung durchzitterte ihr Wesen. Irgend etwas beein-
flußte sie, so daß sie heute nicht kühl und klar denken konnte. Viel-
leicht das erste Grüßen des Frühlings, diese feuchtwarme Tauluft, die
vom Garten hereindrang — oder der starke Hyazinthenduft; sie liebte
die Hyazinthen, aber der Duft wirkte zu stark auf ihre Nerven, schmerz-
lich süß, beängstigend — ein Sehnen kam über sie, das ihr die Tränen
in die Augen trieb — leidenschaftliches Verlangen, und doch eine heim-
liche Angst vor dem Leben, vor allem.
„Kinder sind wir mit unserm Phantasiespiele,“ sagte sie lächelnd,
während sie beklommen aufatmete, „ich glaube noch nicht daran, daß
wir jemals miteinander vor der Kathedrale zu Rheims stehen werden.
Es ist nicht weise, sich so tief in schöne Möglichkeiten hineinzuarbeiten.
Die Enttäuschung tut dann zu weh, und die törichten Kinder stehen da
und heulen vor dem eingestürzten Kartenhaus.“
„Es hängt doch nur von uns ab“, wandte er zögernd ein.
Aber sie schütteltte den Kopf. „O nein, auch von andern. Sie vor
allem, Brenkhusen, glauben Sie denn, daß Sie ein freier Mensch sind?
Jetzt meinen Sie, alles ist ganz glatt und einfach. Aber das ist ein Irr-
tum. Sie werden nie Ihren eignen Weg gehen, und sei’s auch nur ein
kurzer, flüchtiger — wenn auf der andern Wegseite jemand steht und
wartet, jemand, der ein Recht auf Sie hat. — In Ihnen steckt eine zu
tiefwurzelnde Achtung vor Rechten.“
Annelise wußte, daß ihre Worte ihn reizen würden. Aber sie wollte
ihn reizen. Eva, die unsterbliche —
Finster zog er die Augenbrauen zusammen. Er antwortete nicht
gleich; denn er wußte, daß sie nicht Unwahres sprach; sie kannte ihn —
manchmal erkannte sie das, was in ihm lebte, eher, als es ihm selber zu
klarem Bewußtsein wurde.
Und dennoch — in diesem Augenblicke fühlte er, daß jener Grund-
ton seines Wesens, der strenge Sinn für Ordnung, Recht und Billigkeit,
kein alles durchdringender war, daß er wohl übertönt werden mochte
durch stärkere Klänge.
Diese stille Dämmerstunde trug heimliche Fieberglut in sich, ihr
sanftes Traumweben log; es überdeckte heißes, lebendigstes Leben, un-
gestüm drängende Wirklichkeiten; schmerzvolle Klarheit leuchtete auf in
Gurt Brenkhusens Seele — schmerzvoll und doch heiß beglückend, be-
freiend: er wußte jetzt, daß seine Freundschaft für Annelise den Namen
Freundschaft nicht mehr verdiente, daß sie in seiner Seele sich ge-
wandelt hatte, längst schon, in ein anderes, vollblütigeres — übermäch-
tiges Gefühl — —
Er drückte seine Hand gegen die Schläfen und schloß für eine kurze
WTeile die Augen.
„Rechte, Pflichten, Rücksichten,“ sagte er halblaut vor sich hin, mit
gepreßter Stimme, „wie das alles sich um uns auftürmt, unser Eigenstes
überwuchert, erstickt — ah, warum muß das so sein?“ Heftig stieß er
es hervor; leidenschaftlicher Unwillen, Sehnsucht, stürmisches Verlangen
klang aus diesem heftigen Tone heraus. „Warum läßt man das Leben
so geduldig vorübergleiten, im Sande verrinnen, das unersetzliche, kost-
bare Leben?“
Seine Augen öffneten sich und suchten die geliebte Frau.
Sie hatte den Kopf zur Seite gewandt, aber er konnte doch sehen,
was er nicht sehen sollte; die Tränen, die aus ihren Augen niederfielen.
Weshalb sie weinte? Sie hätte es keinem erklären können. Es war
nicht Kummer — nur Mitleid mit sich selber, mit ihrer Liebe, aber ein
Mitleid, das innigste, schmerzliche Süßigkeit barg.
„Annelise, liebe, liebe Frau!“ Er. zog ihre Hand an sich und küßte
lange, zärtlich diese feinen Finger, die sich mit leidenschaftlichem Druck
um die seinen schlossen.
Copyright 1913 bv Rieh. Bong.
Da ertönte die feine, piepende Stimme der alten Uhr, die auf dem
Kaminsims stand — einer echten, alten Stutzuhr aus dem achtzehnten
Jahrhundert; Brenkhusen hatte sie der Freundin einst aus Wien mit-
gebracht. Und Annelise erhob sich mit hastiger Bewegung.
„Ich muß ihm seine Tropfen geben, sonst hat er eine schlechte
Nacht. Die Schwester ist heute nicht gekommen.“
Er seufzte und lächelte, ein wenig verstimmt. „Was hat diese Uhr
für einen häßlichen Schlag!“
„Meine Lieblingsuhr?“
„Ja, der Klang erinnert an die Stimme eines grilligen alten Weibes.
So mißtönend wie heute fand ich sie noch nie.“
XVII.
Curt Brenkhusen legte den Heimweg zu Fuße zurück. Alles in ihm
war wunderlich aufgewühlt, erregt, als ob jeder Nerv ein eignes ge-
steigertes Leben führte. Der Weg durch die kühle Abendluft sollte den
Aufruhr dämpfen. Aber diese feuchte Vorfrühlingsatmosphäre hatte
etwas, das nicht beschwichtigte, das noch mehr aufreizend in das Blut
drang, unerträglich, sehnsuchtweckend. Curt Brenkhusen fühlte sich
seltsam jung, unbegründet jung, als ob er noch das Recht zu heimlicher
Erwartung hätte.
„Es ist spät geworden,“ sagte er zum Stubenmädchen, als er heim-
kehrte, „wartet meine Frau schon mit dem Abendessen auf mich?“
Das Mädchen lächelte. „Gnädige Frau ist selber noch nicht zu
Hause.“
„So?“ Er griff nach den eingegangenen Postsachen, die auf einem
Tisch im Vorsaale bereit lagen. Ein Brief war dabei, der keine Enveloppe
mehr hatte. Curt warf einen Blick auf die festen, kleinen Schriftzüge.
Das war ja wohl die Hand seines Neffen Erich aus Hildesheim. Was
wollte denn der Junge von ihm?
Er ging in sein Arbeitszimmer und setzte sich an den Schreibtisch,
seine Post zu lesen.
Da hörte er Schritte draußen und Fannj's Stimme, die laut und er-
regt klang. „Ja, er muß mir aus der Handtasche gefallen sein. Aber
wo haben Sie ihn denn nur hingelegt, Dora?“
„Zu den übrigen Postsachen, gnädige Frau.“
Jetzt stürzte Fanny herein, noch hastiger, als es sonst ihre Art war.
Curt hatte eben den geöffneten Brief zur Hand genommen.
„Gib her,“ sagte sie, schnell auf ihn zueilend, „der Brief ist für
mich.“
Er stutzte. Sie war ja ganz bleich geworden. Was hatte das zu
bedeuten?
„Der Brief ist doch von Erich“, sagte er, ohne das Billettchen aus
der Hand zu geben.
Das Blut war wieder in ihr Gesicht zurückgekehrt. „Nein, er ist an
mich, ich habe ihn verloren. Gib her. Seit wann liest du denn meine
Briefe gegen meinen Willen?“ Sie stieß es heftig hervor, aber der Ton
war nicht nur ungezogen — heiße Angst klang aus ihm hervor.
Curt sah nach der Unterschrift. „Franz Müller-G.“
„Gib her.“ Sie entriß ihm das Blatt.
Er lehnte sich weit zurück und sah der erregten Frau fest ins Auge.
„Ich wünsche, diesen Brief zu lesen, Fanny.“
Sie schüttelte trotzig den Kopf. „Wozu? Ich lasse mich nicht be-
handeln wie. — wie ein ertapptes Schulmädchen. Meine Briefe gehen
keinen was an wie mich allein.“
„Das ist ein Irrtum“, sagte er streng und erhob sich.
Ein paar Sekunden standen sie sich stumm gegenüber. Dann rief
sie, den Brief auf den Schreibtisch schleudernd: „Ah, so nimm ihn und
lies. Es ist gut, daß es so gekommen ist. Lies nur. Mir ist jetzt alles
gleich.“ Sie blickte ihn an, heftig atmend, ein höhnisches Lächeln um
die Lippen.