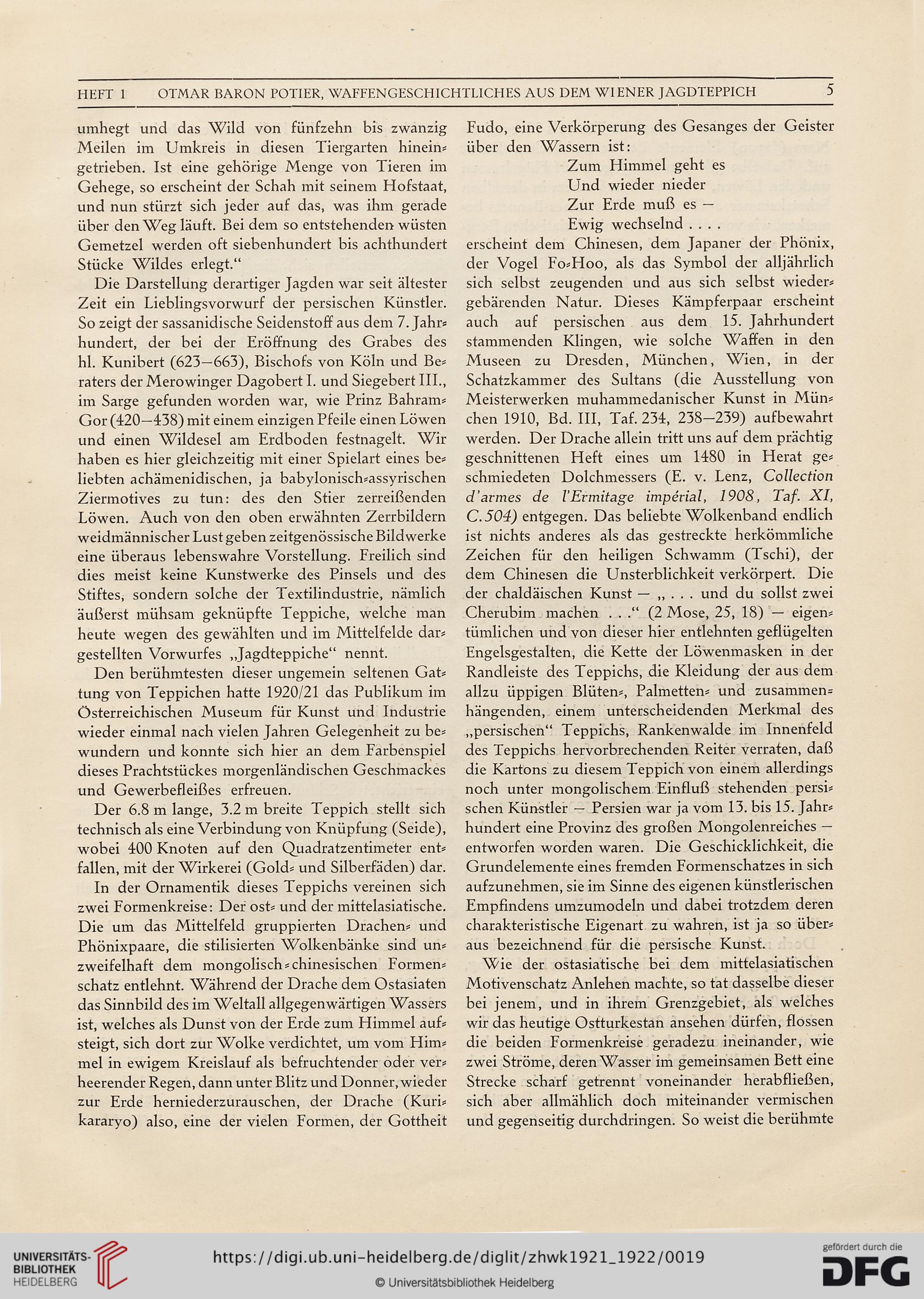HEFT 1
OTMAR BARON POTIER, WAFFENGESCHICHTLICHES AUS DEM WIENER JAGDTEPPICH
5
umhegt und das Wild von fünfzehn bis zwanzig
Meilen im Umkreis in diesen Tiergarten hinein*
getrieben. Ist eine gehörige Menge von Tieren im
Gehege, so erscheint der Schah mit seinem Hofstaat,
und nun stürzt sich jeder auf das, was ihm gerade
über den Weg läuft. Bei dem so entstehenden wüsten
Gemetzel werden oft siebenhundert bis achthundert
Stücke Wildes erlegt.“
Die Darstellung derartiger Jagden war seit ältester
Zeit ein Lieblingsvorwurf der persischen Künstler.
So zeigt der sassanidische Seidenstoff aus dem 7. Jahr*
hundert, der bei der Eröffnung des Grabes des
hl. Kunibert (623—663), Bischofs von Köln und Be*
raters der Merowinger Dagobert I. und Siegebert III.,
im Sarge gefunden worden war, wie Prinz Bahram*
Gor (420—438) mit einem einzigen Pfeile einen Löwen
und einen Wildesel am Erdboden festnagelt. Wir
haben es hier gleichzeitig mit einer Spielart eines be*
liebten achämenidischen, ja babylonisch*assyrischen
Ziermotives zu tun: des den Stier zerreißenden
Löwen. Auch von den oben erwähnten Zerrbildern
weidmännischer Lust geben zeitgenössische Bildwerke
eine überaus lebenswahre Vorstellung. Freilich sind
dies meist keine Kunstwerke des Pinsels und des
Stiftes, sondern solche der Textilindustrie, nämlich
äußerst mühsam geknüpfte Teppiche, welche man
heute wegen des gewählten und im Mittelfelde dar*
gestellten Vorwurfes „Jagdteppiche“ nennt.
Den berühmtesten dieser ungemein seltenen Gat*
tung von Teppichen hatte 1920/21 das Publikum im
Österreichischen Museum für Kunst und Industrie
wieder einmal nach vielen Jahren Gelegenheit zu be*
wundern und konnte sich hier an dem Farbenspiel
dieses Prachtstückes morgenländischen Geschmackes
und Gewerbefleißes erfreuen.
Der 6.8 m lange, 3.2 m breite Teppich stellt sich
technisch als eine Verbindung von Knüpfung (Seide),
wobei 400 Knoten auf den Quadratzentimeter ent*
fallen, mit der Wirkerei (Gold* und Silberfäden) dar.
In der Ornamentik dieses Teppichs vereinen sich
zwei Formenkreise: Der ost* und der mittelasiatische.
Die um das Mittelfeld gruppierten Drachen* und
Phönixpaare, die stilisierten Wolkenbänke sind un*
zweifelhaft dem mongolisch*chinesischen Formen*
schätz entlehnt. Während der Drache dem Ostasiaten
das Sinnbild des im Weltall allgegenwärtigen Wassers
ist, welches als Dunst von der Erde zum Himmel auf*
steigt, sich dort zur Wolke verdichtet, um vom Hirn*
mel in ewigem Kreislauf als befruchtender oder ver*
heerender Regen, dann unter Blitz und Donner, wieder
zur Erde herniederzurauschen, der Drache (Kuri*
kararyo) also, eine der vielen Formen, der Gottheit
Fudo, eine Verkörperung des Gesanges der Geister
über den Wassern ist:
Zum Himmel geht es
Und wieder nieder
Zur Erde muß es —
Ewig wechselnd ....
erscheint dem Chinesen, dem Japaner der Phönix,
der Vogel Fo*Hoo, als das Symbol der alljährlich
sich selbst zeugenden und aus sich selbst wieder*
gebärenden Natur. Dieses Kämpferpaar erscheint
auch auf persischen aus dem 15. Jahrhundert
stammenden Klingen, wie solche Waffen in den
Museen zu Dresden, München, Wien, in der
Schatzkammer des Sultans (die Ausstellung von
Meisterwerken muhammedanischer Kunst in Mün*
chen 1910, Bd. III, Taf. 234, 238-239) aufbewahrt
werden. Der Drache allein tritt uns auf dem prächtig
geschnittenen Heft eines um 1480 in Herat ge*
schmiedeten Dolchmessers (E. v. Lenz, Collection
d'armes de 1’Ermitage imperial, 1908, Taf. XI,
C.504) entgegen. Das beliebte Wolkenband endlich
ist nichts anderes als das gestreckte herkömmliche
Zeichen für den heiligen Schwamm (Tschi), der
dem Chinesen die Unsterblichkeit verkörpert. Die
der chaldäischen Kunst — „ . . . und du sollst zwei
Cherubim machen . . .“ (2 Mose, 25, 18) — eigen*
tümlichen und von dieser hier entlehnten geflügelten
Engelsgestalten, die Kette der Löwenmasken in der
Randleiste des Teppichs, die Kleidung der aus dem
allzu üppigen Blüten*, Palmetten* und zusammen*
hängenden, einem unterscheidenden Merkmal des
„persischen“ Teppichs, Rankenwalde im Innenfeld
des Teppichs hervorbrechenden Reiter verraten, daß
die Kartons zu diesem Teppich von einem allerdings
noch unter mongolischem Einfluß stehenden persi*
sehen Künstler — Persien war ja vom 13. bis 15. Jahr*
hundert eine Provinz des großen Mongolenreiches —
entworfen worden waren. Die Geschicklichkeit, die
Grundelemente eines fremden Formenschatzes in sich
aufzunehmen, sie im Sinne des eigenen künstlerischen
Empfindens umzumodeln und dabei trotzdem deren
charakteristische Eigenart zu wahren, ist ja so über*
aus bezeichnend für die persische Kunst.
Wie der ostasiatische bei dem mittelasiatischen
Motivenschatz Anlehen machte, so tat dasselbe dieser
bei jenem, und in ihrem Grenzgebiet, als welches
wir das heutige Ostturkestan ansehen dürfen, flössen
die beiden Formenkreise geradezu ineinander, wie
zwei Ströme, deren Wasser im gemeinsamen Bett eine
Strecke scharf getrennt voneinander herabfließen,
sich aber allmählich doch miteinander vermischen
und gegenseitig durchdringen. So weist die berühmte
OTMAR BARON POTIER, WAFFENGESCHICHTLICHES AUS DEM WIENER JAGDTEPPICH
5
umhegt und das Wild von fünfzehn bis zwanzig
Meilen im Umkreis in diesen Tiergarten hinein*
getrieben. Ist eine gehörige Menge von Tieren im
Gehege, so erscheint der Schah mit seinem Hofstaat,
und nun stürzt sich jeder auf das, was ihm gerade
über den Weg läuft. Bei dem so entstehenden wüsten
Gemetzel werden oft siebenhundert bis achthundert
Stücke Wildes erlegt.“
Die Darstellung derartiger Jagden war seit ältester
Zeit ein Lieblingsvorwurf der persischen Künstler.
So zeigt der sassanidische Seidenstoff aus dem 7. Jahr*
hundert, der bei der Eröffnung des Grabes des
hl. Kunibert (623—663), Bischofs von Köln und Be*
raters der Merowinger Dagobert I. und Siegebert III.,
im Sarge gefunden worden war, wie Prinz Bahram*
Gor (420—438) mit einem einzigen Pfeile einen Löwen
und einen Wildesel am Erdboden festnagelt. Wir
haben es hier gleichzeitig mit einer Spielart eines be*
liebten achämenidischen, ja babylonisch*assyrischen
Ziermotives zu tun: des den Stier zerreißenden
Löwen. Auch von den oben erwähnten Zerrbildern
weidmännischer Lust geben zeitgenössische Bildwerke
eine überaus lebenswahre Vorstellung. Freilich sind
dies meist keine Kunstwerke des Pinsels und des
Stiftes, sondern solche der Textilindustrie, nämlich
äußerst mühsam geknüpfte Teppiche, welche man
heute wegen des gewählten und im Mittelfelde dar*
gestellten Vorwurfes „Jagdteppiche“ nennt.
Den berühmtesten dieser ungemein seltenen Gat*
tung von Teppichen hatte 1920/21 das Publikum im
Österreichischen Museum für Kunst und Industrie
wieder einmal nach vielen Jahren Gelegenheit zu be*
wundern und konnte sich hier an dem Farbenspiel
dieses Prachtstückes morgenländischen Geschmackes
und Gewerbefleißes erfreuen.
Der 6.8 m lange, 3.2 m breite Teppich stellt sich
technisch als eine Verbindung von Knüpfung (Seide),
wobei 400 Knoten auf den Quadratzentimeter ent*
fallen, mit der Wirkerei (Gold* und Silberfäden) dar.
In der Ornamentik dieses Teppichs vereinen sich
zwei Formenkreise: Der ost* und der mittelasiatische.
Die um das Mittelfeld gruppierten Drachen* und
Phönixpaare, die stilisierten Wolkenbänke sind un*
zweifelhaft dem mongolisch*chinesischen Formen*
schätz entlehnt. Während der Drache dem Ostasiaten
das Sinnbild des im Weltall allgegenwärtigen Wassers
ist, welches als Dunst von der Erde zum Himmel auf*
steigt, sich dort zur Wolke verdichtet, um vom Hirn*
mel in ewigem Kreislauf als befruchtender oder ver*
heerender Regen, dann unter Blitz und Donner, wieder
zur Erde herniederzurauschen, der Drache (Kuri*
kararyo) also, eine der vielen Formen, der Gottheit
Fudo, eine Verkörperung des Gesanges der Geister
über den Wassern ist:
Zum Himmel geht es
Und wieder nieder
Zur Erde muß es —
Ewig wechselnd ....
erscheint dem Chinesen, dem Japaner der Phönix,
der Vogel Fo*Hoo, als das Symbol der alljährlich
sich selbst zeugenden und aus sich selbst wieder*
gebärenden Natur. Dieses Kämpferpaar erscheint
auch auf persischen aus dem 15. Jahrhundert
stammenden Klingen, wie solche Waffen in den
Museen zu Dresden, München, Wien, in der
Schatzkammer des Sultans (die Ausstellung von
Meisterwerken muhammedanischer Kunst in Mün*
chen 1910, Bd. III, Taf. 234, 238-239) aufbewahrt
werden. Der Drache allein tritt uns auf dem prächtig
geschnittenen Heft eines um 1480 in Herat ge*
schmiedeten Dolchmessers (E. v. Lenz, Collection
d'armes de 1’Ermitage imperial, 1908, Taf. XI,
C.504) entgegen. Das beliebte Wolkenband endlich
ist nichts anderes als das gestreckte herkömmliche
Zeichen für den heiligen Schwamm (Tschi), der
dem Chinesen die Unsterblichkeit verkörpert. Die
der chaldäischen Kunst — „ . . . und du sollst zwei
Cherubim machen . . .“ (2 Mose, 25, 18) — eigen*
tümlichen und von dieser hier entlehnten geflügelten
Engelsgestalten, die Kette der Löwenmasken in der
Randleiste des Teppichs, die Kleidung der aus dem
allzu üppigen Blüten*, Palmetten* und zusammen*
hängenden, einem unterscheidenden Merkmal des
„persischen“ Teppichs, Rankenwalde im Innenfeld
des Teppichs hervorbrechenden Reiter verraten, daß
die Kartons zu diesem Teppich von einem allerdings
noch unter mongolischem Einfluß stehenden persi*
sehen Künstler — Persien war ja vom 13. bis 15. Jahr*
hundert eine Provinz des großen Mongolenreiches —
entworfen worden waren. Die Geschicklichkeit, die
Grundelemente eines fremden Formenschatzes in sich
aufzunehmen, sie im Sinne des eigenen künstlerischen
Empfindens umzumodeln und dabei trotzdem deren
charakteristische Eigenart zu wahren, ist ja so über*
aus bezeichnend für die persische Kunst.
Wie der ostasiatische bei dem mittelasiatischen
Motivenschatz Anlehen machte, so tat dasselbe dieser
bei jenem, und in ihrem Grenzgebiet, als welches
wir das heutige Ostturkestan ansehen dürfen, flössen
die beiden Formenkreise geradezu ineinander, wie
zwei Ströme, deren Wasser im gemeinsamen Bett eine
Strecke scharf getrennt voneinander herabfließen,
sich aber allmählich doch miteinander vermischen
und gegenseitig durchdringen. So weist die berühmte