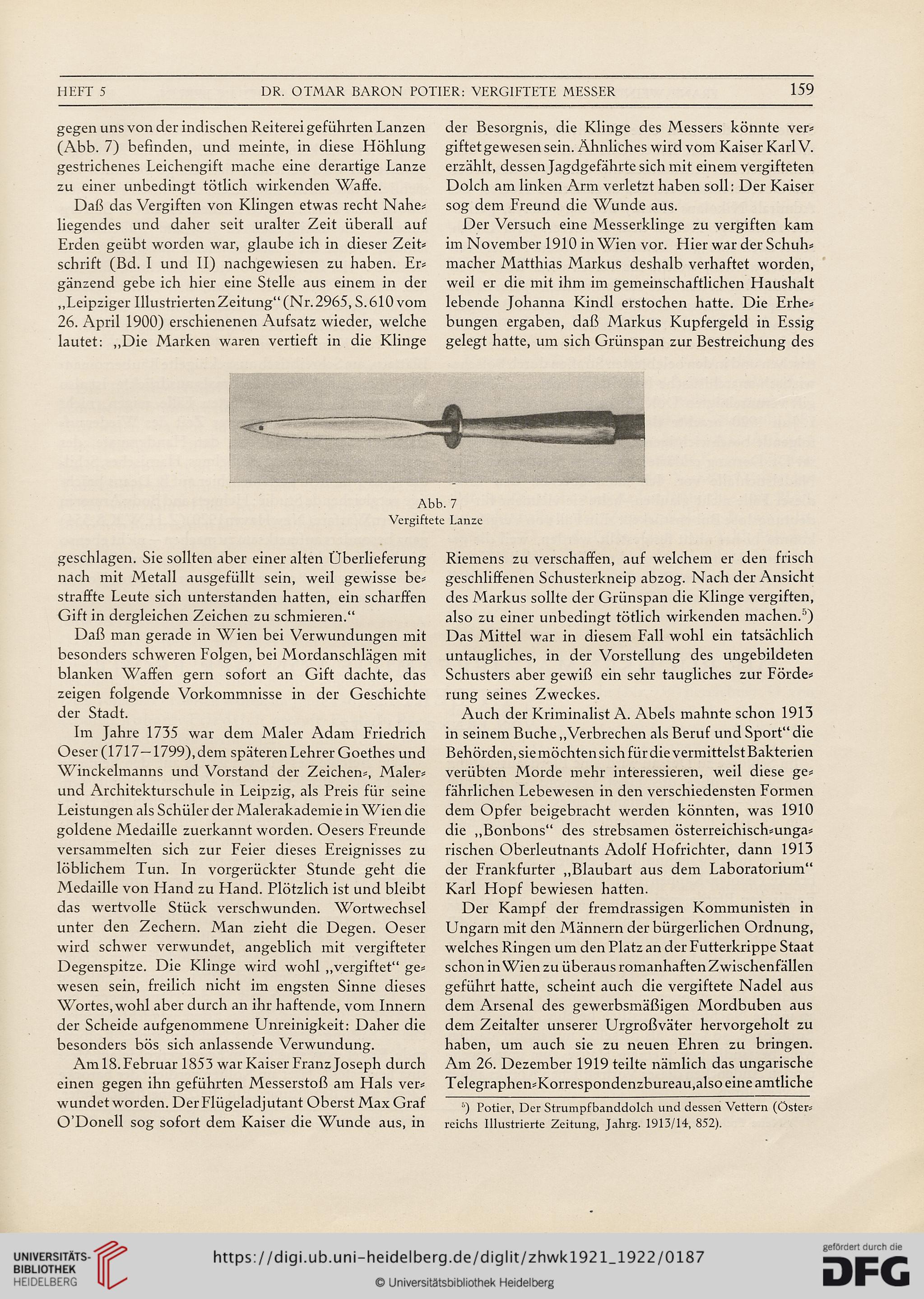HEFT 5
DR. OTMAR BARON POTIER: VERGIFTETE MESSER
159
gegen uns von der indischen Reiterei geführten Lanzen
(Abb. 7) befinden, und meinte, in diese Höhlung
gestrichenes Leichengift mache eine derartige Lanze
zu einer unbedingt tötlich wirkenden Waffe.
Daß das Vergiften von Klingen etwas recht Nahes
liegendes und daher seit uralter Zeit überall auf
Erden geübt worden war, glaube ich in dieser Zeit*
schrift (Bd. I und II) nachgewiesen zu haben. Er*
gänzend gebe ich hier eine Stelle aus einem in der
„Leipziger Illustrierten Zeitung“ (Nr. 2965, S. 610 vom
26. April 1900) erschienenen Aufsatz wieder, welche
lautet: „Die Marken waren vertieft in die Klinge
der Besorgnis, die Klinge des Messers könnte ver*
giftet gewesen sein. Ähnliches wird vom Kaiser Karl V.
erzählt, dessen Jagdgefährte sich mit einem vergifteten
Dolch am linken Arm verletzt haben soll: Der Kaiser
sog dem Freund die Wunde aus.
Der Versuch eine Messerklinge zu vergiften kam
im November 1910 in Wien vor. Hier war der Schuh*
macher Matthias Markus deshalb verhaftet worden,
weil er die mit ihm im gemeinschaftlichen Haushalt
lebende Johanna Kindl erstochen hatte. Die Erhe*
bungen ergaben, daß Markus Kupfergeld in Essig
gelegt hatte, um sich Grünspan zur Bestreichung des
Abb. 7
Vergiftete Lanze
geschlagen. Sie sollten aber einer alten Überlieferung
nach mit Metall ausgefüllt sein, weil gewisse be*
straffte Leute sich unterstanden hatten, ein scharffen
Gift in dergleichen Zeichen zu schmieren.“
Daß man gerade in Wien bei Verwundungen mit
besonders schweren Folgen, bei Mordanschlägen mit
blanken Waffen gern sofort an Gift dachte, das
zeigen folgende Vorkommnisse in der Geschichte
der Stadt.
Im Jahre 1735 war dem Maler Adam Friedrich
Oeser (1717—1799), dem späteren Lehrer Goethes und
Winckelmanns und Vorstand der Zeichen*, Maler*
und Architekturschule in Leipzig, als Preis für seine
Leistungen als Schüler der Malerakademie in Wien die
goldene Medaille zuerkannt worden. Oesers Freunde
versammelten sich zur Feier dieses Ereignisses zu
löblichem Tun. In vorgerückter Stunde geht die
Medaille von Hand zu Hand. Plötzlich ist und bleibt
das wertvolle Stück verschwunden. Wortwechsel
unter den Zechern. Man zieht die Degen. Oeser
wird schwer verwundet, angeblich mit vergifteter
Degenspitze. Die Klinge wird wohl „vergiftet“ ge*
wesen sein, freilich nicht im engsten Sinne dieses
Wortes, wohl aber durch an ihr haftende, vom Innern
der Scheide aufgenommene Unreinigkeit: Daher die
besonders bös sich anlassende Verwundung.
Am 18. Februar 1853 war Kaiser Franz Joseph durch
einen gegen ihn geführten Messerstoß am Hals ver*
wundet worden. Der Flügeladjutant Oberst Max Graf
O’Donell sog sofort dem Kaiser die Wunde aus, in
Riemens zu verschaffen, auf welchem er den frisch
geschliffenen Schusterkneip abzog. Nach der Ansicht
des Markus sollte der Grünspan die Klinge vergiften,
also zu einer unbedingt tötlich wirkenden machen.0)
Das Mittel war in diesem Fall wohl ein tatsächlich
untaugliches, in der Vorstellung des ungebildeten
Schusters aber gewiß ein sehr taugliches zur Förde*
rung seines Zweckes.
Auch der Kriminalist A. Abels mahnte schon 1913
in seinem Buche „Verbrechen als Beruf und Sport“ die
Behörden, sie möchten sich für die vermittelst Bakterien
verübten Morde mehr interessieren, weil diese ge*
fährlichen Lebewesen in den verschiedensten Formen
dem Opfer beigebracht werden könnten, was 1910
die „Bonbons“ des strebsamen österreichisch*unga*
rischen Oberleutnants Adolf Hofrichter, dann 1913
der Frankfurter „Blaubart aus dem Laboratorium“
Karl Hopf bewiesen hatten.
Der Kampf der fremdrassigen Kommunisten in
Ungarn mit den Männern der bürgerlichen Ordnung,
welches Ringen um den Platz an der Futterkrippe Staat
schon in Wien zu überaus romanhaften Zwischenfällen
geführt hatte, scheint auch die vergiftete Nadel aus
dem Arsenal des gewerbsmäßigen Mordbuben aus
dem Zeitalter unserer Urgroßväter hervorgeholt zu
haben, um auch sie zu neuen Ehren zu bringen.
Am 26. Dezember 1919 teilte nämlich das ungarische
Telegraphen*Korrespondenzbureau,also eine amtliche
6) Potier, Der Strumpfbanddolch und dessen Vettern (Öster*
reichs Illustrierte Zeitung, Jahrg. 1913/14, 852).
DR. OTMAR BARON POTIER: VERGIFTETE MESSER
159
gegen uns von der indischen Reiterei geführten Lanzen
(Abb. 7) befinden, und meinte, in diese Höhlung
gestrichenes Leichengift mache eine derartige Lanze
zu einer unbedingt tötlich wirkenden Waffe.
Daß das Vergiften von Klingen etwas recht Nahes
liegendes und daher seit uralter Zeit überall auf
Erden geübt worden war, glaube ich in dieser Zeit*
schrift (Bd. I und II) nachgewiesen zu haben. Er*
gänzend gebe ich hier eine Stelle aus einem in der
„Leipziger Illustrierten Zeitung“ (Nr. 2965, S. 610 vom
26. April 1900) erschienenen Aufsatz wieder, welche
lautet: „Die Marken waren vertieft in die Klinge
der Besorgnis, die Klinge des Messers könnte ver*
giftet gewesen sein. Ähnliches wird vom Kaiser Karl V.
erzählt, dessen Jagdgefährte sich mit einem vergifteten
Dolch am linken Arm verletzt haben soll: Der Kaiser
sog dem Freund die Wunde aus.
Der Versuch eine Messerklinge zu vergiften kam
im November 1910 in Wien vor. Hier war der Schuh*
macher Matthias Markus deshalb verhaftet worden,
weil er die mit ihm im gemeinschaftlichen Haushalt
lebende Johanna Kindl erstochen hatte. Die Erhe*
bungen ergaben, daß Markus Kupfergeld in Essig
gelegt hatte, um sich Grünspan zur Bestreichung des
Abb. 7
Vergiftete Lanze
geschlagen. Sie sollten aber einer alten Überlieferung
nach mit Metall ausgefüllt sein, weil gewisse be*
straffte Leute sich unterstanden hatten, ein scharffen
Gift in dergleichen Zeichen zu schmieren.“
Daß man gerade in Wien bei Verwundungen mit
besonders schweren Folgen, bei Mordanschlägen mit
blanken Waffen gern sofort an Gift dachte, das
zeigen folgende Vorkommnisse in der Geschichte
der Stadt.
Im Jahre 1735 war dem Maler Adam Friedrich
Oeser (1717—1799), dem späteren Lehrer Goethes und
Winckelmanns und Vorstand der Zeichen*, Maler*
und Architekturschule in Leipzig, als Preis für seine
Leistungen als Schüler der Malerakademie in Wien die
goldene Medaille zuerkannt worden. Oesers Freunde
versammelten sich zur Feier dieses Ereignisses zu
löblichem Tun. In vorgerückter Stunde geht die
Medaille von Hand zu Hand. Plötzlich ist und bleibt
das wertvolle Stück verschwunden. Wortwechsel
unter den Zechern. Man zieht die Degen. Oeser
wird schwer verwundet, angeblich mit vergifteter
Degenspitze. Die Klinge wird wohl „vergiftet“ ge*
wesen sein, freilich nicht im engsten Sinne dieses
Wortes, wohl aber durch an ihr haftende, vom Innern
der Scheide aufgenommene Unreinigkeit: Daher die
besonders bös sich anlassende Verwundung.
Am 18. Februar 1853 war Kaiser Franz Joseph durch
einen gegen ihn geführten Messerstoß am Hals ver*
wundet worden. Der Flügeladjutant Oberst Max Graf
O’Donell sog sofort dem Kaiser die Wunde aus, in
Riemens zu verschaffen, auf welchem er den frisch
geschliffenen Schusterkneip abzog. Nach der Ansicht
des Markus sollte der Grünspan die Klinge vergiften,
also zu einer unbedingt tötlich wirkenden machen.0)
Das Mittel war in diesem Fall wohl ein tatsächlich
untaugliches, in der Vorstellung des ungebildeten
Schusters aber gewiß ein sehr taugliches zur Förde*
rung seines Zweckes.
Auch der Kriminalist A. Abels mahnte schon 1913
in seinem Buche „Verbrechen als Beruf und Sport“ die
Behörden, sie möchten sich für die vermittelst Bakterien
verübten Morde mehr interessieren, weil diese ge*
fährlichen Lebewesen in den verschiedensten Formen
dem Opfer beigebracht werden könnten, was 1910
die „Bonbons“ des strebsamen österreichisch*unga*
rischen Oberleutnants Adolf Hofrichter, dann 1913
der Frankfurter „Blaubart aus dem Laboratorium“
Karl Hopf bewiesen hatten.
Der Kampf der fremdrassigen Kommunisten in
Ungarn mit den Männern der bürgerlichen Ordnung,
welches Ringen um den Platz an der Futterkrippe Staat
schon in Wien zu überaus romanhaften Zwischenfällen
geführt hatte, scheint auch die vergiftete Nadel aus
dem Arsenal des gewerbsmäßigen Mordbuben aus
dem Zeitalter unserer Urgroßväter hervorgeholt zu
haben, um auch sie zu neuen Ehren zu bringen.
Am 26. Dezember 1919 teilte nämlich das ungarische
Telegraphen*Korrespondenzbureau,also eine amtliche
6) Potier, Der Strumpfbanddolch und dessen Vettern (Öster*
reichs Illustrierte Zeitung, Jahrg. 1913/14, 852).