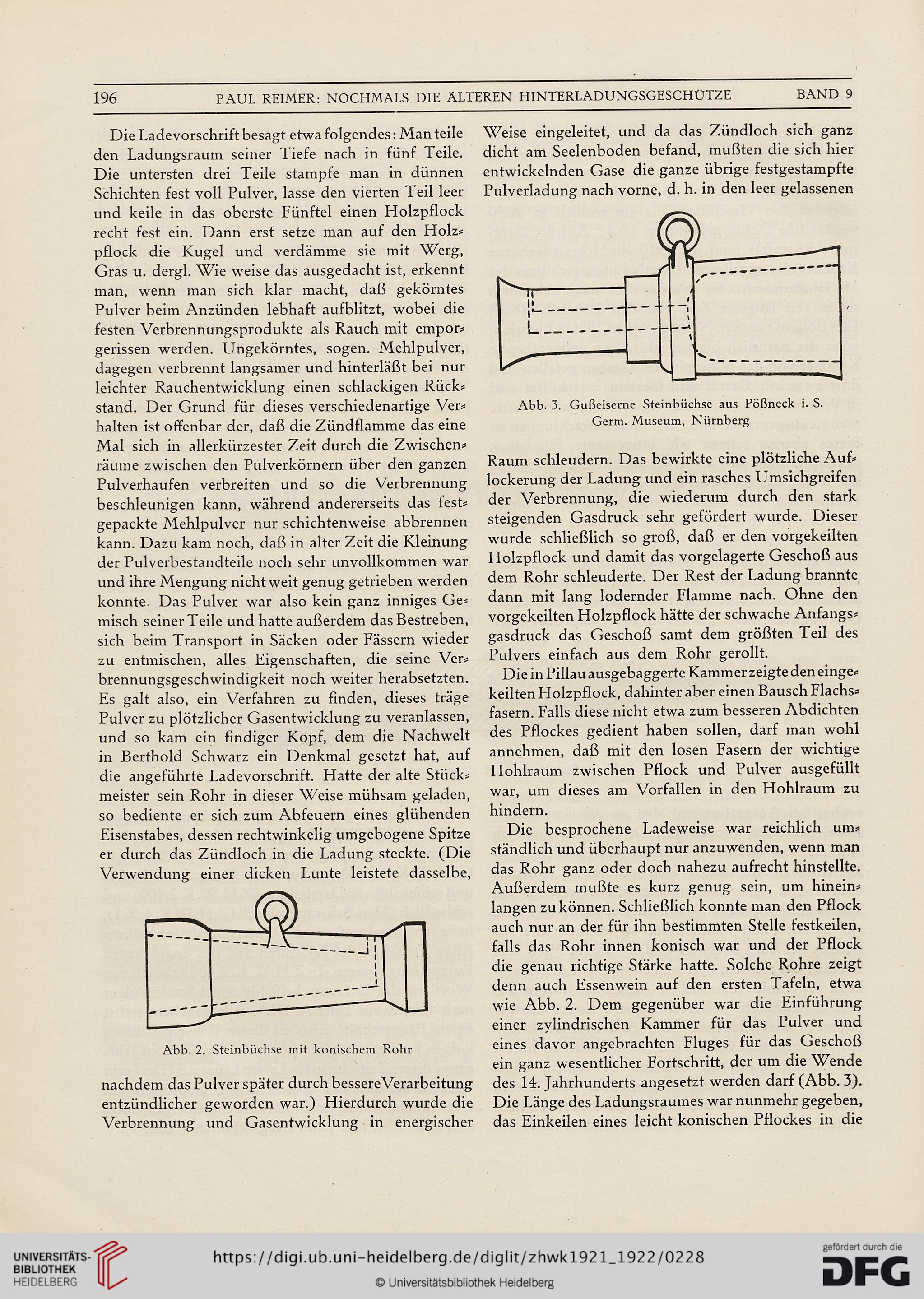196
PAUL REIMER: NOCHMALS DIE ÄLTEREN HINTERLADUNGSGESCHÜTZE
BAND 9
Die Ladevorschrift besagt etwa folgendes: Man teile
den Ladungsraum seiner Tiefe nach in fünf Teile.
Die untersten drei Teile stampfe man in dünnen
Schichten fest voll Pulver, lasse den vierten Teil leer
und keile in das oberste Fünftel einen Holzpflock
recht fest ein. Dann erst setze man auf den Holz«
pflock die Kugel und verdamme sie mit Werg,
Gras u. dergl. Wie weise das ausgedacht ist, erkennt
man, wenn man sich klar macht, daß gekörntes
Pulver beim Anzünden lebhaft aufblitzt, wobei die
festen Verbrennungsprodukte als Rauch mit empor«
gerissen werden. Ungekörntes, sogen. Mehlpulver,
dagegen verbrennt langsamer und hinterläßt bei nur
leichter Rauchentwicklung einen schlackigen Rück«
stand. Der Grund für dieses verschiedenartige Ver«
halten ist offenbar der, daß die Zündflamme das eine
Mal sich in allerkürzester Zeit durch die Zwischen«
räume zwischen den Pulverkörnern über den ganzen
Pulverhaufen verbreiten und so die Verbrennung
beschleunigen kann, während andererseits das fest«
gepackte Mehlpulver nur schichtenweise abbrennen
kann. Dazu kam noch, daß in alter Zeit die Kleinung
der Pulverbestandteile noch sehr unvollkommen war
und ihre Mengung nicht weit genug getrieben werden
konnte. Das Pulver war also kein ganz inniges Ge«
misch seiner Teile und hatte außerdem das Bestreben,
sich beim Transport in Säcken oder Fässern wieder
zu entmischen, alles Eigenschaften, die seine Ver«
brennungsgeschwindigkeit noch weiter herabsetzten.
Es galt also, ein Verfahren zu finden, dieses träge
Pulver zu plötzlicher Gasentwicklung zu veranlassen,
und so kam ein findiger Kopf, dem die Nachwelt
in Berthold Schwarz ein Denkmal gesetzt hat, auf
die angeführte Ladevorschrift. Hatte der alte Stück«
meister sein Rohr in dieser Weise mühsam geladen,
so bediente er sich zum Abfeuern eines glühenden
Eisenstabes, dessen rechtwinkelig umgebogene Spitze
er durch das Zündloch in die Ladung steckte. (Die
Verwendung einer dicken Lunte leistete dasselbe,
Abb. 2. Steinbüchse mit konischem Rohr
nachdem das Pulver später durch bessere Verarbeitung
entzündlicher geworden war.) Hierdurch wurde die
Verbrennung und Gasentwicklung in energischer
Weise eingeleitet, und da das Zündloch sich ganz
dicht am Seelenboden befand, mußten die sich hier
entwickelnden Gase die ganze übrige festgestampfte
Pulverladung nach vorne, d. h. in den leer gelassenen
Abb. 3. Gußeiserne Steinbüchse aus Pößneck i. S.
Germ. Museum, Nürnberg
Raum schleudern. Das bewirkte eine plötzliche Auf«
lockerung der Ladung und ein rasches Umsichgreifen
der Verbrennung, die wiederum durch den stark
steigenden Gasdruck sehr gefördert wurde. Dieser
wurde schließlich so groß, daß er den vorgekeilten
Holzpflock und damit das vorgelagerte Geschoß aus
dem Rohr schleuderte. Der Rest der Ladung brannte
dann mit lang lodernder Flamme nach. Ohne den
vorgekeilten Holzpflock hätte der schwache Anfangs«
gasdruck das Geschoß samt dem größten Teil des
Pulvers einfach aus dem Rohr gerollt.
Die in Pillau ausgebaggerte Kammer zeigte den einge«
keilten Holzpflock, dahinter aber einen Bausch Flachs«
fasern. Falls diese nicht etwa zum besseren Abdichten
des Pflockes gedient haben sollen, darf man wohl
annehmen, daß mit den losen Fasern der wichtige
Hohlraum zwischen Pflock und Pulver ausgefüllt
war, um dieses am Vorfällen in den Hohlraum zu
hindern.
Die besprochene Ladeweise war reichlich um«
ständlich und überhaupt nur anzuwenden, wenn man
das Rohr ganz oder doch nahezu aufrecht hinstellte.
Außerdem mußte es kurz genug sein, um hinein«
langen zu können. Schließlich konnte man den Pflock
auch nur an der für ihn bestimmten Stelle festkeilen,
falls das Rohr innen konisch war und der Pflock
die genau richtige Stärke hatte. Solche Rohre zeigt
denn auch Essenwein auf den ersten Tafeln, etwa
wie Abb. 2. Dem gegenüber war die Einführung
einer zylindrischen Kammer für das Pulver und
eines davor angebrachten Fluges für das Geschoß
ein ganz wesentlicher Fortschritt, der um die Wende
des 14. Jahrhunderts angesetzt werden darf (Abb. 3).
Die Länge des Ladungsraumes war nunmehr gegeben,
das Einkeilen eines leicht konischen Pflockes in die
PAUL REIMER: NOCHMALS DIE ÄLTEREN HINTERLADUNGSGESCHÜTZE
BAND 9
Die Ladevorschrift besagt etwa folgendes: Man teile
den Ladungsraum seiner Tiefe nach in fünf Teile.
Die untersten drei Teile stampfe man in dünnen
Schichten fest voll Pulver, lasse den vierten Teil leer
und keile in das oberste Fünftel einen Holzpflock
recht fest ein. Dann erst setze man auf den Holz«
pflock die Kugel und verdamme sie mit Werg,
Gras u. dergl. Wie weise das ausgedacht ist, erkennt
man, wenn man sich klar macht, daß gekörntes
Pulver beim Anzünden lebhaft aufblitzt, wobei die
festen Verbrennungsprodukte als Rauch mit empor«
gerissen werden. Ungekörntes, sogen. Mehlpulver,
dagegen verbrennt langsamer und hinterläßt bei nur
leichter Rauchentwicklung einen schlackigen Rück«
stand. Der Grund für dieses verschiedenartige Ver«
halten ist offenbar der, daß die Zündflamme das eine
Mal sich in allerkürzester Zeit durch die Zwischen«
räume zwischen den Pulverkörnern über den ganzen
Pulverhaufen verbreiten und so die Verbrennung
beschleunigen kann, während andererseits das fest«
gepackte Mehlpulver nur schichtenweise abbrennen
kann. Dazu kam noch, daß in alter Zeit die Kleinung
der Pulverbestandteile noch sehr unvollkommen war
und ihre Mengung nicht weit genug getrieben werden
konnte. Das Pulver war also kein ganz inniges Ge«
misch seiner Teile und hatte außerdem das Bestreben,
sich beim Transport in Säcken oder Fässern wieder
zu entmischen, alles Eigenschaften, die seine Ver«
brennungsgeschwindigkeit noch weiter herabsetzten.
Es galt also, ein Verfahren zu finden, dieses träge
Pulver zu plötzlicher Gasentwicklung zu veranlassen,
und so kam ein findiger Kopf, dem die Nachwelt
in Berthold Schwarz ein Denkmal gesetzt hat, auf
die angeführte Ladevorschrift. Hatte der alte Stück«
meister sein Rohr in dieser Weise mühsam geladen,
so bediente er sich zum Abfeuern eines glühenden
Eisenstabes, dessen rechtwinkelig umgebogene Spitze
er durch das Zündloch in die Ladung steckte. (Die
Verwendung einer dicken Lunte leistete dasselbe,
Abb. 2. Steinbüchse mit konischem Rohr
nachdem das Pulver später durch bessere Verarbeitung
entzündlicher geworden war.) Hierdurch wurde die
Verbrennung und Gasentwicklung in energischer
Weise eingeleitet, und da das Zündloch sich ganz
dicht am Seelenboden befand, mußten die sich hier
entwickelnden Gase die ganze übrige festgestampfte
Pulverladung nach vorne, d. h. in den leer gelassenen
Abb. 3. Gußeiserne Steinbüchse aus Pößneck i. S.
Germ. Museum, Nürnberg
Raum schleudern. Das bewirkte eine plötzliche Auf«
lockerung der Ladung und ein rasches Umsichgreifen
der Verbrennung, die wiederum durch den stark
steigenden Gasdruck sehr gefördert wurde. Dieser
wurde schließlich so groß, daß er den vorgekeilten
Holzpflock und damit das vorgelagerte Geschoß aus
dem Rohr schleuderte. Der Rest der Ladung brannte
dann mit lang lodernder Flamme nach. Ohne den
vorgekeilten Holzpflock hätte der schwache Anfangs«
gasdruck das Geschoß samt dem größten Teil des
Pulvers einfach aus dem Rohr gerollt.
Die in Pillau ausgebaggerte Kammer zeigte den einge«
keilten Holzpflock, dahinter aber einen Bausch Flachs«
fasern. Falls diese nicht etwa zum besseren Abdichten
des Pflockes gedient haben sollen, darf man wohl
annehmen, daß mit den losen Fasern der wichtige
Hohlraum zwischen Pflock und Pulver ausgefüllt
war, um dieses am Vorfällen in den Hohlraum zu
hindern.
Die besprochene Ladeweise war reichlich um«
ständlich und überhaupt nur anzuwenden, wenn man
das Rohr ganz oder doch nahezu aufrecht hinstellte.
Außerdem mußte es kurz genug sein, um hinein«
langen zu können. Schließlich konnte man den Pflock
auch nur an der für ihn bestimmten Stelle festkeilen,
falls das Rohr innen konisch war und der Pflock
die genau richtige Stärke hatte. Solche Rohre zeigt
denn auch Essenwein auf den ersten Tafeln, etwa
wie Abb. 2. Dem gegenüber war die Einführung
einer zylindrischen Kammer für das Pulver und
eines davor angebrachten Fluges für das Geschoß
ein ganz wesentlicher Fortschritt, der um die Wende
des 14. Jahrhunderts angesetzt werden darf (Abb. 3).
Die Länge des Ladungsraumes war nunmehr gegeben,
das Einkeilen eines leicht konischen Pflockes in die