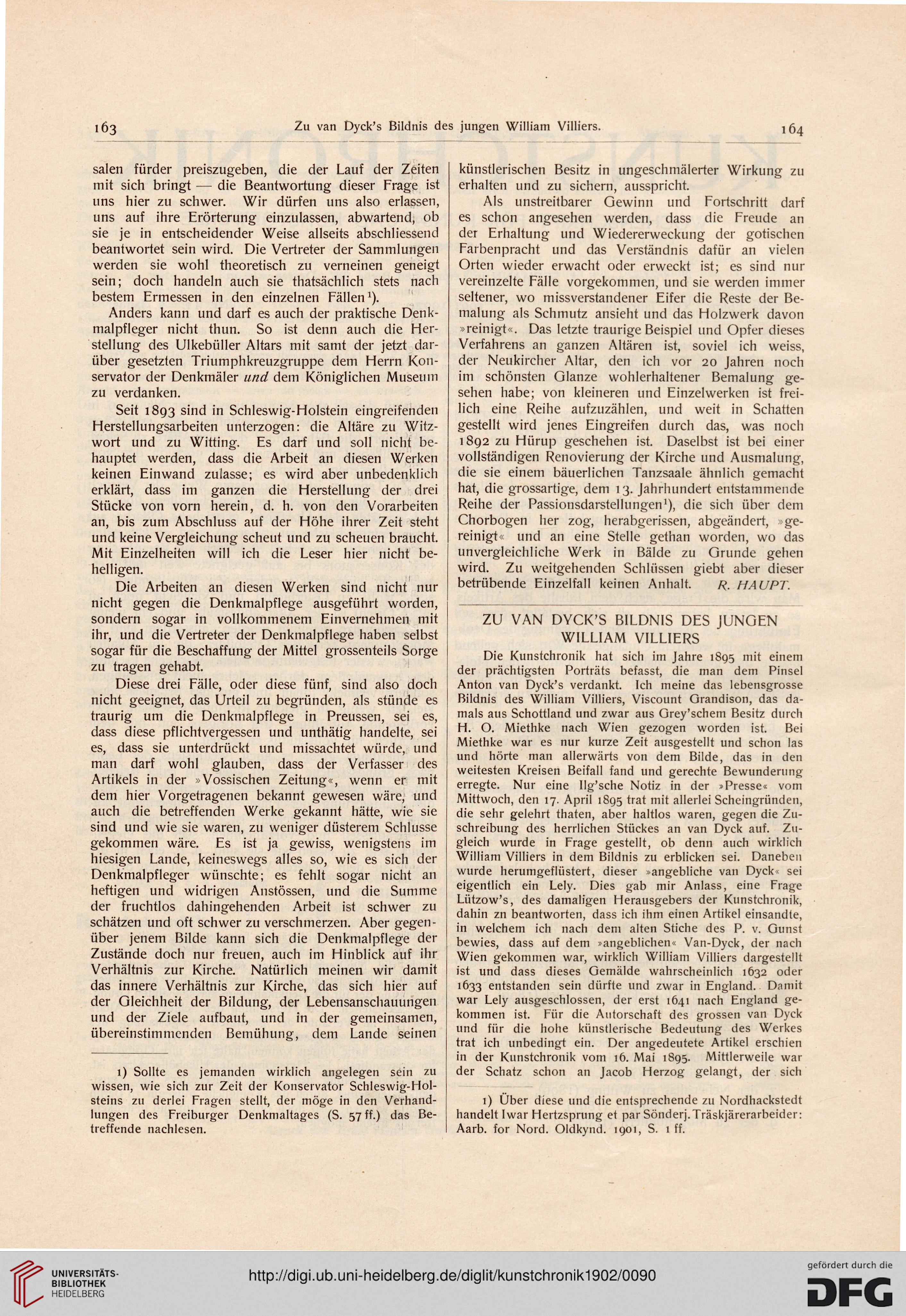163
164
salen fürder preiszugeben, die der Lauf der Zeiten
mit sich bringt — die Beantwortung dieser Frage ist
uns hier zu schwer. Wir dürfen uns also erlassen,
uns auf ihre Erörterung einzulassen, abwartend, ob
sie je in entscheidender Weise allseits abschliessend
beantwortet sein wird. Die Vertreter der Sammlungen
werden sie wohl theoretisch zu verneinen geneigt
sein; doch handeln auch sie thatsächlich stets nach
bestem Ermessen in den einzelnen Fällen1).
Anders kann und darf es auch der praktische Denk-
malpfleger nicht thun. So ist denn auch die Her-
stellung des Ulkebüller Altars mit samt der jetzt dar-
über gesetzten Triumphkreuzgruppe dem Herrn Kon-
servator der Denkmäler und dem Königlichen Museum
zu verdanken.
Seit 1893 sind in Schleswig-Holstein eingreifenden
Herstellungsarbeiten unterzogen: die Altäre zu Witz-
wort und zu Witting. Es darf und soll nicht be-
hauptet werden, dass die Arbeit an diesen Werken
keinen Einwand zulasse; es wird aber unbedenklich
erklärt, dass im ganzen die Herstellung der drei
Stücke von vorn herein, d. h. von den Vorarbeiten
an, bis zum Abschluss auf der Höhe ihrer Zeit steht
und keine Vergleichung scheut und zu scheuen braucht.
Mit Einzelheiten will ich die Leser hier nicht be-
helligen.
Die Arbeiten an diesen Werken sind nicht nur
nicht gegen die Denkmalpflege ausgeführt worden,
sondern sogar in vollkommenem Einvernehmen mit
ihr, und die Vertreter der Denkmalpflege haben selbst
sogar für die Beschaffung der Mittel grossenteils Sorge
zu tragen gehabt.
Diese drei Fälle, oder diese fünf, sind also doch
nicht geeignet, das Urteil zu begründen, als stünde es
traurig um die Denkmalpflege in Preussen, sei es,
dass diese pflichtvergessen und unthätig handelte, sei
es, dass sie unterdrückt und missachtet würde, und
man darf wohl glauben, dass der Verfasser des
Artikels in der »Vossischen Zeitung«, wenn er mit
dem hier Vorgetragenen bekannt gewesen wäre, und
auch die betreffenden Werke gekannt hätte, wie sie
sind und wie sie waren, zu weniger düsterem Schlüsse
gekommen wäre. Es ist ja gewiss, wenigstens im
hiesigen Lande, keineswegs alles so, wie es sich der
Denkmalpfleger wünschte; es fehlt sogar nicht an
heftigen und widrigen Anstössen, und die Summe
der fruchtlos dahingehenden Arbeit ist schwer zu
schätzen und oft schwer zu verschmerzen. Aber gegen-
über jenem Bilde kann sich die Denkmalpflege der
Zustände doch nur freuen, auch im Hinblick auf ihr
Verhältnis zur Kirche. Natürlich meinen wir damit
das innere Verhältnis zur Kirche, das sich hier auf
der Gleichheit der Bildung, der Lebensanschauungen
und der Ziele aufbaut, und in der gemeinsamen,
übereinstimmenden Bemühung, dem Lande seinen
1) Sollte es jemanden wirklich angelegen sein zu
wissen, wie sich zur Zeit der Konservator Schleswig-Hol-
steins zu derlei Fragen stellt, der möge in den Verhand-
lungen des Freiburger Denkmaltages (S. 57 ff.) das Be-
treffende nachlesen.
künstlerischen Besitz in ungeschmälerter Wirkung zu
erhalten und zu sichern, ausspricht.
Als unstreitbarer Gewinn und Fortschritt darf
es schon angesehen werden, dass die Freude an
der Erhaltung und Wiedererweckung der gotischen
Farbenpracht und das Verständnis dafür an vielen
Orten wieder erwacht oder erweckt ist; es sind nur
vereinzelte Fälle vorgekommen, und sie werden immer
seltener, wo missverstandener Eifer die Reste der Be-
malung als Schmutz ansieht und das Holzwerk davon
»reinigt«. Das letzte traurige Beispiel und Opfer dieses
Verfahrens an ganzen Altären ist, soviel ich weiss,
der Neukircher Altar, den ich vor 20 Jahren noch
im schönsten Glänze wohlerhaltener Bemalung ge-
sehen habe; von kleineren und Einzelwerken ist frei-
lich eine Reihe aufzuzählen, und weit in Schatten
gestellt wird jenes Eingreifen durch das, was noch
1892 zu Hürup geschehen ist. Daselbst ist bei einer
vollständigen Renovierung der Kirche und Ausmalung,
die sie einem bäuerlichen Tanzsaale ähnlich gemacht
hat, die grossartige, dem 13. Jahrhundert entstammende
Reihe der Passionsdarstellungen1), die sich über dem
Chorbogen her zog, herabgerissen, abgeändert, »ge-
reinigt« und an eine Stelle gethan worden, wo das
unvergleichliche Werk in Bälde zu Grunde gehen
wird. Zu weitgehenden Schlüssen giebt aber dieser
betrübende Einzelfall keinen Anhalt. R. HAUPT.
ZU VAN DYCK'S BILDNIS DES JUNGEN
WILLIAM VILLIERS
Die Kunstchronik hat sich im Jahre 1895 mit einem
der prächtigsten Porträts befasst, die man dem Pinsel
Anton van Dyck's verdankt. Ich meine das lebensgrosse
Bildnis des William Villiers, Viscount Grandison, das da-
mals aus Schottland und zwar aus Grey'schem Besitz durch
H. O. Miethke nach Wien gezogen worden ist. Bei
Miethke war es nur kurze Zeit ausgestellt und schon las
und hörte man allerwärts von dem Bilde, das in den
weitesten Kreisen Beifall fand und gerechte Bewunderung
erregte. Nur eine Ilg'sche Notiz in der »Presse« vom
Mittwoch, den 17. April 1895 trat mit allerlei Scheingründen,
die sehr gelehrt thaten, aber haltlos waren, gegen die Zu-
schreibung des herrlichen Stückes an van Dyck auf. Zu-
gleich wurde in Frage gestellt, ob denn auch wirklich
William Villiers in dem Bildnis zu erblicken sei. Daneben
wurde herumgeflüstert, dieser »angebliche van Dyck« sei
eigentlich ein Lely. Dies gab mir Anlass, eine Frage
Lützow's, des damaligen Herausgebers der Kunstchronik,
dahin zn beantworten, dass ich ihm einen Artikel einsandte,
in welchem ich nach dem alten Stiche des P. v. Gunst
bewies, dass auf dem »angeblichen« Van-Dyck, der nach
Wien gekommen war, wirklich William Villiers dargestellt
ist und dass dieses Gemälde wahrscheinlich 1632 oder
1633 entstanden sein dürfte und zwar in England. Damit
war Lely ausgeschlossen, der erst 1641 nach England ge-
kommen ist. Für die Autorschaft des grossen van Dyck
und für die hohe künstlerische Bedeutung des Werkes
trat ich unbedingt ein. Der angedeutete Artikel erschien
in der Kunstchronik vom 16. Mai 1895. Mittlerweile war
der Schatz schon an Jacob Herzog gelangt, der sich
1) Über diese und die entsprechende zu Nordhackstedt
handelt Iwar Hertzsprung et par Sönderj.Träskjärerarbeider:
Aarb. for Nord. Oldkynd. 1901, S. 1 ff.
164
salen fürder preiszugeben, die der Lauf der Zeiten
mit sich bringt — die Beantwortung dieser Frage ist
uns hier zu schwer. Wir dürfen uns also erlassen,
uns auf ihre Erörterung einzulassen, abwartend, ob
sie je in entscheidender Weise allseits abschliessend
beantwortet sein wird. Die Vertreter der Sammlungen
werden sie wohl theoretisch zu verneinen geneigt
sein; doch handeln auch sie thatsächlich stets nach
bestem Ermessen in den einzelnen Fällen1).
Anders kann und darf es auch der praktische Denk-
malpfleger nicht thun. So ist denn auch die Her-
stellung des Ulkebüller Altars mit samt der jetzt dar-
über gesetzten Triumphkreuzgruppe dem Herrn Kon-
servator der Denkmäler und dem Königlichen Museum
zu verdanken.
Seit 1893 sind in Schleswig-Holstein eingreifenden
Herstellungsarbeiten unterzogen: die Altäre zu Witz-
wort und zu Witting. Es darf und soll nicht be-
hauptet werden, dass die Arbeit an diesen Werken
keinen Einwand zulasse; es wird aber unbedenklich
erklärt, dass im ganzen die Herstellung der drei
Stücke von vorn herein, d. h. von den Vorarbeiten
an, bis zum Abschluss auf der Höhe ihrer Zeit steht
und keine Vergleichung scheut und zu scheuen braucht.
Mit Einzelheiten will ich die Leser hier nicht be-
helligen.
Die Arbeiten an diesen Werken sind nicht nur
nicht gegen die Denkmalpflege ausgeführt worden,
sondern sogar in vollkommenem Einvernehmen mit
ihr, und die Vertreter der Denkmalpflege haben selbst
sogar für die Beschaffung der Mittel grossenteils Sorge
zu tragen gehabt.
Diese drei Fälle, oder diese fünf, sind also doch
nicht geeignet, das Urteil zu begründen, als stünde es
traurig um die Denkmalpflege in Preussen, sei es,
dass diese pflichtvergessen und unthätig handelte, sei
es, dass sie unterdrückt und missachtet würde, und
man darf wohl glauben, dass der Verfasser des
Artikels in der »Vossischen Zeitung«, wenn er mit
dem hier Vorgetragenen bekannt gewesen wäre, und
auch die betreffenden Werke gekannt hätte, wie sie
sind und wie sie waren, zu weniger düsterem Schlüsse
gekommen wäre. Es ist ja gewiss, wenigstens im
hiesigen Lande, keineswegs alles so, wie es sich der
Denkmalpfleger wünschte; es fehlt sogar nicht an
heftigen und widrigen Anstössen, und die Summe
der fruchtlos dahingehenden Arbeit ist schwer zu
schätzen und oft schwer zu verschmerzen. Aber gegen-
über jenem Bilde kann sich die Denkmalpflege der
Zustände doch nur freuen, auch im Hinblick auf ihr
Verhältnis zur Kirche. Natürlich meinen wir damit
das innere Verhältnis zur Kirche, das sich hier auf
der Gleichheit der Bildung, der Lebensanschauungen
und der Ziele aufbaut, und in der gemeinsamen,
übereinstimmenden Bemühung, dem Lande seinen
1) Sollte es jemanden wirklich angelegen sein zu
wissen, wie sich zur Zeit der Konservator Schleswig-Hol-
steins zu derlei Fragen stellt, der möge in den Verhand-
lungen des Freiburger Denkmaltages (S. 57 ff.) das Be-
treffende nachlesen.
künstlerischen Besitz in ungeschmälerter Wirkung zu
erhalten und zu sichern, ausspricht.
Als unstreitbarer Gewinn und Fortschritt darf
es schon angesehen werden, dass die Freude an
der Erhaltung und Wiedererweckung der gotischen
Farbenpracht und das Verständnis dafür an vielen
Orten wieder erwacht oder erweckt ist; es sind nur
vereinzelte Fälle vorgekommen, und sie werden immer
seltener, wo missverstandener Eifer die Reste der Be-
malung als Schmutz ansieht und das Holzwerk davon
»reinigt«. Das letzte traurige Beispiel und Opfer dieses
Verfahrens an ganzen Altären ist, soviel ich weiss,
der Neukircher Altar, den ich vor 20 Jahren noch
im schönsten Glänze wohlerhaltener Bemalung ge-
sehen habe; von kleineren und Einzelwerken ist frei-
lich eine Reihe aufzuzählen, und weit in Schatten
gestellt wird jenes Eingreifen durch das, was noch
1892 zu Hürup geschehen ist. Daselbst ist bei einer
vollständigen Renovierung der Kirche und Ausmalung,
die sie einem bäuerlichen Tanzsaale ähnlich gemacht
hat, die grossartige, dem 13. Jahrhundert entstammende
Reihe der Passionsdarstellungen1), die sich über dem
Chorbogen her zog, herabgerissen, abgeändert, »ge-
reinigt« und an eine Stelle gethan worden, wo das
unvergleichliche Werk in Bälde zu Grunde gehen
wird. Zu weitgehenden Schlüssen giebt aber dieser
betrübende Einzelfall keinen Anhalt. R. HAUPT.
ZU VAN DYCK'S BILDNIS DES JUNGEN
WILLIAM VILLIERS
Die Kunstchronik hat sich im Jahre 1895 mit einem
der prächtigsten Porträts befasst, die man dem Pinsel
Anton van Dyck's verdankt. Ich meine das lebensgrosse
Bildnis des William Villiers, Viscount Grandison, das da-
mals aus Schottland und zwar aus Grey'schem Besitz durch
H. O. Miethke nach Wien gezogen worden ist. Bei
Miethke war es nur kurze Zeit ausgestellt und schon las
und hörte man allerwärts von dem Bilde, das in den
weitesten Kreisen Beifall fand und gerechte Bewunderung
erregte. Nur eine Ilg'sche Notiz in der »Presse« vom
Mittwoch, den 17. April 1895 trat mit allerlei Scheingründen,
die sehr gelehrt thaten, aber haltlos waren, gegen die Zu-
schreibung des herrlichen Stückes an van Dyck auf. Zu-
gleich wurde in Frage gestellt, ob denn auch wirklich
William Villiers in dem Bildnis zu erblicken sei. Daneben
wurde herumgeflüstert, dieser »angebliche van Dyck« sei
eigentlich ein Lely. Dies gab mir Anlass, eine Frage
Lützow's, des damaligen Herausgebers der Kunstchronik,
dahin zn beantworten, dass ich ihm einen Artikel einsandte,
in welchem ich nach dem alten Stiche des P. v. Gunst
bewies, dass auf dem »angeblichen« Van-Dyck, der nach
Wien gekommen war, wirklich William Villiers dargestellt
ist und dass dieses Gemälde wahrscheinlich 1632 oder
1633 entstanden sein dürfte und zwar in England. Damit
war Lely ausgeschlossen, der erst 1641 nach England ge-
kommen ist. Für die Autorschaft des grossen van Dyck
und für die hohe künstlerische Bedeutung des Werkes
trat ich unbedingt ein. Der angedeutete Artikel erschien
in der Kunstchronik vom 16. Mai 1895. Mittlerweile war
der Schatz schon an Jacob Herzog gelangt, der sich
1) Über diese und die entsprechende zu Nordhackstedt
handelt Iwar Hertzsprung et par Sönderj.Träskjärerarbeider:
Aarb. for Nord. Oldkynd. 1901, S. 1 ff.