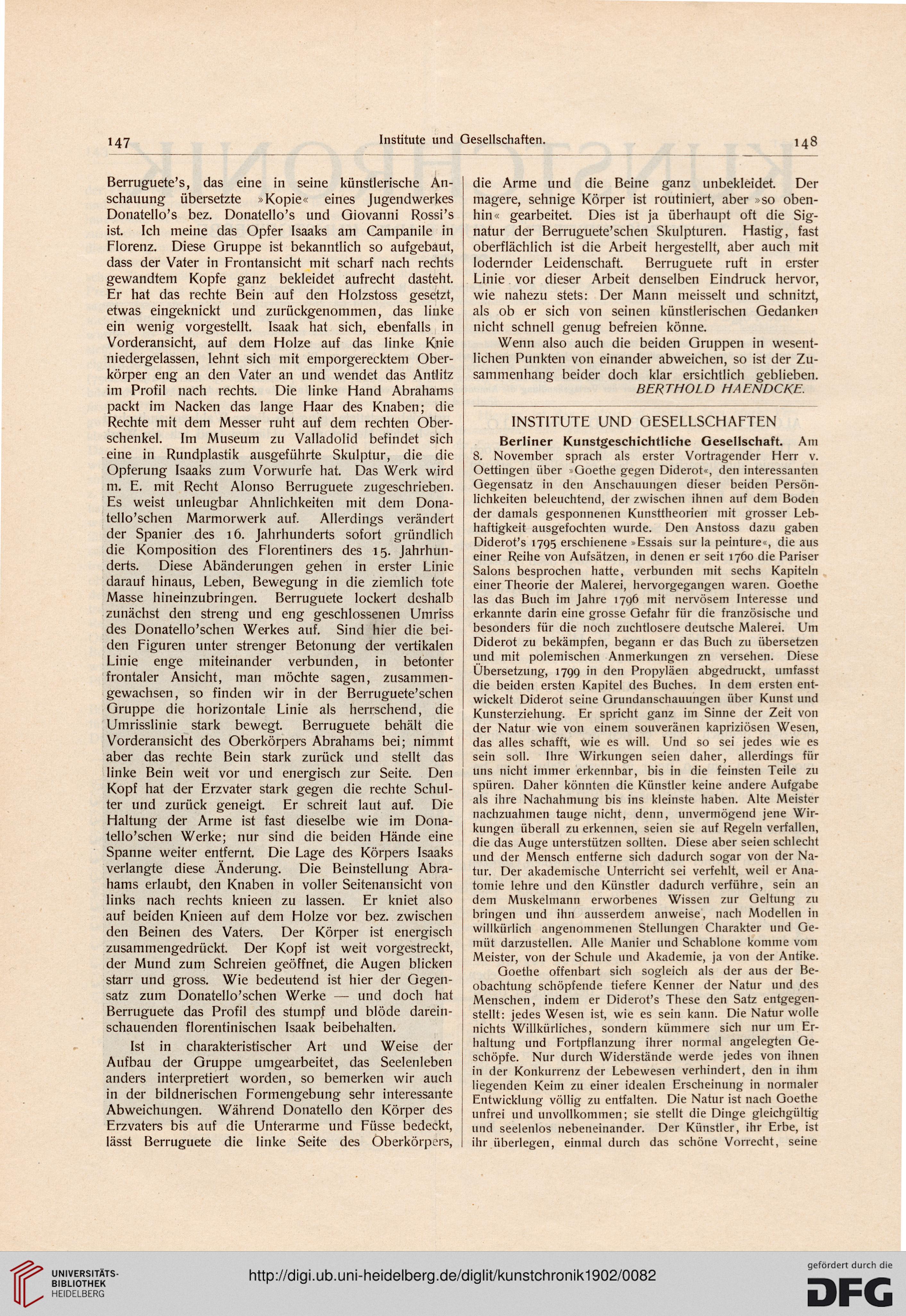147
148
Berruguete's, das eine in seine künstlerische An-
schauung übersetzte »Kopie« eines Jugendwerkes
Donatello's bez. Donatello's und Qiovanni Rossi's
ist. Ich meine das Opfer Isaaks am Campanile in
Florenz. Diese Gruppe ist bekanntlich so aufgebaut,
dass der Vater in Frontansicht mit scharf nach rechts
gewandtem Kopfe ganz bekleidet aufrecht dasteht.
Er hat das rechte Bein auf den Holzstoss gesetzt,
etwas eingeknickt und zurückgenommen, das linke
ein wenig vorgestellt. Isaak hat sich, ebenfalls in
Vorderansicht, auf dem Holze auf das linke Knie
niedergelassen, lehnt sich mit emporgerecktem Ober-
körper eng an den Vater an und wendet das Antlitz
im Profil nach rechts. Die linke Hand Abrahams
packt im Nacken das lange Haar des Knaben; die
Rechte mit dem Messer ruht auf dem rechten Ober-
schenkel. Im Museum zu Valladolid befindet sich
eine in Rundplastik ausgeführte Skulptur, die die
Opferung Isaaks zum Vorwurfe hat. Das Werk wird
m. E. mit Recht Alonso Berruguete zugeschrieben.
Es weist unleugbar Ähnlichkeiten mit dem Dona-
tello'schen Marmorwerk auf. Allerdings verändert
der Spanier des 16. Jahrhunderts sofort gründlich
die Komposition des Florentiners des 15. Jahrhun-
derts. Diese Abänderungen gehen in erster Linie
darauf hinaus, Leben, Bewegung in die ziemlich tote
Masse hineinzubringen. Berruguete lockert deshalb
zunächst den streng und eng geschlossenen Umriss
des Donatello'schen Werkes auf. Sind hier die bei-
den Figuren unter strenger Betonung der vertikalen
Linie enge miteinander verbunden, in betonter
frontaler Ansicht, man möchte sagen, zusammen-
gewachsen, so finden wir in der Berruguete'schen
Gruppe die horizontale Linie als herrschend, die
Umrisslinie stark bewegt. Berruguete behält die
Vorderansicht des Oberkörpers Abrahams bei; nimmt
aber das rechte Bein stark zurück und stellt das
linke Bein weit vor und energisch zur Seite. Den
Kopf hat der Erzvater stark gegen die rechte Schul-
ter und zurück geneigt. Er schreit laut auf. Die
Haltung der Arme ist fast dieselbe wie im Dona-
tello'schen Werke; nur sind die beiden Hände eine
Spanne weiter entfernt. Die Lage des Körpers Isaaks
verlangte diese Änderung. Die Beinstellung Abra-
hams erlaubt, den Knaben in voller Seitenansicht von
links nach rechts knieen zu lassen. Er kniet also
auf beiden Knieen auf dem Holze vor bez. zwischen
den Beinen des Vaters. Der Körper ist energisch
zusammengedrückt. Der Kopf ist weit vorgestreckt,
der Mund zum Schreien geöffnet, die Augen blicken
starr und gross. Wie bedeutend ist hier der Gegen-
satz zum Donatello'schen Werke — und doch hat
Berruguete das Profil des stumpf und blöde darein-
schauenden florentinischen Isaak beibehalten.
Ist in charakteristischer Art und Weise der
Aufbau der Gruppe umgearbeitet, das Seelenleben
anders interpretiert worden, so bemerken wir auch
in der bildnerischen Formengebung sehr interessante
Abweichungen. Während Donatello den Körper des
Erzvaters bis auf die Unterarme und Füsse bedeckt,
lässt Berruguete die linke Seite des Oberkörpers, |
die Arme und die Beine ganz unbekleidet. Der
magere, sehnige Körper ist routiniert, aber »so oben-
hin« gearbeitet. Dies ist ja überhaupt oft die Sig-
natur der Berruguete'schen Skulpturen. Hastig, fast
oberflächlich ist die Arbeit hergestellt, aber auch mit
lodernder Leidenschaft. Berruguete ruft in erster
Linie vor dieser Arbeit denselben Eindruck hervor,
wie nahezu stets: Der Mann meisselt und schnitzt,
als ob er sich von seinen künstlerischen Gedanken
nicht schnell genug befreien könne.
Wenn also auch die beiden Gruppen in wesent-
lichen Punkten von einander abweichen, so ist der Zu-
sammenhang beider doch klar ersichtlich geblieben.
BERTHOLD HAENDCKE.
INSTITUTE UND GESELLSCHAFTEN
Berliner Kunstgeschichtliche Gesellschaft. Am
8. November sprach als erster Vortragender Herr v.
Oettingen über »Goethe gegen Diderot«, den interessanten
Gegensatz in den Anschauungen dieser beiden Persön-
lichkeiten beleuchtend, der zwischen ihnen auf dem Boden
der damals gesponnenen Kunsttheorien mit grosser Leb-
haftigkeit ausgefochten wurde. Den Anstoss dazu gaben
Diderot's 1795 erschienene »Essais sur la peinture«, die aus
einer Reihe von Aufsätzen, in denen er seit 1760 die Pariser
Salons besprochen hatte, verbunden mit sechs Kapiteln
einer Theorie der Malerei, hervorgegangen waren. Goethe
las das Buch im Jahre 1796 mit nervösem Interesse und
erkannte darin eine grosse Gefahr für die französische und
besonders für die noch zuchtlosere deutsche Malerei. Um
Diderot zu bekämpfen, begann er das Buch zu übersetzen
und mit polemischen Anmerkungen zn versehen. Diese
Übersetzung, 1799 in den Propyläen abgedruckt, umfasst
die beiden ersten Kapitel des Buches. In dem ersten ent-
wickelt Diderot seine Grundanschauungen über Kunst und
Kunsterziehung. Er spricht ganz im Sinne der Zeit von
der Natur wie von einem souveränen kapriziösen Wesen,
das alles schafft, wie es will. Und so sei jedes wie es
sein soll. Ihre Wirkungen seien daher, allerdings für
uns nicht immer erkennbar, bis in die feinsten Teile zu
spüren. Daher könnten die Künstler keine andere Aufgabe
als ihre Nachahmung bis ins kleinste haben. Alte Meister
nachzuahmen tauge nicht, denn, unvermögend jene Wir-
kungen überall zu erkennen, seien sie auf Regeln verfallen,
die das Auge unterstützen sollten. Diese aber seien schlecht
und der Mensch entferne sich dadurch sogar von der Na-
tur. Der akademische Unterricht sei verfehlt, weil er Ana-
tomie lehre und den Künstler dadurch verführe, sein an
dem Muskelmann erworbenes Wissen zur Geltung zu
bringen und ihn ausserdem anweise, nach Modellen in
willkürlich angenommenen Stellungen Charakter und Ge-
müt darzustellen. Alle Manier und Schablone komme vom
Meister, von der Schule und Akademie, ja von der Antike.
Goethe offenbart sich sogleich als der aus der Be-
obachtung schöpfende tiefere Kenner der Natur und des
Menschen, indem er Diderot's These den Satz entgegen-
stellt: jedes Wesen ist, wie es sein kann. Die Natur wolle
nichts Willkürliches, sondern kümmere sich nur um Er-
! haltung und Fortpflanzung ihrer normal angelegten Ge-
schöpfe. Nur durch Widerstände werde jedes von ihnen
in der Konkurrenz der Lebewesen verhindert, den in ihm
liegenden Keim zu einer idealen Erscheinung in normaler
Entwicklung völlig zu entfalten. Die Natur ist nach Goethe
unfrei und unvollkommen; sie stellt die Dinge gleichgültig
und seelenlos nebeneinander. Der Künstler, ihr Erbe, ist
I ihr überlegen, einmal durch das schöne Vorrecht, seine
148
Berruguete's, das eine in seine künstlerische An-
schauung übersetzte »Kopie« eines Jugendwerkes
Donatello's bez. Donatello's und Qiovanni Rossi's
ist. Ich meine das Opfer Isaaks am Campanile in
Florenz. Diese Gruppe ist bekanntlich so aufgebaut,
dass der Vater in Frontansicht mit scharf nach rechts
gewandtem Kopfe ganz bekleidet aufrecht dasteht.
Er hat das rechte Bein auf den Holzstoss gesetzt,
etwas eingeknickt und zurückgenommen, das linke
ein wenig vorgestellt. Isaak hat sich, ebenfalls in
Vorderansicht, auf dem Holze auf das linke Knie
niedergelassen, lehnt sich mit emporgerecktem Ober-
körper eng an den Vater an und wendet das Antlitz
im Profil nach rechts. Die linke Hand Abrahams
packt im Nacken das lange Haar des Knaben; die
Rechte mit dem Messer ruht auf dem rechten Ober-
schenkel. Im Museum zu Valladolid befindet sich
eine in Rundplastik ausgeführte Skulptur, die die
Opferung Isaaks zum Vorwurfe hat. Das Werk wird
m. E. mit Recht Alonso Berruguete zugeschrieben.
Es weist unleugbar Ähnlichkeiten mit dem Dona-
tello'schen Marmorwerk auf. Allerdings verändert
der Spanier des 16. Jahrhunderts sofort gründlich
die Komposition des Florentiners des 15. Jahrhun-
derts. Diese Abänderungen gehen in erster Linie
darauf hinaus, Leben, Bewegung in die ziemlich tote
Masse hineinzubringen. Berruguete lockert deshalb
zunächst den streng und eng geschlossenen Umriss
des Donatello'schen Werkes auf. Sind hier die bei-
den Figuren unter strenger Betonung der vertikalen
Linie enge miteinander verbunden, in betonter
frontaler Ansicht, man möchte sagen, zusammen-
gewachsen, so finden wir in der Berruguete'schen
Gruppe die horizontale Linie als herrschend, die
Umrisslinie stark bewegt. Berruguete behält die
Vorderansicht des Oberkörpers Abrahams bei; nimmt
aber das rechte Bein stark zurück und stellt das
linke Bein weit vor und energisch zur Seite. Den
Kopf hat der Erzvater stark gegen die rechte Schul-
ter und zurück geneigt. Er schreit laut auf. Die
Haltung der Arme ist fast dieselbe wie im Dona-
tello'schen Werke; nur sind die beiden Hände eine
Spanne weiter entfernt. Die Lage des Körpers Isaaks
verlangte diese Änderung. Die Beinstellung Abra-
hams erlaubt, den Knaben in voller Seitenansicht von
links nach rechts knieen zu lassen. Er kniet also
auf beiden Knieen auf dem Holze vor bez. zwischen
den Beinen des Vaters. Der Körper ist energisch
zusammengedrückt. Der Kopf ist weit vorgestreckt,
der Mund zum Schreien geöffnet, die Augen blicken
starr und gross. Wie bedeutend ist hier der Gegen-
satz zum Donatello'schen Werke — und doch hat
Berruguete das Profil des stumpf und blöde darein-
schauenden florentinischen Isaak beibehalten.
Ist in charakteristischer Art und Weise der
Aufbau der Gruppe umgearbeitet, das Seelenleben
anders interpretiert worden, so bemerken wir auch
in der bildnerischen Formengebung sehr interessante
Abweichungen. Während Donatello den Körper des
Erzvaters bis auf die Unterarme und Füsse bedeckt,
lässt Berruguete die linke Seite des Oberkörpers, |
die Arme und die Beine ganz unbekleidet. Der
magere, sehnige Körper ist routiniert, aber »so oben-
hin« gearbeitet. Dies ist ja überhaupt oft die Sig-
natur der Berruguete'schen Skulpturen. Hastig, fast
oberflächlich ist die Arbeit hergestellt, aber auch mit
lodernder Leidenschaft. Berruguete ruft in erster
Linie vor dieser Arbeit denselben Eindruck hervor,
wie nahezu stets: Der Mann meisselt und schnitzt,
als ob er sich von seinen künstlerischen Gedanken
nicht schnell genug befreien könne.
Wenn also auch die beiden Gruppen in wesent-
lichen Punkten von einander abweichen, so ist der Zu-
sammenhang beider doch klar ersichtlich geblieben.
BERTHOLD HAENDCKE.
INSTITUTE UND GESELLSCHAFTEN
Berliner Kunstgeschichtliche Gesellschaft. Am
8. November sprach als erster Vortragender Herr v.
Oettingen über »Goethe gegen Diderot«, den interessanten
Gegensatz in den Anschauungen dieser beiden Persön-
lichkeiten beleuchtend, der zwischen ihnen auf dem Boden
der damals gesponnenen Kunsttheorien mit grosser Leb-
haftigkeit ausgefochten wurde. Den Anstoss dazu gaben
Diderot's 1795 erschienene »Essais sur la peinture«, die aus
einer Reihe von Aufsätzen, in denen er seit 1760 die Pariser
Salons besprochen hatte, verbunden mit sechs Kapiteln
einer Theorie der Malerei, hervorgegangen waren. Goethe
las das Buch im Jahre 1796 mit nervösem Interesse und
erkannte darin eine grosse Gefahr für die französische und
besonders für die noch zuchtlosere deutsche Malerei. Um
Diderot zu bekämpfen, begann er das Buch zu übersetzen
und mit polemischen Anmerkungen zn versehen. Diese
Übersetzung, 1799 in den Propyläen abgedruckt, umfasst
die beiden ersten Kapitel des Buches. In dem ersten ent-
wickelt Diderot seine Grundanschauungen über Kunst und
Kunsterziehung. Er spricht ganz im Sinne der Zeit von
der Natur wie von einem souveränen kapriziösen Wesen,
das alles schafft, wie es will. Und so sei jedes wie es
sein soll. Ihre Wirkungen seien daher, allerdings für
uns nicht immer erkennbar, bis in die feinsten Teile zu
spüren. Daher könnten die Künstler keine andere Aufgabe
als ihre Nachahmung bis ins kleinste haben. Alte Meister
nachzuahmen tauge nicht, denn, unvermögend jene Wir-
kungen überall zu erkennen, seien sie auf Regeln verfallen,
die das Auge unterstützen sollten. Diese aber seien schlecht
und der Mensch entferne sich dadurch sogar von der Na-
tur. Der akademische Unterricht sei verfehlt, weil er Ana-
tomie lehre und den Künstler dadurch verführe, sein an
dem Muskelmann erworbenes Wissen zur Geltung zu
bringen und ihn ausserdem anweise, nach Modellen in
willkürlich angenommenen Stellungen Charakter und Ge-
müt darzustellen. Alle Manier und Schablone komme vom
Meister, von der Schule und Akademie, ja von der Antike.
Goethe offenbart sich sogleich als der aus der Be-
obachtung schöpfende tiefere Kenner der Natur und des
Menschen, indem er Diderot's These den Satz entgegen-
stellt: jedes Wesen ist, wie es sein kann. Die Natur wolle
nichts Willkürliches, sondern kümmere sich nur um Er-
! haltung und Fortpflanzung ihrer normal angelegten Ge-
schöpfe. Nur durch Widerstände werde jedes von ihnen
in der Konkurrenz der Lebewesen verhindert, den in ihm
liegenden Keim zu einer idealen Erscheinung in normaler
Entwicklung völlig zu entfalten. Die Natur ist nach Goethe
unfrei und unvollkommen; sie stellt die Dinge gleichgültig
und seelenlos nebeneinander. Der Künstler, ihr Erbe, ist
I ihr überlegen, einmal durch das schöne Vorrecht, seine