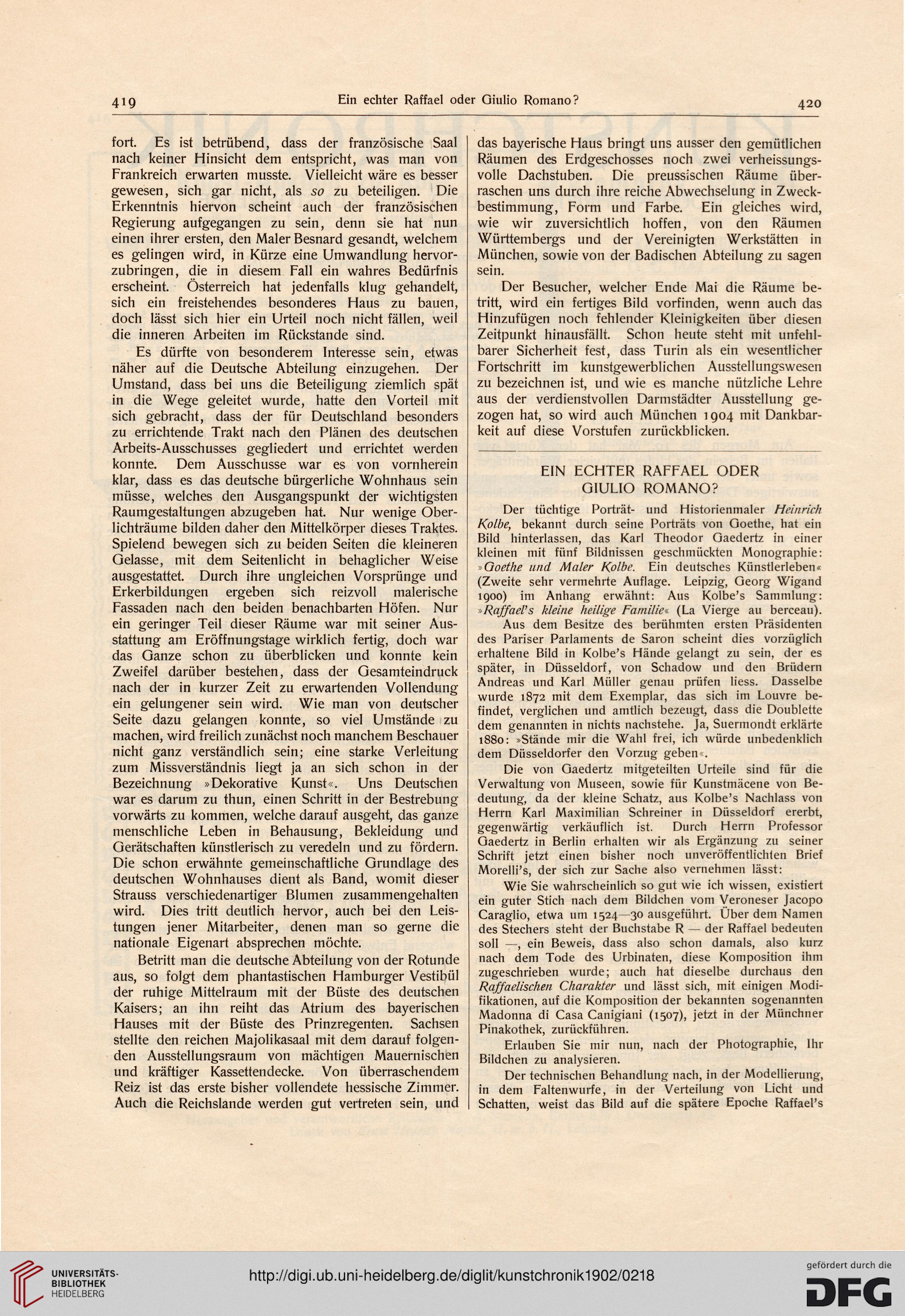419
Ein echter Raffael oder Giulio Romano?
420
fort. Es ist betrübend, dass der französische Saal
nach keiner Hinsicht dem entspricht, was man von
Frankreich erwarten musste. Vielleicht wäre es besser
gewesen, sich gar nicht, als so zu beteiligen. Die
Erkenntnis hiervon scheint auch der französischen
Regierung aufgegangen zu sein, denn sie hat nun
einen ihrer ersten, den Maler Besnard gesandt, welchem
es gelingen wird, in Kürze eine Umwandlung hervor-
zubringen, die in diesem Fall ein wahres Bedürfnis
erscheint. Österreich hat jedenfalls klug gehandelt,
sich ein freistehendes besonderes Haus zu bauen,
doch lässt sich hier ein Urteil noch nicht fällen, weil
die inneren Arbeiten im Rückstände sind.
Es dürfte von besonderem Interesse sein, etwas
näher auf die Deutsche Abteilung einzugehen. Der
Umstand, dass bei uns die Beteiligung ziemlich spät
in die Wege geleitet wurde, hatte den Vorteil mit
sich gebracht, dass der für Deutschland besonders
zu errichtende Trakt nach den Plänen des deutschen
Arbeits-Ausschusses gegliedert und errichtet werden
konnte. Dem Ausschusse war es von vornherein
klar, dass es das deutsche bürgerliche Wohnhaus sein
müsse, welches den Ausgangspunkt der wichtigsten
Raumgestaltungen abzugeben hat. Nur wenige Ober-
lichträume bilden daher den Mittelkörper dieses Traktes.
Spielend bewegen sich zu beiden Seiten die kleineren
Gelasse, mit dem Seitenlicht in behaglicher Weise
ausgestattet. Durch ihre ungleichen Vorsprünge und
Erkerbildungen ergeben sich reizvoll malerische
Fassaden nach den beiden benachbarten Höfen. Nur
ein geringer Teil dieser Räume war mit seiner Aus-
stattung am Eröffnungstage wirklich fertig, doch war
das Ganze schon zu überblicken und konnte kein
Zweifel darüber bestehen, dass der Gesamteindruck
nach der in kurzer Zeit zu erwartenden Vollendung
ein gelungener sein wird. Wie man von deutscher
Seite dazu gelangen konnte, so viel Umstände zu
machen, wird freilich zunächst noch manchem Beschauer
nicht ganz verständlich sein; eine starke Verleitung
zum Missverständnis liegt ja an sich schon in der
Bezeichnung »Dekorative Kunst«. Uns Deutschen
war es darum zu thun, einen Schritt in der Bestrebung
vorwärts zu kommen, welche darauf ausgeht, das ganze
menschliche Leben in Behausung, Bekleidung und
Gerätschaften künstlerisch zu veredeln und zu fördern.
Die schon erwähnte gemeinschaftliche Grundlage des
deutschen Wohnhauses dient als Band, womit dieser
Strauss verschiedenartiger Blumen zusammengehalten
wird. Dies tritt deutlich hervor, auch bei den Leis-
tungen jener Mitarbeiter, denen man so gerne die
nationale Eigenart absprechen möchte.
Betritt man die deutsche Abteilung von der Rotunde
aus, so folgt dem phantastischen Hamburger Vestibül
der ruhige Mittelraum mit der Büste des deutschen
Kaisers; an ihn reiht das Atrium des bayerischen
Hauses mit der Büste des Prinzregenten. Sachsen
stellte den reichen Majolikasaal mit dem darauf folgen-
den Ausstellungsraum von mächtigen Mauernischen
und kräftiger Kassettendecke. Von überraschendem
Reiz ist das erste bisher vollendete hessische Zimmer.
Auch die Reichslande werden gut vertreten sein, und
das bayerische Haus bringt uns ausser den gemütlichen
Räumen des Erdgeschosses noch zwei verheissungs-
volle Dachstuben. Die preussischen Räume über-
raschen uns durch ihre reiche Abwechselung in Zweck-
bestimmung, Form und Farbe. Ein gleiches wird,
wie wir zuversichtlich hoffen, von den Räumen
Württembergs und der Vereinigten Werkstätten in
München, sowie von der Badischen Abteilung zu sagen
sein.
Der Besucher, welcher Ende Mai die Räume be-
tritt, wird ein fertiges Bild vorfinden, wenn auch das
Hinzufügen noch fehlender Kleinigkeiten über diesen
Zeitpunkt hinausfällt. Schon heute steht mit unfehl-
barer Sicherheit fest, dass Turin als ein wesentlicher
Fortschritt im kunstgewerblichen Ausstellungswesen
zu bezeichnen ist, und wie es manche nützliche Lehre
aus der verdienstvollen Darmstädter Ausstellung ge-
zogen hat, so wird auch München 1904 mit Dankbar-
keit auf diese Vorstufen zurückblicken.
EIN ECHTER RAFFAEL ODER
GIULIO ROMANO?
Der tüchtige Porträt- und Historienmaler Heinrich
Kolbe, bekannt durch seine Porträts von Goethe, hat ein
Bild hinterlassen, das Karl Theodor Gaedertz in einer
kleinen mit fünf Bildnissen geschmückten Monographie:
"Qoethe und Maler Kolbe. Ein deutsches Künstlerleben«
(Zweite sehr vermehrte Auflage. Leipzig, Georg Wigand
1900) im Anhang erwähnt: Aus Kolbe's Sammlung:
»Raffael's kleine heilige Familie« (La Vierge au berceau).
Aus dem Besitze des berühmten ersten Präsidenten
des Pariser Parlaments de Saron scheint dies vorzüglich
erhaltene Bild in Kolbe's Hände gelangt zu sein, der es
später, in Düsseldorf, von Schadow und den Brüdern
Andreas und Karl Müller genau prüfen liess. Dasselbe
wurde 1872 mit dem Exemplar, das sich im Louvre be-
findet, verglichen und amtlich bezeugt, dass die Doublette
dem genannten in nichts nachstehe. Ja, Suermondt erklärte
1880: »Stände mir die Wahl frei, ich würde unbedenklich
dem Düsseldorfer den Vorzug geben«.
Die von Gaedertz mitgeteilten Urteile sind für die
Verwaltung von Museen, sowie für Kunstmäcene von Be-
deutung, da der kleine Schatz, aus Kolbe's Nachlass von
Herrn Karl Maximilian Schreiner in Düsseldorf ererbt,
gegenwärtig verkäuflich ist. Durch Herrn Professor
Gaedertz in Berlin erhalten wir als Ergänzung zu seiner
Schrift jetzt einen bisher noch unveröffentlichten Brief
Morelli's, der sich zur Sache also vernehmen lässt:
Wie Sie wahrscheinlich so gut wie ich wissen, existiert
ein guter Stich nach dem Bildchen vom Veroneser Jacopo
Caraglio, etwa um 1524—30 ausgeführt. Über dem Namen
des Stechers steht der Buchstabe R — der Raffael bedeuten
soll —, ein Beweis, dass also schon damals, also kurz
nach dem Tode des Urbinaten, diese Komposition ihm
zugeschrieben wurde; auch hat dieselbe durchaus den
Raffaelischen Charakter und lässt sich, mit einigen Modi-
fikationen, auf die Komposition der bekannten sogenannten
Madonna di Casa Canigiani (1507), jetzt in der Münchner
Pinakothek, zurückführen.
Erlauben Sie mir nun, nach der Photographie, Ihr
Bildchen zu analysieren.
Der technischen Behandlung nach, in der Modellierung,
in dem Faltenwurfe, in der Verteilung von Licht und
Schatten, weist das Bild auf die spätere Epoche Raffael's
Ein echter Raffael oder Giulio Romano?
420
fort. Es ist betrübend, dass der französische Saal
nach keiner Hinsicht dem entspricht, was man von
Frankreich erwarten musste. Vielleicht wäre es besser
gewesen, sich gar nicht, als so zu beteiligen. Die
Erkenntnis hiervon scheint auch der französischen
Regierung aufgegangen zu sein, denn sie hat nun
einen ihrer ersten, den Maler Besnard gesandt, welchem
es gelingen wird, in Kürze eine Umwandlung hervor-
zubringen, die in diesem Fall ein wahres Bedürfnis
erscheint. Österreich hat jedenfalls klug gehandelt,
sich ein freistehendes besonderes Haus zu bauen,
doch lässt sich hier ein Urteil noch nicht fällen, weil
die inneren Arbeiten im Rückstände sind.
Es dürfte von besonderem Interesse sein, etwas
näher auf die Deutsche Abteilung einzugehen. Der
Umstand, dass bei uns die Beteiligung ziemlich spät
in die Wege geleitet wurde, hatte den Vorteil mit
sich gebracht, dass der für Deutschland besonders
zu errichtende Trakt nach den Plänen des deutschen
Arbeits-Ausschusses gegliedert und errichtet werden
konnte. Dem Ausschusse war es von vornherein
klar, dass es das deutsche bürgerliche Wohnhaus sein
müsse, welches den Ausgangspunkt der wichtigsten
Raumgestaltungen abzugeben hat. Nur wenige Ober-
lichträume bilden daher den Mittelkörper dieses Traktes.
Spielend bewegen sich zu beiden Seiten die kleineren
Gelasse, mit dem Seitenlicht in behaglicher Weise
ausgestattet. Durch ihre ungleichen Vorsprünge und
Erkerbildungen ergeben sich reizvoll malerische
Fassaden nach den beiden benachbarten Höfen. Nur
ein geringer Teil dieser Räume war mit seiner Aus-
stattung am Eröffnungstage wirklich fertig, doch war
das Ganze schon zu überblicken und konnte kein
Zweifel darüber bestehen, dass der Gesamteindruck
nach der in kurzer Zeit zu erwartenden Vollendung
ein gelungener sein wird. Wie man von deutscher
Seite dazu gelangen konnte, so viel Umstände zu
machen, wird freilich zunächst noch manchem Beschauer
nicht ganz verständlich sein; eine starke Verleitung
zum Missverständnis liegt ja an sich schon in der
Bezeichnung »Dekorative Kunst«. Uns Deutschen
war es darum zu thun, einen Schritt in der Bestrebung
vorwärts zu kommen, welche darauf ausgeht, das ganze
menschliche Leben in Behausung, Bekleidung und
Gerätschaften künstlerisch zu veredeln und zu fördern.
Die schon erwähnte gemeinschaftliche Grundlage des
deutschen Wohnhauses dient als Band, womit dieser
Strauss verschiedenartiger Blumen zusammengehalten
wird. Dies tritt deutlich hervor, auch bei den Leis-
tungen jener Mitarbeiter, denen man so gerne die
nationale Eigenart absprechen möchte.
Betritt man die deutsche Abteilung von der Rotunde
aus, so folgt dem phantastischen Hamburger Vestibül
der ruhige Mittelraum mit der Büste des deutschen
Kaisers; an ihn reiht das Atrium des bayerischen
Hauses mit der Büste des Prinzregenten. Sachsen
stellte den reichen Majolikasaal mit dem darauf folgen-
den Ausstellungsraum von mächtigen Mauernischen
und kräftiger Kassettendecke. Von überraschendem
Reiz ist das erste bisher vollendete hessische Zimmer.
Auch die Reichslande werden gut vertreten sein, und
das bayerische Haus bringt uns ausser den gemütlichen
Räumen des Erdgeschosses noch zwei verheissungs-
volle Dachstuben. Die preussischen Räume über-
raschen uns durch ihre reiche Abwechselung in Zweck-
bestimmung, Form und Farbe. Ein gleiches wird,
wie wir zuversichtlich hoffen, von den Räumen
Württembergs und der Vereinigten Werkstätten in
München, sowie von der Badischen Abteilung zu sagen
sein.
Der Besucher, welcher Ende Mai die Räume be-
tritt, wird ein fertiges Bild vorfinden, wenn auch das
Hinzufügen noch fehlender Kleinigkeiten über diesen
Zeitpunkt hinausfällt. Schon heute steht mit unfehl-
barer Sicherheit fest, dass Turin als ein wesentlicher
Fortschritt im kunstgewerblichen Ausstellungswesen
zu bezeichnen ist, und wie es manche nützliche Lehre
aus der verdienstvollen Darmstädter Ausstellung ge-
zogen hat, so wird auch München 1904 mit Dankbar-
keit auf diese Vorstufen zurückblicken.
EIN ECHTER RAFFAEL ODER
GIULIO ROMANO?
Der tüchtige Porträt- und Historienmaler Heinrich
Kolbe, bekannt durch seine Porträts von Goethe, hat ein
Bild hinterlassen, das Karl Theodor Gaedertz in einer
kleinen mit fünf Bildnissen geschmückten Monographie:
"Qoethe und Maler Kolbe. Ein deutsches Künstlerleben«
(Zweite sehr vermehrte Auflage. Leipzig, Georg Wigand
1900) im Anhang erwähnt: Aus Kolbe's Sammlung:
»Raffael's kleine heilige Familie« (La Vierge au berceau).
Aus dem Besitze des berühmten ersten Präsidenten
des Pariser Parlaments de Saron scheint dies vorzüglich
erhaltene Bild in Kolbe's Hände gelangt zu sein, der es
später, in Düsseldorf, von Schadow und den Brüdern
Andreas und Karl Müller genau prüfen liess. Dasselbe
wurde 1872 mit dem Exemplar, das sich im Louvre be-
findet, verglichen und amtlich bezeugt, dass die Doublette
dem genannten in nichts nachstehe. Ja, Suermondt erklärte
1880: »Stände mir die Wahl frei, ich würde unbedenklich
dem Düsseldorfer den Vorzug geben«.
Die von Gaedertz mitgeteilten Urteile sind für die
Verwaltung von Museen, sowie für Kunstmäcene von Be-
deutung, da der kleine Schatz, aus Kolbe's Nachlass von
Herrn Karl Maximilian Schreiner in Düsseldorf ererbt,
gegenwärtig verkäuflich ist. Durch Herrn Professor
Gaedertz in Berlin erhalten wir als Ergänzung zu seiner
Schrift jetzt einen bisher noch unveröffentlichten Brief
Morelli's, der sich zur Sache also vernehmen lässt:
Wie Sie wahrscheinlich so gut wie ich wissen, existiert
ein guter Stich nach dem Bildchen vom Veroneser Jacopo
Caraglio, etwa um 1524—30 ausgeführt. Über dem Namen
des Stechers steht der Buchstabe R — der Raffael bedeuten
soll —, ein Beweis, dass also schon damals, also kurz
nach dem Tode des Urbinaten, diese Komposition ihm
zugeschrieben wurde; auch hat dieselbe durchaus den
Raffaelischen Charakter und lässt sich, mit einigen Modi-
fikationen, auf die Komposition der bekannten sogenannten
Madonna di Casa Canigiani (1507), jetzt in der Münchner
Pinakothek, zurückführen.
Erlauben Sie mir nun, nach der Photographie, Ihr
Bildchen zu analysieren.
Der technischen Behandlung nach, in der Modellierung,
in dem Faltenwurfe, in der Verteilung von Licht und
Schatten, weist das Bild auf die spätere Epoche Raffael's