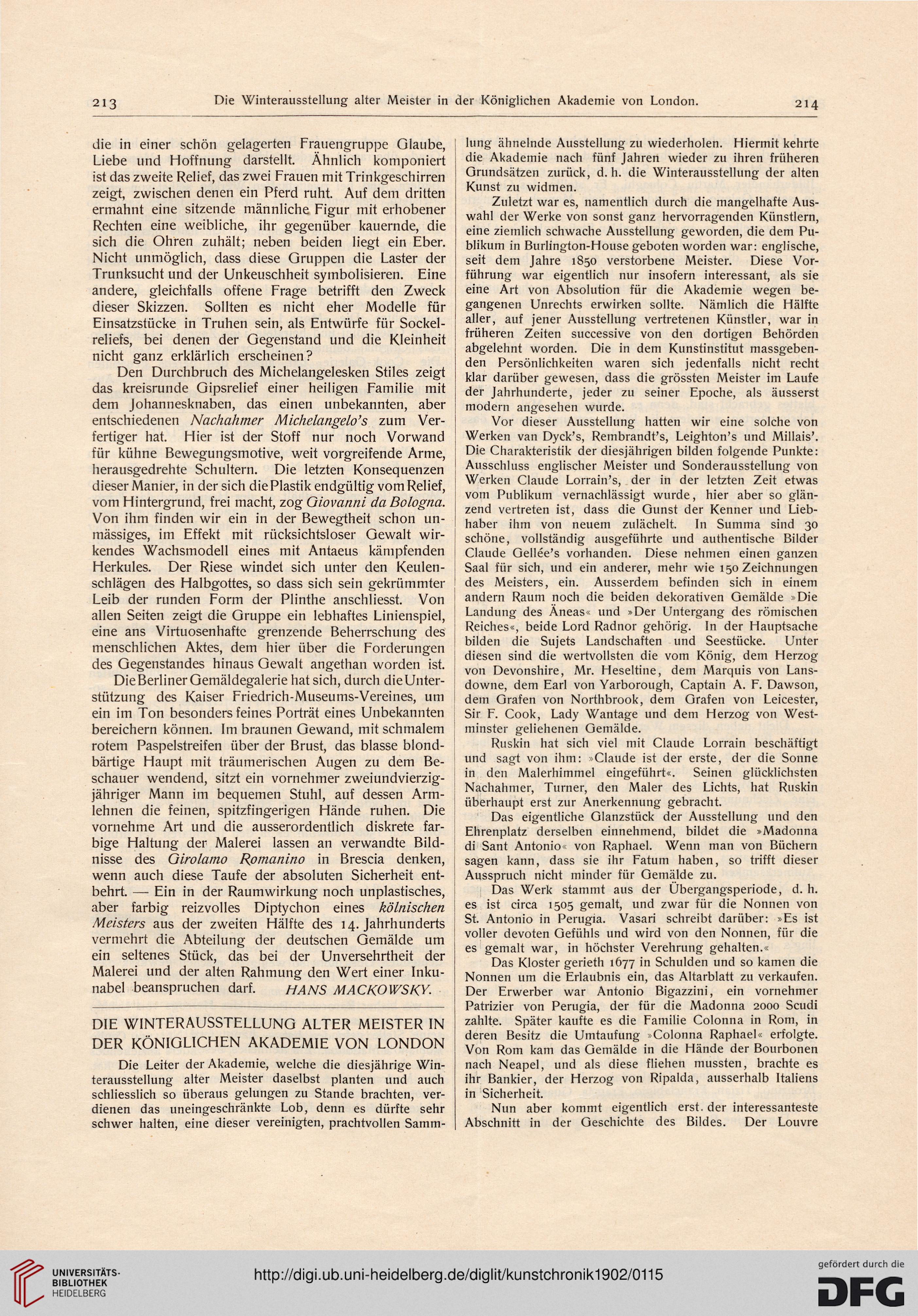213
Die Winterausstellung alter Meister in der Königlichen Akademie von London.
214
die in einer schön gelagerten Frauengruppe Glaube, I
Liebe und Hoffnung darstellt. Ähnlich komponiert
ist das zweite Relief, das zwei Frauen mit Trinkgeschirren
zeigt, zwischen denen ein Pferd ruht. Auf dem dritten
ermahnt eine sitzende männliche Figur mit erhobener
Rechten eine weibliche, ihr gegenüber kauernde, die
sich die Ohren zuhält; neben beiden liegt ein Eber.
Nicht unmöglich, dass diese Gruppen die Laster der
Trunksucht und der Unkeuschheit symbolisieren. Eine
andere, gleichfalls offene Frage betrifft den Zweck
dieser Skizzen. Sollten es nicht eher Modelle für
Einsatzstücke in Truhen sein, als Entwürfe für Sockel-
reliefs, bei denen der Gegenstand und die Kleinheit
nicht ganz erklärlich erscheinen?
Den Durchbruch des Michelangelesken Stiles zeigt
das kreisrunde Gipsrelief einer heiligen Familie mit
dem Johannesknaben, das einen unbekannten, aber
entschiedenen Nachahmer Michelangelo's zum Ver-
fertiger hat. Hier ist der Stoff nur noch Vorwand
für kühne Bewegungsmotive, weit vorgreifende Arme,
herausgedrehte Schultern. Die letzten Konsequenzen
dieser Manier, in der sich die Plastik endgültig vom Relief,
vom Hintergrund, frei macht, zog Giovanni da Bologna.
Von ihm finden wir ein in der Bewegtheit schon un- |
mässiges, im Effekt mit rücksichtsloser Gewalt wir-
kendes Wachsmodell eines mit Antaeus kämpfenden I
Herkules. Der Riese windet sich unter den Keulen- j
Schlägen des Halbgottes, so dass sich sein gekrümmter j
Leib der runden Form der Plinthe anschliesst. Von
allen Seiten zeigt die Gruppe ein lebhaftes Linienspiel,
eine ans Virtuosenhaftc grenzende Beherrschung des j
menschlichen Aktes, dem hier über die Forderungen
des Gegenstandes hinaus Gewalt angethan worden ist.
Die Berliner Gemäldegalerie hat sich, durch die Unter-
stützung des Kaiser Friedrich-Museums-Vereines, um I
ein im Ton besonders feines Porträt eines Unbekannten
bereichern können. Im braunen Gewand, mit schmalem
rotem Paspelstreifen über der Brust, das blasse blond-
bärtige Haupt mit träumerischen Augen zu dem Be-
schauer wendend, sitzt ein vornehmer zweiundvierzig-
jähriger Mann im bequemen Stuhl, auf dessen Arm- j
lehnen die feinen, spitzfingerigen Hände ruhen. Die
vornehme Art und die ausserordentlich diskrete far-
bige Haltung der Malerei lassen an verwandte Bild-
nisse des Qirolamo Romanino in Brescia denken,
wenn auch diese Taufe der absoluten Sicherheit ent-
behrt. — Ein in der Raumwirkung noch unplastisches,
aber farbig reizvolles Diptychon eines kölnischen
Meisters aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
vermehrt die Abteilung der deutschen Gemälde um
ein seltenes Stück, das bei der Unversehrtheit der
Malerei und der alten Rahmung den Wert einer Inku-
nabel beanspruchen darf. HANS MACKOWSKY.
DIE WINTERAUSSTELLUNG ALTER MEISTER IN
DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE VON LONDON
Die Leiter der Akademie, welche die diesjährige Win-
terausstellung alter Meister daselbst planten und auch
schliesslich so überaus gelungen zu Stande brachten, ver-
dienen das uneingeschränkte Lob, denn es dürfte sehr
schwer halten, eine dieser vereinigten, prachtvollen Samm-
lung ähnelnde Ausstellung zu wiederholen. Hiermit kehrte
die Akademie nach fünf Jahren wieder zu ihren früheren
Grundsätzen zurück, d. h. die Winterausstellung der alten
Kunst zu widmen.
Zuletzt war es, namentlich durch die mangelhafte Aus-
wahl der Werke von sonst ganz hervorragenden Künstlern,
eine ziemlich schwache Ausstellung geworden, die dem Pu-
blikum in Burlington-House geboten worden war: englische,
seit dem Jahre 1850 verstorbene Meister. Diese Vor-
führung war eigentlich nur insofern interessant, als sie
eine Art von Absolution für die Akademie wegen be-
gangenen Unrechts erwirken sollte. Nämlich die Hälfte
aller, auf jener Ausstellung vertretenen Künstler, war in
früheren Zeiten successive von den dortigen Behörden
abgelehnt worden. Die in dem Kunstinstitut massgeben-
den Persönlichkeiten waren sich jedenfalls nicht recht
klar darüber gewesen, dass die grössten Meister im Laufe
der Jahrhunderte, jeder zu seiner Epoche, als äusserst
modern angesehen wurde.
Vor dieser Ausstellung hatten wir eine solche von
Werken van Dyck's, Rembrandt's, Leighton's und Millais'.
Die Charakteristik der diesjährigen bilden folgende Punkte:
Ausschluss englischer Meister und Sonderausstellung von
Werken Claude Lorrain's, der in der letzten Zeit etwas
vom Publikum vernachlässigt wurde, hier aber so glän-
zend vertreten ist, dass die Gunst der Kenner und Lieb-
haber ihm von neuem zulächelt. In Summa sind 30
schöne, vollständig ausgeführte und authentische Bilder
Claude Gellee's vorhanden. Diese nehmen einen ganzen
Saal für sich, und ein anderer, mehr wie 150 Zeichnungen
des Meisters, ein. Ausserdem befinden sich in einem
andern Raum noch die beiden dekorativen Gemälde »Die
Landung des Äneas« und »Der Untergang des römischen
Reiches«, beide Lord Radnor gehörig. In der Hauptsache
bilden die Sujets Landschaften und Seestücke. Unter
diesen sind die wertvollsten die vom König, dem Herzog
von Devonshire, Mr. Heseltine, dem Marquis von Lans-
downe, dem Earl von Yarborough, Captain A. F. Dawson,
dem Grafen von Northbrook, dem Grafen von Leicester,
Sir F. Cook, Lady Wantage und dem Herzog von West-
minster geliehenen Gemälde.
Ruskin hat sich viel mit Claude Lorrain beschäftigt
und sagt von ihm: »Claude ist der erste, der die Sonne
in den Malerhimmel eingeführt«. Seinen glücklichsten
Nachahmer, Turner, den Maler des Lichts, hat Ruskin
überhaupt erst zur Anerkennung gebracht.
Das eigentliche Glanzstück der Ausstellung und den
Ehrenplatz derselben einnehmend, bildet die »Madonna
di Sant Antonio« von Raphael. Wenn man von Büchern
sagen kann, dass sie ihr Fatum haben, so trifft dieser
Ausspruch nicht minder für Gemälde zu.
Das Werk stammt aus der Übergangsperiode, d. h.
es ist circa 1505 gemalt, und zwar für die Nonnen von
St. Antonio in Perugia. Vasari schreibt darüber: »Es ist
voller devoten Gefühls und wird von den Nonnen, für die
es gemalt war, in höchster Verehrung gehalten.«
Das Kloster gerieth 1677 in Schulden und so kamen die
Nonnen um die Erlaubnis ein, das Altarblatt zu verkaufen.
Der Erwerber war Antonio Bigazzini, ein vornehmer
Patrizier von Perugia, der für die Madonna 2000 Scudi
zahlte. Später kaufte es die Familie Colonna in Rom, in
deren Besitz die Umtaufung »Colonna Raphael« erfolgte.
Von Rom kam das Gemälde in die Hände der Bourbonen
nach Neapel, und als diese fliehen mussten, brachte es
ihr Bankier, der Herzog von Ripalda, ausserhalb Italiens
in Sicherheit.
Nun aber kommt eigentlich erst, der interessanteste
Abschnitt in der Geschichte des Bildes. Der Louvre
Die Winterausstellung alter Meister in der Königlichen Akademie von London.
214
die in einer schön gelagerten Frauengruppe Glaube, I
Liebe und Hoffnung darstellt. Ähnlich komponiert
ist das zweite Relief, das zwei Frauen mit Trinkgeschirren
zeigt, zwischen denen ein Pferd ruht. Auf dem dritten
ermahnt eine sitzende männliche Figur mit erhobener
Rechten eine weibliche, ihr gegenüber kauernde, die
sich die Ohren zuhält; neben beiden liegt ein Eber.
Nicht unmöglich, dass diese Gruppen die Laster der
Trunksucht und der Unkeuschheit symbolisieren. Eine
andere, gleichfalls offene Frage betrifft den Zweck
dieser Skizzen. Sollten es nicht eher Modelle für
Einsatzstücke in Truhen sein, als Entwürfe für Sockel-
reliefs, bei denen der Gegenstand und die Kleinheit
nicht ganz erklärlich erscheinen?
Den Durchbruch des Michelangelesken Stiles zeigt
das kreisrunde Gipsrelief einer heiligen Familie mit
dem Johannesknaben, das einen unbekannten, aber
entschiedenen Nachahmer Michelangelo's zum Ver-
fertiger hat. Hier ist der Stoff nur noch Vorwand
für kühne Bewegungsmotive, weit vorgreifende Arme,
herausgedrehte Schultern. Die letzten Konsequenzen
dieser Manier, in der sich die Plastik endgültig vom Relief,
vom Hintergrund, frei macht, zog Giovanni da Bologna.
Von ihm finden wir ein in der Bewegtheit schon un- |
mässiges, im Effekt mit rücksichtsloser Gewalt wir-
kendes Wachsmodell eines mit Antaeus kämpfenden I
Herkules. Der Riese windet sich unter den Keulen- j
Schlägen des Halbgottes, so dass sich sein gekrümmter j
Leib der runden Form der Plinthe anschliesst. Von
allen Seiten zeigt die Gruppe ein lebhaftes Linienspiel,
eine ans Virtuosenhaftc grenzende Beherrschung des j
menschlichen Aktes, dem hier über die Forderungen
des Gegenstandes hinaus Gewalt angethan worden ist.
Die Berliner Gemäldegalerie hat sich, durch die Unter-
stützung des Kaiser Friedrich-Museums-Vereines, um I
ein im Ton besonders feines Porträt eines Unbekannten
bereichern können. Im braunen Gewand, mit schmalem
rotem Paspelstreifen über der Brust, das blasse blond-
bärtige Haupt mit träumerischen Augen zu dem Be-
schauer wendend, sitzt ein vornehmer zweiundvierzig-
jähriger Mann im bequemen Stuhl, auf dessen Arm- j
lehnen die feinen, spitzfingerigen Hände ruhen. Die
vornehme Art und die ausserordentlich diskrete far-
bige Haltung der Malerei lassen an verwandte Bild-
nisse des Qirolamo Romanino in Brescia denken,
wenn auch diese Taufe der absoluten Sicherheit ent-
behrt. — Ein in der Raumwirkung noch unplastisches,
aber farbig reizvolles Diptychon eines kölnischen
Meisters aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
vermehrt die Abteilung der deutschen Gemälde um
ein seltenes Stück, das bei der Unversehrtheit der
Malerei und der alten Rahmung den Wert einer Inku-
nabel beanspruchen darf. HANS MACKOWSKY.
DIE WINTERAUSSTELLUNG ALTER MEISTER IN
DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE VON LONDON
Die Leiter der Akademie, welche die diesjährige Win-
terausstellung alter Meister daselbst planten und auch
schliesslich so überaus gelungen zu Stande brachten, ver-
dienen das uneingeschränkte Lob, denn es dürfte sehr
schwer halten, eine dieser vereinigten, prachtvollen Samm-
lung ähnelnde Ausstellung zu wiederholen. Hiermit kehrte
die Akademie nach fünf Jahren wieder zu ihren früheren
Grundsätzen zurück, d. h. die Winterausstellung der alten
Kunst zu widmen.
Zuletzt war es, namentlich durch die mangelhafte Aus-
wahl der Werke von sonst ganz hervorragenden Künstlern,
eine ziemlich schwache Ausstellung geworden, die dem Pu-
blikum in Burlington-House geboten worden war: englische,
seit dem Jahre 1850 verstorbene Meister. Diese Vor-
führung war eigentlich nur insofern interessant, als sie
eine Art von Absolution für die Akademie wegen be-
gangenen Unrechts erwirken sollte. Nämlich die Hälfte
aller, auf jener Ausstellung vertretenen Künstler, war in
früheren Zeiten successive von den dortigen Behörden
abgelehnt worden. Die in dem Kunstinstitut massgeben-
den Persönlichkeiten waren sich jedenfalls nicht recht
klar darüber gewesen, dass die grössten Meister im Laufe
der Jahrhunderte, jeder zu seiner Epoche, als äusserst
modern angesehen wurde.
Vor dieser Ausstellung hatten wir eine solche von
Werken van Dyck's, Rembrandt's, Leighton's und Millais'.
Die Charakteristik der diesjährigen bilden folgende Punkte:
Ausschluss englischer Meister und Sonderausstellung von
Werken Claude Lorrain's, der in der letzten Zeit etwas
vom Publikum vernachlässigt wurde, hier aber so glän-
zend vertreten ist, dass die Gunst der Kenner und Lieb-
haber ihm von neuem zulächelt. In Summa sind 30
schöne, vollständig ausgeführte und authentische Bilder
Claude Gellee's vorhanden. Diese nehmen einen ganzen
Saal für sich, und ein anderer, mehr wie 150 Zeichnungen
des Meisters, ein. Ausserdem befinden sich in einem
andern Raum noch die beiden dekorativen Gemälde »Die
Landung des Äneas« und »Der Untergang des römischen
Reiches«, beide Lord Radnor gehörig. In der Hauptsache
bilden die Sujets Landschaften und Seestücke. Unter
diesen sind die wertvollsten die vom König, dem Herzog
von Devonshire, Mr. Heseltine, dem Marquis von Lans-
downe, dem Earl von Yarborough, Captain A. F. Dawson,
dem Grafen von Northbrook, dem Grafen von Leicester,
Sir F. Cook, Lady Wantage und dem Herzog von West-
minster geliehenen Gemälde.
Ruskin hat sich viel mit Claude Lorrain beschäftigt
und sagt von ihm: »Claude ist der erste, der die Sonne
in den Malerhimmel eingeführt«. Seinen glücklichsten
Nachahmer, Turner, den Maler des Lichts, hat Ruskin
überhaupt erst zur Anerkennung gebracht.
Das eigentliche Glanzstück der Ausstellung und den
Ehrenplatz derselben einnehmend, bildet die »Madonna
di Sant Antonio« von Raphael. Wenn man von Büchern
sagen kann, dass sie ihr Fatum haben, so trifft dieser
Ausspruch nicht minder für Gemälde zu.
Das Werk stammt aus der Übergangsperiode, d. h.
es ist circa 1505 gemalt, und zwar für die Nonnen von
St. Antonio in Perugia. Vasari schreibt darüber: »Es ist
voller devoten Gefühls und wird von den Nonnen, für die
es gemalt war, in höchster Verehrung gehalten.«
Das Kloster gerieth 1677 in Schulden und so kamen die
Nonnen um die Erlaubnis ein, das Altarblatt zu verkaufen.
Der Erwerber war Antonio Bigazzini, ein vornehmer
Patrizier von Perugia, der für die Madonna 2000 Scudi
zahlte. Später kaufte es die Familie Colonna in Rom, in
deren Besitz die Umtaufung »Colonna Raphael« erfolgte.
Von Rom kam das Gemälde in die Hände der Bourbonen
nach Neapel, und als diese fliehen mussten, brachte es
ihr Bankier, der Herzog von Ripalda, ausserhalb Italiens
in Sicherheit.
Nun aber kommt eigentlich erst, der interessanteste
Abschnitt in der Geschichte des Bildes. Der Louvre