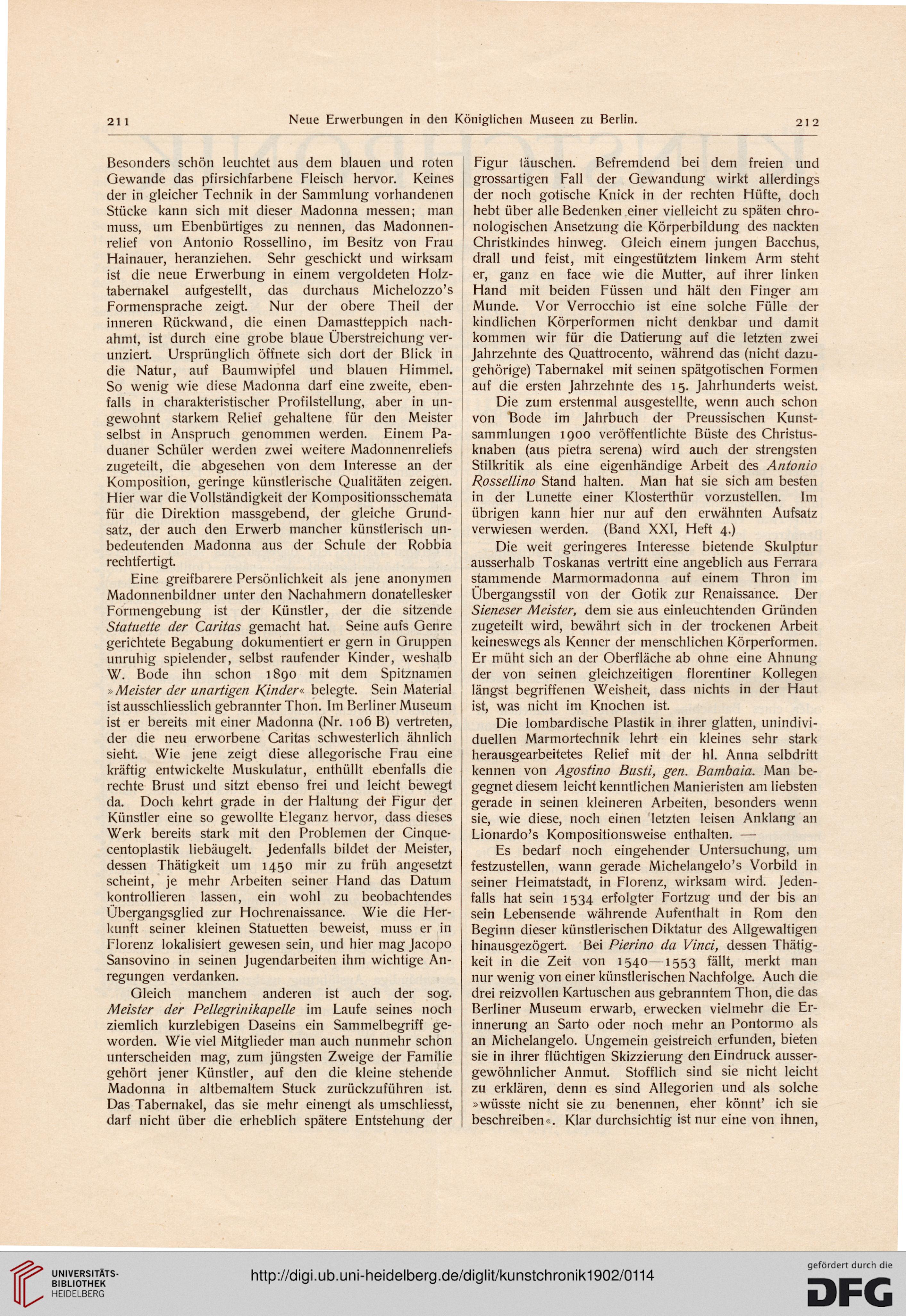21 1
Neue Erwerbungen in den Königlichen Museen zu Berlin.
2 1 2
Besonders schön leuchtet aus dem blauen und roten
Gewände das pfirsichfarbene Fleisch hervor. Keines
der in gleicher Technik in der Sammlung vorhandenen
Stücke kann sich mit dieser Madonna messen; man
muss, um Ebenbürtiges zu nennen, das Madonnen-
relief von Antonio Rossellino, im Besitz von Frau
Hainauer, heranziehen. Sehr geschickt und wirksam
ist die neue Erwerbung in einem vergoldeten Holz-
tabernakel aufgestellt, das durchaus Michelozzo's
Formensprache zeigt. Nur der obere Theil der
inneren Rückwand, die einen Damastteppich nach-
ahmt, ist durch eine grobe blaue Überstreichung ver-
unziert. Ursprünglich öffnete sich dort der Blick in
die Natur, auf Baumwipfel und blauen Himmel.
So wenig wie diese Madonna darf eine zweite, eben-
falls in charakteristischer Profilstellung, aber in un-
gewohnt starkem Relief gehaltene für den Meister
selbst in Anspruch genommen werden. Einem Pa-
duaner Schüler werden zwei weitere Madonnenreliefs
zugeteilt, die abgesehen von dem Interesse an der
Komposition, geringe künstlerische Qualitäten zeigen.
Hier war die Vollständigkeit der Kompositionsschemata
für die Direktion massgebend, der gleiche Grund-
satz, der auch den Erwerb mancher künstlerisch un-
bedeutenden Madonna aus der Schule der Robbia
rechtfertigt.
Eine greifbarere Persönlichkeit als jene anonymen
Madonnenbildner unter den Nachahmern donatellesker
Formengebung ist der Künstler, der die sitzende
Statuette der Caritas gemacht hat. Seine aufs Genre
gerichtete Begabung dokumentiert er gern in Gruppen
unruhig spielender, selbst raufender Kinder, weshalb
W. Bode ihn schon 1890 mit dem Spitznamen
»Meister der unartigen Kinder« belegte. Sein Material
ist ausschliesslich gebrannter Thon. Im Berliner Museum
ist er bereits mit einer Madonna (Nr. 106 B) vertreten,
der die neu erworbene Caritas schwesterlich ähnlich
sieht. Wie jene zeigt diese allegorische Frau eine
kräftig entwickelte Muskulatur, enthüllt ebenfalls die
rechte Brust und sitzt ebenso frei und leicht bewegt
da. Doch kehrt grade in der Haltung der Figur der
Künstler eine so gewollte Eleganz hervor, dass dieses
Werk bereits stark mit den Problemen der Cinque-
centoplastik liebäugelt. Jedenfalls bildet der Meister,
dessen Thätigkeit um 1450 mir zu früh angesetzt
scheint, je mehr Arbeiten seiner Hand das Datum
kontrollieren lassen, ein wohl zu beobachtendes
Übergangsglied zur Hochrenaissance. Wie die Her-
kunft seiner kleinen Statuetten beweist, muss er in
Florenz lokalisiert gewesen sein, und hier mag Jacopo
Sansovino in seinen Jugendarbeiten ihm wichtige An-
regungen verdanken.
Gleich manchem anderen ist auch der sog.
Meister der Pellegrinikapelle im Laufe seines noch
ziemlich kurzlebigen Daseins ein Sammelbegriff ge-
worden. Wie viel Mitglieder man auch nunmehr schon
unterscheiden mag, zum jüngsten Zweige der Familie
gehört jener Künstler, auf den die kleine stehende
Madonna in altbemaltem Stuck zurückzuführen ist.
Das Tabernakel, das sie mehr einengt als umschliesst,
darf nicht über die erheblich spätere Entstehung der
Figur täuschen. Befremdend bei dem freien und
grossartigen Fall der Gewandung wirkt allerdings
der noch gotische Knick in der rechten Hüfte, doch
hebt über alle Bedenken einer vielleicht zu späten chro-
nologischen Ansetzung die Körperbildung des nackten
Christkindes hinweg. Gleich einem jungen Bacchus,
drall und feist, mit eingestütztem linkem Arm steht
er, ganz en face wie die Mutter, auf ihrer linken
Hand mit beiden Füssen und hält den Finger am
Munde. Vor Verrocchio ist eine solche Fülle der
kindlichen Körperformen nicht denkbar und damit
kommen wir für die Datierung auf die letzten zwei
Jahrzehnte des Quattrocento, während das (nicht dazu-
gehörige) Tabernakel mit seinen spätgotischen Formen
auf die ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts weist.
Die zum erstenmal ausgestellte, wenn auch schon
von Bode im Jahrbuch der Preussischen Kunst-
sammlungen 1900 veröffentlichte Büste des Christus-
knaben (aus pietra Serena) wird auch der strengsten
Stilkritik als eine eigenhändige Arbeit des Antonio
Rossellino Stand halten. Man hat sie sich am besten
in der Lunette einer Klosterthür vorzustellen. Im
übrigen kann hier nur auf den erwähnten Aufsatz
verwiesen werden. (Band XXI, Heft 4.)
Die weit geringeres Interesse bietende Skulptur
ausserhalb Toskanas vertritt eine angeblich aus Ferrara
stammende Marmormadonna auf einem Thron im
Übergangsstil von der Gotik zur Renaissance. Der
Sieneser Meister, dem sie aus einleuchtenden Gründen
zugeteilt wird, bewährt sich in der trockenen Arbeit
keineswegs als Kenner der menschlichen Körperformen.
Er müht sich an der Oberfläche ab ohne eine Ahnung
der von seinen gleichzeitigen florentiner Kollegen
längst begriffenen Weisheit, dass nichts in der Haut
ist, was nicht im Knochen ist.
Die lombardische Plastik in ihrer glatten, unindivi-
duellen Marmortechnik lehrt ein kleines sehr stark
herausgearbeitetes Relief mit der hl. Anna selbdritt
kennen von Agostino Busti, gen. Bambaia. Man be-
gegnet diesem leicht kenntlichen Manieristen am liebsten
gerade in seinen kleineren Arbeiten, besonders wenn
sie, wie diese, noch einen letzten leisen Anklang an
Lionardo's Kompositionsweise enthalten. —
Es bedarf noch eingehender Untersuchung, um
festzustellen, wann gerade Michelangelo's Vorbild in
seiner Heimatstadt, in Florenz, wirksam wird. Jeden-
falls hat sein 1534 erfolgter Fortzug und der bis an
sein Lebensende währende Aufenthalt in Rom den
Beginn dieser künstlerischen Diktatur des Allgewaltigen
hinausgezögert. Bei Pierino da Vinci, dessen Thätig-
keit in die Zeit von 1540 —1553 fällt, merkt man
nur wenig von einer künstlerischen Nachfolge. Auch die
drei reizvollen Kartuschen aus gebranntem Thon, die das
Berliner Museum erwarb, erwecken vielmehr die Er-
innerung an Sarto oder noch mehr an Pontormo als
an Michelangelo. Ungemein geistreich erfunden, bieten
sie in ihrer flüchtigen Skizzierung den Eindruck ausser-
gewöhnlicher Anmut. Stofflich sind sie nicht leicht
zu erklären, denn es sind Allegorien und als solche
»wüsste nicht sie zu benennen, eher könnt' ich sie
beschreiben«. Klar durchsichtig ist nur eine von ihnen,
Neue Erwerbungen in den Königlichen Museen zu Berlin.
2 1 2
Besonders schön leuchtet aus dem blauen und roten
Gewände das pfirsichfarbene Fleisch hervor. Keines
der in gleicher Technik in der Sammlung vorhandenen
Stücke kann sich mit dieser Madonna messen; man
muss, um Ebenbürtiges zu nennen, das Madonnen-
relief von Antonio Rossellino, im Besitz von Frau
Hainauer, heranziehen. Sehr geschickt und wirksam
ist die neue Erwerbung in einem vergoldeten Holz-
tabernakel aufgestellt, das durchaus Michelozzo's
Formensprache zeigt. Nur der obere Theil der
inneren Rückwand, die einen Damastteppich nach-
ahmt, ist durch eine grobe blaue Überstreichung ver-
unziert. Ursprünglich öffnete sich dort der Blick in
die Natur, auf Baumwipfel und blauen Himmel.
So wenig wie diese Madonna darf eine zweite, eben-
falls in charakteristischer Profilstellung, aber in un-
gewohnt starkem Relief gehaltene für den Meister
selbst in Anspruch genommen werden. Einem Pa-
duaner Schüler werden zwei weitere Madonnenreliefs
zugeteilt, die abgesehen von dem Interesse an der
Komposition, geringe künstlerische Qualitäten zeigen.
Hier war die Vollständigkeit der Kompositionsschemata
für die Direktion massgebend, der gleiche Grund-
satz, der auch den Erwerb mancher künstlerisch un-
bedeutenden Madonna aus der Schule der Robbia
rechtfertigt.
Eine greifbarere Persönlichkeit als jene anonymen
Madonnenbildner unter den Nachahmern donatellesker
Formengebung ist der Künstler, der die sitzende
Statuette der Caritas gemacht hat. Seine aufs Genre
gerichtete Begabung dokumentiert er gern in Gruppen
unruhig spielender, selbst raufender Kinder, weshalb
W. Bode ihn schon 1890 mit dem Spitznamen
»Meister der unartigen Kinder« belegte. Sein Material
ist ausschliesslich gebrannter Thon. Im Berliner Museum
ist er bereits mit einer Madonna (Nr. 106 B) vertreten,
der die neu erworbene Caritas schwesterlich ähnlich
sieht. Wie jene zeigt diese allegorische Frau eine
kräftig entwickelte Muskulatur, enthüllt ebenfalls die
rechte Brust und sitzt ebenso frei und leicht bewegt
da. Doch kehrt grade in der Haltung der Figur der
Künstler eine so gewollte Eleganz hervor, dass dieses
Werk bereits stark mit den Problemen der Cinque-
centoplastik liebäugelt. Jedenfalls bildet der Meister,
dessen Thätigkeit um 1450 mir zu früh angesetzt
scheint, je mehr Arbeiten seiner Hand das Datum
kontrollieren lassen, ein wohl zu beobachtendes
Übergangsglied zur Hochrenaissance. Wie die Her-
kunft seiner kleinen Statuetten beweist, muss er in
Florenz lokalisiert gewesen sein, und hier mag Jacopo
Sansovino in seinen Jugendarbeiten ihm wichtige An-
regungen verdanken.
Gleich manchem anderen ist auch der sog.
Meister der Pellegrinikapelle im Laufe seines noch
ziemlich kurzlebigen Daseins ein Sammelbegriff ge-
worden. Wie viel Mitglieder man auch nunmehr schon
unterscheiden mag, zum jüngsten Zweige der Familie
gehört jener Künstler, auf den die kleine stehende
Madonna in altbemaltem Stuck zurückzuführen ist.
Das Tabernakel, das sie mehr einengt als umschliesst,
darf nicht über die erheblich spätere Entstehung der
Figur täuschen. Befremdend bei dem freien und
grossartigen Fall der Gewandung wirkt allerdings
der noch gotische Knick in der rechten Hüfte, doch
hebt über alle Bedenken einer vielleicht zu späten chro-
nologischen Ansetzung die Körperbildung des nackten
Christkindes hinweg. Gleich einem jungen Bacchus,
drall und feist, mit eingestütztem linkem Arm steht
er, ganz en face wie die Mutter, auf ihrer linken
Hand mit beiden Füssen und hält den Finger am
Munde. Vor Verrocchio ist eine solche Fülle der
kindlichen Körperformen nicht denkbar und damit
kommen wir für die Datierung auf die letzten zwei
Jahrzehnte des Quattrocento, während das (nicht dazu-
gehörige) Tabernakel mit seinen spätgotischen Formen
auf die ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts weist.
Die zum erstenmal ausgestellte, wenn auch schon
von Bode im Jahrbuch der Preussischen Kunst-
sammlungen 1900 veröffentlichte Büste des Christus-
knaben (aus pietra Serena) wird auch der strengsten
Stilkritik als eine eigenhändige Arbeit des Antonio
Rossellino Stand halten. Man hat sie sich am besten
in der Lunette einer Klosterthür vorzustellen. Im
übrigen kann hier nur auf den erwähnten Aufsatz
verwiesen werden. (Band XXI, Heft 4.)
Die weit geringeres Interesse bietende Skulptur
ausserhalb Toskanas vertritt eine angeblich aus Ferrara
stammende Marmormadonna auf einem Thron im
Übergangsstil von der Gotik zur Renaissance. Der
Sieneser Meister, dem sie aus einleuchtenden Gründen
zugeteilt wird, bewährt sich in der trockenen Arbeit
keineswegs als Kenner der menschlichen Körperformen.
Er müht sich an der Oberfläche ab ohne eine Ahnung
der von seinen gleichzeitigen florentiner Kollegen
längst begriffenen Weisheit, dass nichts in der Haut
ist, was nicht im Knochen ist.
Die lombardische Plastik in ihrer glatten, unindivi-
duellen Marmortechnik lehrt ein kleines sehr stark
herausgearbeitetes Relief mit der hl. Anna selbdritt
kennen von Agostino Busti, gen. Bambaia. Man be-
gegnet diesem leicht kenntlichen Manieristen am liebsten
gerade in seinen kleineren Arbeiten, besonders wenn
sie, wie diese, noch einen letzten leisen Anklang an
Lionardo's Kompositionsweise enthalten. —
Es bedarf noch eingehender Untersuchung, um
festzustellen, wann gerade Michelangelo's Vorbild in
seiner Heimatstadt, in Florenz, wirksam wird. Jeden-
falls hat sein 1534 erfolgter Fortzug und der bis an
sein Lebensende währende Aufenthalt in Rom den
Beginn dieser künstlerischen Diktatur des Allgewaltigen
hinausgezögert. Bei Pierino da Vinci, dessen Thätig-
keit in die Zeit von 1540 —1553 fällt, merkt man
nur wenig von einer künstlerischen Nachfolge. Auch die
drei reizvollen Kartuschen aus gebranntem Thon, die das
Berliner Museum erwarb, erwecken vielmehr die Er-
innerung an Sarto oder noch mehr an Pontormo als
an Michelangelo. Ungemein geistreich erfunden, bieten
sie in ihrer flüchtigen Skizzierung den Eindruck ausser-
gewöhnlicher Anmut. Stofflich sind sie nicht leicht
zu erklären, denn es sind Allegorien und als solche
»wüsste nicht sie zu benennen, eher könnt' ich sie
beschreiben«. Klar durchsichtig ist nur eine von ihnen,