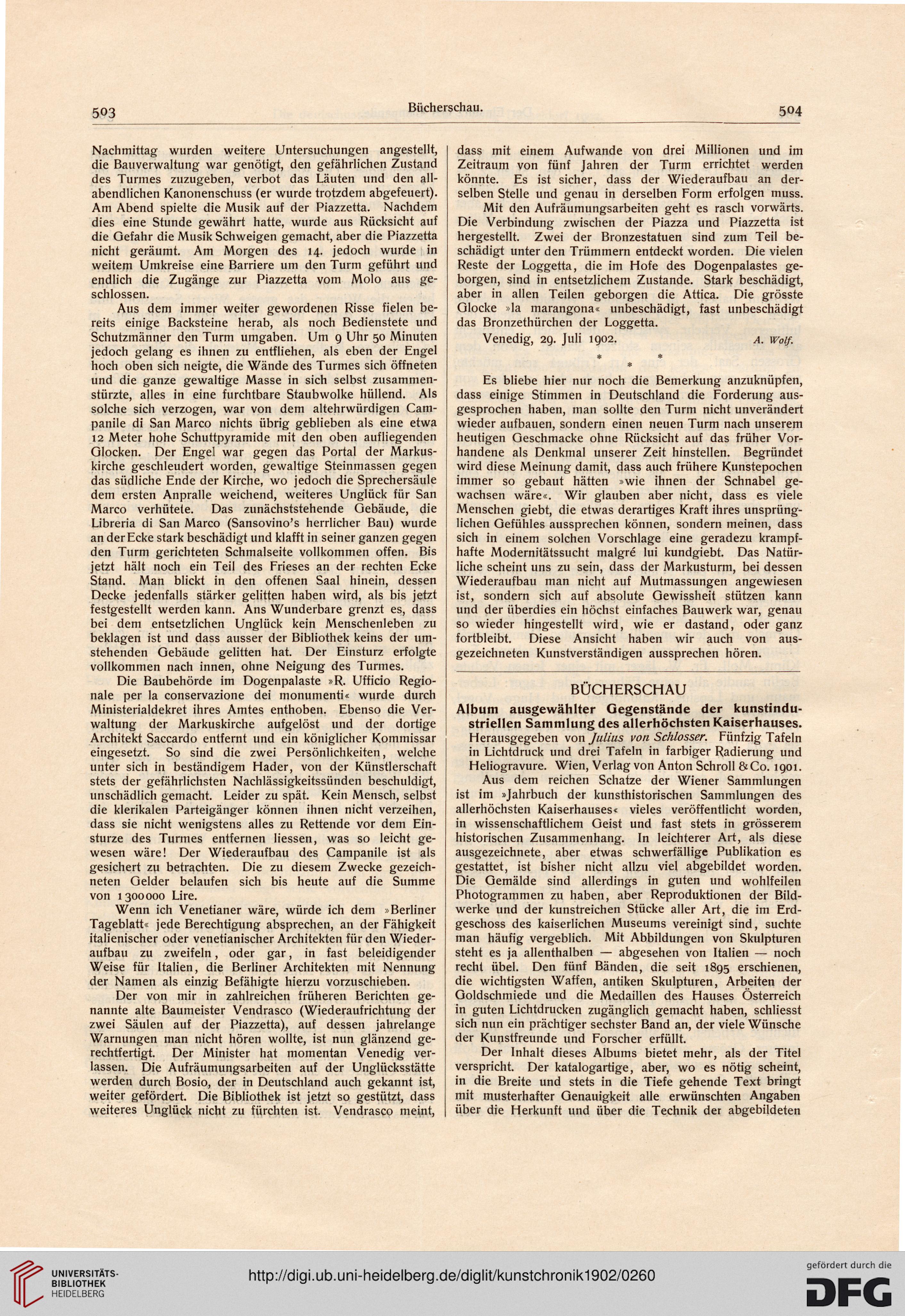503
Bücherschau.
504
Nachmittag wurden weitere Untersuchungen angestellt,
die Bauverwaltung war genötigt, den gefährlichen Zustand
des Turmes zuzugeben, verbot das Läuten und den all-
abendlichen Kanonenschuss (er wurde trotzdem abgefeuert).
Am Abend spielte die Musik auf der Piazzetta. Nachdem
dies eine Stunde gewährt hatte, wurde aus Rücksicht auf
die Gefahr die Musik Schweigen gemacht, aber die Piazzetta
nicht geräumt. Am Morgen des 14. jedoch wurde in
weitem Umkreise eine Barriere um den Turm geführt und
endlich die Zugänge zur Piazzetta vom Molo aus ge-
schlossen.
Aus dem immer weiter gewordenen Risse fielen be-
reits einige Backsteine herab, als noch Bedienstete und
Schutzmänner den Turm umgaben. Um 9 Uhr 50 Minuten
jedoch gelang es ihnen zu entfliehen, als eben der Engel
hoch oben sich neigte, die Wände des Turmes sich öffneten
und die ganze gewaltige Masse in sich selbst zusammen-
stürzte, alles in eine furchtbare Staubwolke hüllend. Als
solche sich verzogen, war von dem altehrwürdigen Cam-
panile di San Marco nichts übrig geblieben als eine etwa
12 Meter hohe Schuttpyramide mit den oben aufliegenden
Glocken. Der Engel war gegen das Portal der Markus-
kirche geschleudert worden, gewaltige Steinmassen gegen
das südliche Ende der Kirche, wo jedoch die Sprechersäule
dem ersten Anpralle weichend, weiteres Unglück für San
Marco verhütete. Das zunächststehende Gebäude, die
Libreria di San Marco (Sansovino's herrlicher Bau) wurde
an der Ecke stark beschädigt und klafft in seiner ganzen gegen
den Turm gerichteten Schmalseite vollkommen offen. Bis
jetzt hält noch ein Teil des Frieses an der rechten Ecke
Stand. Man blickt in den offenen Saal hinein, dessen
Decke jedenfalls stärker gelitten haben wird, als bis jetzt
festgestellt werden kann. Ans Wunderbare grenzt es, dass
bei dem entsetzlichen Unglück kein Menschenleben zu
beklagen ist und dass ausser der Bibliothek keins der um-
stehenden Gebäude gelitten hat. Der Einsturz erfolgte
vollkommen nach innen, ohne Neigung des Turmes.
Die Baubehörde im Dogenpalaste »R. Ufficio Regio-
nale per la conservazione dei monumenti« wurde durch
Ministerialdekret ihres Amtes enthoben. Ebenso die Ver-
waltung der Markuskirche aufgelöst und der dortige
Architekt Saccardo entfernt und ein königlicher Kommissar
eingesetzt. So sind die zwei Persönlichkeiten, welche
unter sich in beständigem Hader, von der Künstlerschaft
stets der gefährlichsten Nachlässigkeitssünden beschuldigt,
unschädlich gemacht. Leider zu spät. Kein Mensch, selbst
die klerikalen Parteigänger können ihnen nicht verzeihen,
dass sie nicht wenigstens alles zu Rettende vor dem Ein-
stürze des Turmes entfernen Hessen, was so leicht ge-
wesen wäre! Der Wiederaufbau des Campanile ist als
gesichert zu betrachten. Die zu diesem Zwecke gezeich-
neten Gelder belaufen sich bis heute auf die Summe
von 1300000 Lire.
Wenn ich Venetianer wäre, würde ich dem »Berliner
Tageblatt« jede Berechtigung absprechen, an der Fähigkeit
italienischer oder venetianischer Architekten für den Wieder-
aufbau zu zweifeln, oder gar, in fast beleidigender
Weise für Italien, die Berliner Architekten mit Nennung
der Namen als einzig Befähigte hierzu vorzuschieben.
Der von mir in zahlreichen früheren Berichten ge-
nannte alte Baumeister Vendrasco (Wiederaufrichtung der
zwei Säulen auf der Piazzetta), auf dessen jahrelange
Warnungen man nicht hören wollte, ist nun glänzend ge-
rechtfertigt. Der Minister hat momentan Venedig ver-
lassen. Die Aufräumungsarbeiten auf der Unglücksstätte
werden durch Bosio, der in Deutschland auch gekannt ist,
weiter gefördert. Die Bibliothek ist jetzt so gestützt, dass
weiteres Unglück nicht zu fürchten ist. Vendrasco meint,
dass mit einem Aufwände von drei Millionen und im
Zeitraum von fünf Jahren der Turm errichtet werden
könnte. Es ist sicher, dass der Wiederaufbau an der-
selben Stelle und genau in derselben Form erfolgen muss.
Mit den Aufräumungsarbeiten geht es rasch vorwärts.
Die Verbindung zwischen der Piazza und Piazzetta ist
hergestellt. Zwei der Bronzestatuen sind zum Teil be-
schädigt unter den Trümmern entdeckt worden. Die vielen
Reste der Loggetta, die im Hofe des Dogenpalastes ge-
borgen, sind in entsetzlichem Zustande. Stark beschädigt,
aber in allen Teilen geborgen die Attica. Die grösste
Glocke »la marangona« unbeschädigt, fast unbeschädigt
das Bronzethürchen der Loggetta.
Venedig, 29. Juli 1902. a. Wolf.
* *
Es bliebe hier nur noch die Bemerkung anzuknüpfen,
dass einige Stimmen in Deutschland die Forderung aus-
gesprochen haben, man sollte den Turm nicht unverändert
wieder aufbauen, sondern einen neuen Turm nach unserem
heutigen Geschmacke ohne Rücksicht auf das früher Vor-
handene als Denkmal unserer Zeit hinstellen. Begründet
wird diese Meinung damit, dass auch frühere Kunstepochen
immer so gebaut hätten »wie ihnen der Schnabel ge-
wachsen wäre«. Wir glauben aber nicht, dass es viele
Menschen giebt, die etwas derartiges Kraft ihres unsprüng-
lichen Gefühles aussprechen können, sondern meinen, dass
sich in einem solchen Vorschlage eine geradezu krampf-
hafte Modernitätssucht malgre lui kundgiebt. Das Natür-
liche scheint uns zu sein, dass der Markusturm, bei dessen
Wiederaufbau man nicht auf Mutmassungen angewiesen
ist, sondern sich auf absolute Gewissheit stützen kann
und der überdies ein höchst einfaches Bauwerk war, genau
so wieder hingestellt wird, wie er dastand, oder ganz
fortbleibt. Diese Ansicht haben wir auch von aus-
gezeichneten Kunstverständigen aussprechen hören.
BÜCHERSCHAU
Album ausgewählter Gegenstände der kunstindu-
striellen Sammlung des allerhöchsten Kaiserhauses.
Herausgegeben von Julius von Schlosser. Fünfzig Tafeln
in Lichtdruck und drei Tafeln in farbiger Radierung und
Heliogravüre. Wien, Verlag von Anton Schroll &Co. 1901.
Aus dem reichen Schatze der Wiener Sammlungen
ist im »Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des
allerhöchsten Kaiserhauses« vieles veröffentlicht worden,
in wissenschaftlichem Geist und fast stets in grösserem
historischen Zusammenhang. In leichterer Art, als diese
ausgezeichnete, aber etwas schwerfällige Publikation es
gestattet, ist bisher nicht allzu viel abgebildet worden.
Die Gemälde sind allerdings in guten und wohlfeilen
Photogrammen zu haben, aber Reproduktionen der Bild-
werke und der kunstreichen Stücke aller Art, die im Erd-
geschoss des kaiserlichen Museums vereinigt sind, suchte
man häufig vergeblich. Mit Abbildungen von Skulpturen
steht es ja allenthalben — abgesehen von Italien — noch
recht übel. Den fünf Bänden, die seit 1895 erschienen,
die wichtigsten Waffen, antiken Skulpturen, Arbeiten der
Goldschmiede und die Medaillen des Hauses Österreich
in guten Lichtdrucken zugänglich gemacht haben, schliesst
sich nun ein prächtiger sechster Band an, der viele Wünsche
der Kunstfreunde und Forscher erfüllt.
Der Inhalt dieses Albums bietet mehr, als der Titel
verspricht. Der katalogartige, aber, wo es nötig scheint,
in die Breite und stets in die Tiefe gehende Text bringt
mit musterhafter Genauigkeit alle erwünschten Angaben
über die Herkunft und über die Technik der abgebildeten
Bücherschau.
504
Nachmittag wurden weitere Untersuchungen angestellt,
die Bauverwaltung war genötigt, den gefährlichen Zustand
des Turmes zuzugeben, verbot das Läuten und den all-
abendlichen Kanonenschuss (er wurde trotzdem abgefeuert).
Am Abend spielte die Musik auf der Piazzetta. Nachdem
dies eine Stunde gewährt hatte, wurde aus Rücksicht auf
die Gefahr die Musik Schweigen gemacht, aber die Piazzetta
nicht geräumt. Am Morgen des 14. jedoch wurde in
weitem Umkreise eine Barriere um den Turm geführt und
endlich die Zugänge zur Piazzetta vom Molo aus ge-
schlossen.
Aus dem immer weiter gewordenen Risse fielen be-
reits einige Backsteine herab, als noch Bedienstete und
Schutzmänner den Turm umgaben. Um 9 Uhr 50 Minuten
jedoch gelang es ihnen zu entfliehen, als eben der Engel
hoch oben sich neigte, die Wände des Turmes sich öffneten
und die ganze gewaltige Masse in sich selbst zusammen-
stürzte, alles in eine furchtbare Staubwolke hüllend. Als
solche sich verzogen, war von dem altehrwürdigen Cam-
panile di San Marco nichts übrig geblieben als eine etwa
12 Meter hohe Schuttpyramide mit den oben aufliegenden
Glocken. Der Engel war gegen das Portal der Markus-
kirche geschleudert worden, gewaltige Steinmassen gegen
das südliche Ende der Kirche, wo jedoch die Sprechersäule
dem ersten Anpralle weichend, weiteres Unglück für San
Marco verhütete. Das zunächststehende Gebäude, die
Libreria di San Marco (Sansovino's herrlicher Bau) wurde
an der Ecke stark beschädigt und klafft in seiner ganzen gegen
den Turm gerichteten Schmalseite vollkommen offen. Bis
jetzt hält noch ein Teil des Frieses an der rechten Ecke
Stand. Man blickt in den offenen Saal hinein, dessen
Decke jedenfalls stärker gelitten haben wird, als bis jetzt
festgestellt werden kann. Ans Wunderbare grenzt es, dass
bei dem entsetzlichen Unglück kein Menschenleben zu
beklagen ist und dass ausser der Bibliothek keins der um-
stehenden Gebäude gelitten hat. Der Einsturz erfolgte
vollkommen nach innen, ohne Neigung des Turmes.
Die Baubehörde im Dogenpalaste »R. Ufficio Regio-
nale per la conservazione dei monumenti« wurde durch
Ministerialdekret ihres Amtes enthoben. Ebenso die Ver-
waltung der Markuskirche aufgelöst und der dortige
Architekt Saccardo entfernt und ein königlicher Kommissar
eingesetzt. So sind die zwei Persönlichkeiten, welche
unter sich in beständigem Hader, von der Künstlerschaft
stets der gefährlichsten Nachlässigkeitssünden beschuldigt,
unschädlich gemacht. Leider zu spät. Kein Mensch, selbst
die klerikalen Parteigänger können ihnen nicht verzeihen,
dass sie nicht wenigstens alles zu Rettende vor dem Ein-
stürze des Turmes entfernen Hessen, was so leicht ge-
wesen wäre! Der Wiederaufbau des Campanile ist als
gesichert zu betrachten. Die zu diesem Zwecke gezeich-
neten Gelder belaufen sich bis heute auf die Summe
von 1300000 Lire.
Wenn ich Venetianer wäre, würde ich dem »Berliner
Tageblatt« jede Berechtigung absprechen, an der Fähigkeit
italienischer oder venetianischer Architekten für den Wieder-
aufbau zu zweifeln, oder gar, in fast beleidigender
Weise für Italien, die Berliner Architekten mit Nennung
der Namen als einzig Befähigte hierzu vorzuschieben.
Der von mir in zahlreichen früheren Berichten ge-
nannte alte Baumeister Vendrasco (Wiederaufrichtung der
zwei Säulen auf der Piazzetta), auf dessen jahrelange
Warnungen man nicht hören wollte, ist nun glänzend ge-
rechtfertigt. Der Minister hat momentan Venedig ver-
lassen. Die Aufräumungsarbeiten auf der Unglücksstätte
werden durch Bosio, der in Deutschland auch gekannt ist,
weiter gefördert. Die Bibliothek ist jetzt so gestützt, dass
weiteres Unglück nicht zu fürchten ist. Vendrasco meint,
dass mit einem Aufwände von drei Millionen und im
Zeitraum von fünf Jahren der Turm errichtet werden
könnte. Es ist sicher, dass der Wiederaufbau an der-
selben Stelle und genau in derselben Form erfolgen muss.
Mit den Aufräumungsarbeiten geht es rasch vorwärts.
Die Verbindung zwischen der Piazza und Piazzetta ist
hergestellt. Zwei der Bronzestatuen sind zum Teil be-
schädigt unter den Trümmern entdeckt worden. Die vielen
Reste der Loggetta, die im Hofe des Dogenpalastes ge-
borgen, sind in entsetzlichem Zustande. Stark beschädigt,
aber in allen Teilen geborgen die Attica. Die grösste
Glocke »la marangona« unbeschädigt, fast unbeschädigt
das Bronzethürchen der Loggetta.
Venedig, 29. Juli 1902. a. Wolf.
* *
Es bliebe hier nur noch die Bemerkung anzuknüpfen,
dass einige Stimmen in Deutschland die Forderung aus-
gesprochen haben, man sollte den Turm nicht unverändert
wieder aufbauen, sondern einen neuen Turm nach unserem
heutigen Geschmacke ohne Rücksicht auf das früher Vor-
handene als Denkmal unserer Zeit hinstellen. Begründet
wird diese Meinung damit, dass auch frühere Kunstepochen
immer so gebaut hätten »wie ihnen der Schnabel ge-
wachsen wäre«. Wir glauben aber nicht, dass es viele
Menschen giebt, die etwas derartiges Kraft ihres unsprüng-
lichen Gefühles aussprechen können, sondern meinen, dass
sich in einem solchen Vorschlage eine geradezu krampf-
hafte Modernitätssucht malgre lui kundgiebt. Das Natür-
liche scheint uns zu sein, dass der Markusturm, bei dessen
Wiederaufbau man nicht auf Mutmassungen angewiesen
ist, sondern sich auf absolute Gewissheit stützen kann
und der überdies ein höchst einfaches Bauwerk war, genau
so wieder hingestellt wird, wie er dastand, oder ganz
fortbleibt. Diese Ansicht haben wir auch von aus-
gezeichneten Kunstverständigen aussprechen hören.
BÜCHERSCHAU
Album ausgewählter Gegenstände der kunstindu-
striellen Sammlung des allerhöchsten Kaiserhauses.
Herausgegeben von Julius von Schlosser. Fünfzig Tafeln
in Lichtdruck und drei Tafeln in farbiger Radierung und
Heliogravüre. Wien, Verlag von Anton Schroll &Co. 1901.
Aus dem reichen Schatze der Wiener Sammlungen
ist im »Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des
allerhöchsten Kaiserhauses« vieles veröffentlicht worden,
in wissenschaftlichem Geist und fast stets in grösserem
historischen Zusammenhang. In leichterer Art, als diese
ausgezeichnete, aber etwas schwerfällige Publikation es
gestattet, ist bisher nicht allzu viel abgebildet worden.
Die Gemälde sind allerdings in guten und wohlfeilen
Photogrammen zu haben, aber Reproduktionen der Bild-
werke und der kunstreichen Stücke aller Art, die im Erd-
geschoss des kaiserlichen Museums vereinigt sind, suchte
man häufig vergeblich. Mit Abbildungen von Skulpturen
steht es ja allenthalben — abgesehen von Italien — noch
recht übel. Den fünf Bänden, die seit 1895 erschienen,
die wichtigsten Waffen, antiken Skulpturen, Arbeiten der
Goldschmiede und die Medaillen des Hauses Österreich
in guten Lichtdrucken zugänglich gemacht haben, schliesst
sich nun ein prächtiger sechster Band an, der viele Wünsche
der Kunstfreunde und Forscher erfüllt.
Der Inhalt dieses Albums bietet mehr, als der Titel
verspricht. Der katalogartige, aber, wo es nötig scheint,
in die Breite und stets in die Tiefe gehende Text bringt
mit musterhafter Genauigkeit alle erwünschten Angaben
über die Herkunft und über die Technik der abgebildeten