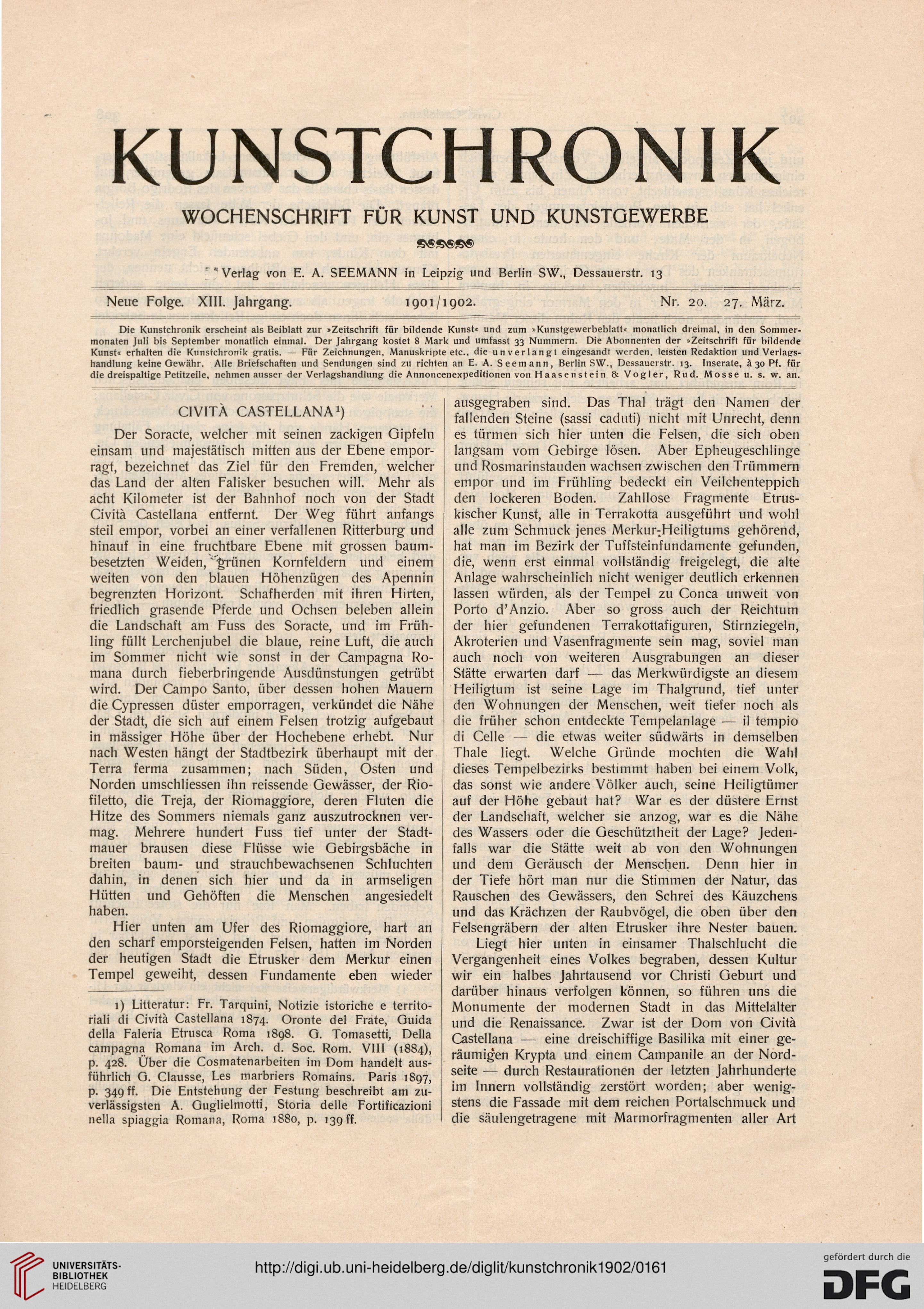KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
~ " Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig und Berlin SW., Dessauerstr. 13
Neue Folge. XIII. Jahrgang. 1901/1902. Nr. 20. 27. März.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik gratis. - Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktton und Verlag:s-
handlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Berlin SW., Dessauerstr. 13. Inserate, ä 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen ausser der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von H a as e n s t ei n & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
CIVITÄ CASTELLANA1)
Der Soracle, welcher mit seinen zackigen Gipfeln
einsam und majestätisch mitten aus der Ebene empor-
ragt, bezeichnet das Ziel für den Fremden, welcher
das Land der alten Falisker besuchen will. Mehr als
acht Kilometer ist der Bahnhof noch von der Stadt
Civitä Castellana entfernt. Der Weg führt anfangs
steil empor, vorbei an einer verfallenen Ritterburg und
hinauf in eine fruchtbare Ebene mit grossen baum-
besetzten Weiden, ''•grünen Kornfeldern und einem
weiten von den blauen Höhenzügen des Apennin
begrenzten Horizont. Schafherden mit ihren Hirten,
friedlich grasende Pferde und Ochsen beleben allein
die Landschaft am Fuss des Soracte, und im Früh-
ling füllt Lerchenjubel die blaue, reine Luft, die auch
im Sommer nicht wie sonst in der Campagna Ro-
mana durch fieberbringende Ausdünstungen getrübt
wird. Der Campo Santo, über dessen hohen Mauern
die Cypressen düster emporragen, verkündet die Nähe
der Stadt, die sich auf einem Felsen trotzig aufgebaut
in mässiger Höhe über der Hochebene erhebt. Nur
nach Westen hängt der Stadtbezirk überhaupt mit der
Terra ferma zusammen; nach Süden, Osten und
Norden umschliessen ihn reissende Gewässer, der Rio-
filetto, die Treja, der Riomaggiore, deren Fluten die
Hitze des Sommers niemals ganz auszutrocknen ver-
mag. Mehrere hundert Fuss tief unter der Stadt-
mauer brausen diese Flüsse wie Gebirgsbäche in
breiten bäum- und strauchbewachsenen Schluchten
dahin, in denen sich hier und da in armseligen
Hütten und Gehöften die Menschen angesiedelt
haben.
Hier unten am Ufer des Riomaggiore, hart an
den scharf emporsteigenden Felsen, hatten im Norden
der heutigen Stadt die Etrusker dem Merkur einen
Tempel geweiht, dessen Fundamente eben wieder
1) Litteratur: Fr. Tarquini, Notizie istoriche e territo-
riali di Civitä Castellana 1874. Oronte del Frate, Ouida
della Faleria Etrusca Roma 1898. O. Tomasetti, Deila
campagna Romana im Arch. d. Soc. Rom. VIII (1884),
p. 428. Über die Cosmatenarbeiten im Dom handelt aus-
führlich O. Clausse, Les marbriers Romains. Paris 1897,
p. 349 ff. Die Entstehung der Festung beschreibt am zu-
verlässigsten A. Quglielmotti, Storia delle Fortificazioni
nella spiaggia Romana, Roma 1880, p. 139 ff.
ausgegraben sind. Das Thal trägt den Namen der
fallenden Steine (sassi caduti) nicht mit Unrecht, denn
es türmen sich hier unten die Felsen, die sich oben
langsam vom Gebirge lösen. Aber Epheugeschlinge
und Rosmarinstauden wachsen zwischen den Trümmern
empor und im Frühling bedeckt ein Veilchenteppich
den lockeren Boden. Zahllose Fragmente Etrus-
kischer Kunst, alle in Terrakotta ausgeführt und wohl
alle zum Schmuck jenes Merkur;Heiligtums gehörend,
hat man im Bezirk der Tuffsteinfundamente gefunden,
die, wenn erst einmal vollständig freigelegt, die alte
Anlage wahrscheinlich nicht weniger deutlich erkennen
lassen würden, als der Tempel zu Conca unweit von
Porto d'Anzio. Aber so gross auch der Reichtum
der hier gefundenen Terrakotlafiguren, Stirnziegeln,
Akroterien und Vasenfragmente sein mag, soviel man
auch noch von weiteren Ausgrabungen an dieser
Stätte erwarten darf — das Merkwürdigste an diesem
Heiligtum ist seine Lage im Thalgrund, tief unter
den Wohnungen der Menschen, weit tiefer noch als
die früher schon entdeckte Tempelanlage — il tempio
di Celle — die etwas weiter südwärts in demselben
Thale liegt. Welche Gründe mochten die Wahl
dieses Tempelbezirks bestimmt haben bei einem Volk,
das sonst wie andere Völker auch, seine Heiligtümer
auf der Höhe gebaut hat? War es der düstere Ernst
der Landschaft, welcher sie anzog, war es die Nähe
des Wassers oder die Geschütztheit der Lage? Jeden-
falls war die Stätte weit ab von den Wohnungen
und dem Geräusch der Menschen. Denn hier in
der Tiefe hört man nur die Stimmen der Natur, das
Rauschen des Gewässers, den Schrei des Käuzchens
und das Krächzen der Raubvögel, die oben über den
Felsengräbern der alten Etrusker ihre Nester bauen.
Liegt hier unten in einsamer Thalschlucht die
Vergangenheit eines Volkes begraben, dessen Kultur
wir ein halbes Jahrtausend vor Christi Geburt und
darüber hinaus verfolgen können, so führen uns die
Monumente der modernen Stadt in das Mittelalter
und die Renaissance. Zwar ist der Dom von Civitä
Castellana — eine dreischiffige Basilika mit einer ge-
räumigen Krypta und einem Campanile an der Nord-
seite — durch Restaurationen der letzten Jahrhunderte
im Innern vollständig zerstört worden; aber wenig-
stens die Fassade mit dem reichen Portalschmuck und
die säulengetragene mit Marmorfragmenten aller Art
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
~ " Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig und Berlin SW., Dessauerstr. 13
Neue Folge. XIII. Jahrgang. 1901/1902. Nr. 20. 27. März.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik gratis. - Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktton und Verlag:s-
handlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Berlin SW., Dessauerstr. 13. Inserate, ä 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen ausser der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von H a as e n s t ei n & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
CIVITÄ CASTELLANA1)
Der Soracle, welcher mit seinen zackigen Gipfeln
einsam und majestätisch mitten aus der Ebene empor-
ragt, bezeichnet das Ziel für den Fremden, welcher
das Land der alten Falisker besuchen will. Mehr als
acht Kilometer ist der Bahnhof noch von der Stadt
Civitä Castellana entfernt. Der Weg führt anfangs
steil empor, vorbei an einer verfallenen Ritterburg und
hinauf in eine fruchtbare Ebene mit grossen baum-
besetzten Weiden, ''•grünen Kornfeldern und einem
weiten von den blauen Höhenzügen des Apennin
begrenzten Horizont. Schafherden mit ihren Hirten,
friedlich grasende Pferde und Ochsen beleben allein
die Landschaft am Fuss des Soracte, und im Früh-
ling füllt Lerchenjubel die blaue, reine Luft, die auch
im Sommer nicht wie sonst in der Campagna Ro-
mana durch fieberbringende Ausdünstungen getrübt
wird. Der Campo Santo, über dessen hohen Mauern
die Cypressen düster emporragen, verkündet die Nähe
der Stadt, die sich auf einem Felsen trotzig aufgebaut
in mässiger Höhe über der Hochebene erhebt. Nur
nach Westen hängt der Stadtbezirk überhaupt mit der
Terra ferma zusammen; nach Süden, Osten und
Norden umschliessen ihn reissende Gewässer, der Rio-
filetto, die Treja, der Riomaggiore, deren Fluten die
Hitze des Sommers niemals ganz auszutrocknen ver-
mag. Mehrere hundert Fuss tief unter der Stadt-
mauer brausen diese Flüsse wie Gebirgsbäche in
breiten bäum- und strauchbewachsenen Schluchten
dahin, in denen sich hier und da in armseligen
Hütten und Gehöften die Menschen angesiedelt
haben.
Hier unten am Ufer des Riomaggiore, hart an
den scharf emporsteigenden Felsen, hatten im Norden
der heutigen Stadt die Etrusker dem Merkur einen
Tempel geweiht, dessen Fundamente eben wieder
1) Litteratur: Fr. Tarquini, Notizie istoriche e territo-
riali di Civitä Castellana 1874. Oronte del Frate, Ouida
della Faleria Etrusca Roma 1898. O. Tomasetti, Deila
campagna Romana im Arch. d. Soc. Rom. VIII (1884),
p. 428. Über die Cosmatenarbeiten im Dom handelt aus-
führlich O. Clausse, Les marbriers Romains. Paris 1897,
p. 349 ff. Die Entstehung der Festung beschreibt am zu-
verlässigsten A. Quglielmotti, Storia delle Fortificazioni
nella spiaggia Romana, Roma 1880, p. 139 ff.
ausgegraben sind. Das Thal trägt den Namen der
fallenden Steine (sassi caduti) nicht mit Unrecht, denn
es türmen sich hier unten die Felsen, die sich oben
langsam vom Gebirge lösen. Aber Epheugeschlinge
und Rosmarinstauden wachsen zwischen den Trümmern
empor und im Frühling bedeckt ein Veilchenteppich
den lockeren Boden. Zahllose Fragmente Etrus-
kischer Kunst, alle in Terrakotta ausgeführt und wohl
alle zum Schmuck jenes Merkur;Heiligtums gehörend,
hat man im Bezirk der Tuffsteinfundamente gefunden,
die, wenn erst einmal vollständig freigelegt, die alte
Anlage wahrscheinlich nicht weniger deutlich erkennen
lassen würden, als der Tempel zu Conca unweit von
Porto d'Anzio. Aber so gross auch der Reichtum
der hier gefundenen Terrakotlafiguren, Stirnziegeln,
Akroterien und Vasenfragmente sein mag, soviel man
auch noch von weiteren Ausgrabungen an dieser
Stätte erwarten darf — das Merkwürdigste an diesem
Heiligtum ist seine Lage im Thalgrund, tief unter
den Wohnungen der Menschen, weit tiefer noch als
die früher schon entdeckte Tempelanlage — il tempio
di Celle — die etwas weiter südwärts in demselben
Thale liegt. Welche Gründe mochten die Wahl
dieses Tempelbezirks bestimmt haben bei einem Volk,
das sonst wie andere Völker auch, seine Heiligtümer
auf der Höhe gebaut hat? War es der düstere Ernst
der Landschaft, welcher sie anzog, war es die Nähe
des Wassers oder die Geschütztheit der Lage? Jeden-
falls war die Stätte weit ab von den Wohnungen
und dem Geräusch der Menschen. Denn hier in
der Tiefe hört man nur die Stimmen der Natur, das
Rauschen des Gewässers, den Schrei des Käuzchens
und das Krächzen der Raubvögel, die oben über den
Felsengräbern der alten Etrusker ihre Nester bauen.
Liegt hier unten in einsamer Thalschlucht die
Vergangenheit eines Volkes begraben, dessen Kultur
wir ein halbes Jahrtausend vor Christi Geburt und
darüber hinaus verfolgen können, so führen uns die
Monumente der modernen Stadt in das Mittelalter
und die Renaissance. Zwar ist der Dom von Civitä
Castellana — eine dreischiffige Basilika mit einer ge-
räumigen Krypta und einem Campanile an der Nord-
seite — durch Restaurationen der letzten Jahrhunderte
im Innern vollständig zerstört worden; aber wenig-
stens die Fassade mit dem reichen Portalschmuck und
die säulengetragene mit Marmorfragmenten aller Art