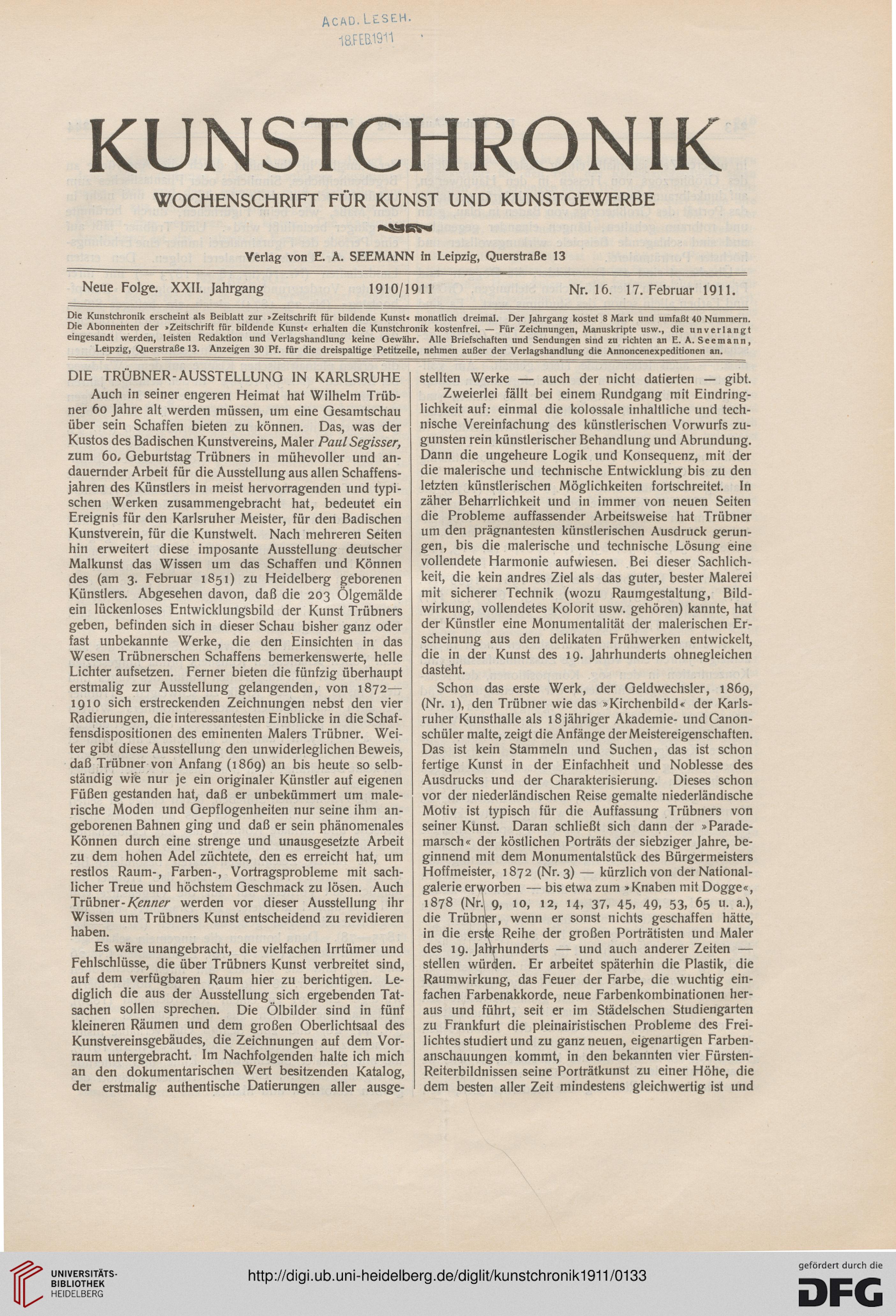ACAD. LESEH.
KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN In Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XXII. Jahrgang 1910/1911 Nr. 16. 17. Februar 1911.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur .Zeitschrift für bildende Kunst« monatlich dreimal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 40 Nummern.
Die Abonnenten der .Zeitschrift für bildende Kunst< erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt
eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann,
_Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen an.
DIE TRÜBNER-AUSSTELLUNO IN KARLSRUHE
Auch in seiner engeren Heimat hat Wilhelm Trüb-
ner 60 Jahre alt werden müssen, um eine Oesamtschau
über sein Schaffen bieten zu können. Das, was der
Kustos des Badischen Kunstvereins, Maler Paul Segisser,
zum 6o. Geburtstag Trübners in mühevoller und an-
dauernder Arbeit für die Ausstellung aus allen Schaffens-
jahren des Künstlers in meist hervorragenden und typi-
schen Werken zusammengebracht hat, bedeutet ein
Ereignis für den Karlsruher Meister, für den Badischen
Kunstverein, für die Kunstwelt. Nach mehreren Seiten
hin erweitert diese imposante Ausstellung deutscher
Malkunst das Wissen um das Schaffen und Können
des (am 3. Februar 1851) zu Heidelberg geborenen
Künstlers. Abgesehen davon, daß die 203 Ölgemälde
ein lückenloses Entwicklungsbild der Kunst Trübners
geben, befinden sich in dieser Schau bisher ganz oder
fast unbekannte Werke, die den Einsichten in das
Wesen Trübnerschen Schaffens bemerkenswerte, helle
Lichter aufsetzen. Ferner bieten die fünfzig überhaupt
erstmalig zur Ausstellung gelangenden, von 1872—
1910 sich erstreckenden Zeichnungen nebst den vier
Radierungen, die interessantesten Einblicke in die Schaf-
fensdispositionen des eminenten Malers Trübner. Wei-
ter gibt diese Ausstellung den unwiderleglichen Beweis,
daß Trübner von Anfang (1869) an bis heute so selb-
ständig wie nur je ein originaler Künstler auf eigenen
Füßen gestanden hat, daß er unbekümmert um male-
rische Moden und Gepflogenheiten nur seine ihm an-
geborenen Bahnen ging und daß er sein phänomenales
Können durch eine strenge und unausgesetzte Arbeit
zu dem hohen Adel züchtete, den es erreicht hat, um
restlos Raum-, Farben-, Vortragsprobleme mit sach-
licher Treue und höchstem Geschmack zu lösen. Auch
Trübner -Kenner werden vor dieser Ausstellung ihr
Wissen um Trübners Kunst entscheidend zu revidieren
haben.
Es wäre unangebracht, die vielfachen Irrtümer und
Fehlschlüsse, die über Trübners Kunst verbreitet sind,
auf dem verfügbaren Raum hier zu berichtigen. Le-
diglich die aus der Ausstellung sich ergebenden Tat-
sachen sollen sprechen. Die Ölbilder sind in fünf
kleineren Räumen und dem großen Oberlichtsaal des
Kunstvereinsgebäudes, die Zeichnungen auf dem Vor-
raum untergebracht. Im Nachfolgenden halte ich mich
an den dokumentarischen Wert besitzenden Katalog,
der erstmalig authentische Datierungen aller ausge-
stellten Werke — auch der nicht datierten — gibt.
Zweierlei fällt bei einem Rundgang mit Eindring-
lichkeit auf: einmal die kolossale inhaltliche und tech-
nische Vereinfachung des künstlerischen Vorwurfs zu-
gunsten rein künstlerischer Behandlung und Abrundung.
Dann die ungeheure Logik und Konsequenz, mit der
die malerische und technische Entwicklung bis zu den
letzten künstlerischen Möglichkeiten fortschreitet. In
zäher Beharrlichkeit und in immer von neuen Seiten
die Probleme auffassender Arbeitsweise hat Trübner
um den prägnantesten künstlerischen Ausdruck gerun-
gen, bis die malerische und technische Lösung eine
vollendete Harmonie aufwiesen. Bei dieser Sachlich-
keit, die kein andres Ziel als das guter, bester Malerei
mit sicherer Technik (wozu Raumgestaltung, Bild-
wirkung, vollendetes Kolorit usw. gehören) kannte, hat
der Künstler eine Monumentalität der malerischen Er-
scheinung aus den delikaten Frühwerken entwickelt,
die in der Kunst des 19. Jahrhunderts ohnegleichen
dasteht.
Schon das erste Werk, der Geldwechsler, 1869,
(Nr. 1), den Trübner wie das »Kirchenbild« der Karls-
ruher Kunsthalle als 18 jähriger Akademie- und Canon-
schüler malte, zeigt die Anfänge der Meistereigenschaften.
Das ist kein Stammeln und Suchen, das ist schon
fertige Kunst in der Einfachheit und Noblesse des
Ausdrucks und der Charakterisierung. Dieses schon
vor der niederländischen Reise gemalte niederländische
Motiv ist typisch für die Auffassung Trübners von
seiner Kunst. Daran schließt sich dann der »Parade-
marsch« der köstlichen Porträts der siebziger Jahre, be-
ginnend mit dem Monumentalstück des Bürgermeisters
Hoffmeister, 1872 (Nr. 3) — kürzlich von der National-
galerie erworben — bis etwa zum »Knaben mit Dogge«,
1878 (Nri 9, 10, 12, 14, 37, 45, 49, 53, 65 u. a.),
die Trübnjer, wenn er sonst nichts geschaffen hätte,
in die erste Reihe der großen Porträtisten und Maler
des 19. Jahrhunderts — und auch anderer Zeiten —
stellen würden. Er arbeitet späterhin die Plastik, die
Raumwirkung, das Feuer der Farbe, die wuchtig ein-
fachen Farbenakkorde, neue Farbenkombinationen her-
aus und führt, seit er im Städelschen Studiengarten
zu Frankfurt die pleinairistischen Probleme des Frei-
lichtes studiert und zu ganz neuen, eigenartigen Farben-
anschauungen kommt, in den bekannten vier Fürsten-
Reiterbildnissen seine Porträtkunst zu einer Höhe, die
dem besten aller Zeit mindestens gleichwertig ist und
KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN In Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XXII. Jahrgang 1910/1911 Nr. 16. 17. Februar 1911.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur .Zeitschrift für bildende Kunst« monatlich dreimal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 40 Nummern.
Die Abonnenten der .Zeitschrift für bildende Kunst< erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt
eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann,
_Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen an.
DIE TRÜBNER-AUSSTELLUNO IN KARLSRUHE
Auch in seiner engeren Heimat hat Wilhelm Trüb-
ner 60 Jahre alt werden müssen, um eine Oesamtschau
über sein Schaffen bieten zu können. Das, was der
Kustos des Badischen Kunstvereins, Maler Paul Segisser,
zum 6o. Geburtstag Trübners in mühevoller und an-
dauernder Arbeit für die Ausstellung aus allen Schaffens-
jahren des Künstlers in meist hervorragenden und typi-
schen Werken zusammengebracht hat, bedeutet ein
Ereignis für den Karlsruher Meister, für den Badischen
Kunstverein, für die Kunstwelt. Nach mehreren Seiten
hin erweitert diese imposante Ausstellung deutscher
Malkunst das Wissen um das Schaffen und Können
des (am 3. Februar 1851) zu Heidelberg geborenen
Künstlers. Abgesehen davon, daß die 203 Ölgemälde
ein lückenloses Entwicklungsbild der Kunst Trübners
geben, befinden sich in dieser Schau bisher ganz oder
fast unbekannte Werke, die den Einsichten in das
Wesen Trübnerschen Schaffens bemerkenswerte, helle
Lichter aufsetzen. Ferner bieten die fünfzig überhaupt
erstmalig zur Ausstellung gelangenden, von 1872—
1910 sich erstreckenden Zeichnungen nebst den vier
Radierungen, die interessantesten Einblicke in die Schaf-
fensdispositionen des eminenten Malers Trübner. Wei-
ter gibt diese Ausstellung den unwiderleglichen Beweis,
daß Trübner von Anfang (1869) an bis heute so selb-
ständig wie nur je ein originaler Künstler auf eigenen
Füßen gestanden hat, daß er unbekümmert um male-
rische Moden und Gepflogenheiten nur seine ihm an-
geborenen Bahnen ging und daß er sein phänomenales
Können durch eine strenge und unausgesetzte Arbeit
zu dem hohen Adel züchtete, den es erreicht hat, um
restlos Raum-, Farben-, Vortragsprobleme mit sach-
licher Treue und höchstem Geschmack zu lösen. Auch
Trübner -Kenner werden vor dieser Ausstellung ihr
Wissen um Trübners Kunst entscheidend zu revidieren
haben.
Es wäre unangebracht, die vielfachen Irrtümer und
Fehlschlüsse, die über Trübners Kunst verbreitet sind,
auf dem verfügbaren Raum hier zu berichtigen. Le-
diglich die aus der Ausstellung sich ergebenden Tat-
sachen sollen sprechen. Die Ölbilder sind in fünf
kleineren Räumen und dem großen Oberlichtsaal des
Kunstvereinsgebäudes, die Zeichnungen auf dem Vor-
raum untergebracht. Im Nachfolgenden halte ich mich
an den dokumentarischen Wert besitzenden Katalog,
der erstmalig authentische Datierungen aller ausge-
stellten Werke — auch der nicht datierten — gibt.
Zweierlei fällt bei einem Rundgang mit Eindring-
lichkeit auf: einmal die kolossale inhaltliche und tech-
nische Vereinfachung des künstlerischen Vorwurfs zu-
gunsten rein künstlerischer Behandlung und Abrundung.
Dann die ungeheure Logik und Konsequenz, mit der
die malerische und technische Entwicklung bis zu den
letzten künstlerischen Möglichkeiten fortschreitet. In
zäher Beharrlichkeit und in immer von neuen Seiten
die Probleme auffassender Arbeitsweise hat Trübner
um den prägnantesten künstlerischen Ausdruck gerun-
gen, bis die malerische und technische Lösung eine
vollendete Harmonie aufwiesen. Bei dieser Sachlich-
keit, die kein andres Ziel als das guter, bester Malerei
mit sicherer Technik (wozu Raumgestaltung, Bild-
wirkung, vollendetes Kolorit usw. gehören) kannte, hat
der Künstler eine Monumentalität der malerischen Er-
scheinung aus den delikaten Frühwerken entwickelt,
die in der Kunst des 19. Jahrhunderts ohnegleichen
dasteht.
Schon das erste Werk, der Geldwechsler, 1869,
(Nr. 1), den Trübner wie das »Kirchenbild« der Karls-
ruher Kunsthalle als 18 jähriger Akademie- und Canon-
schüler malte, zeigt die Anfänge der Meistereigenschaften.
Das ist kein Stammeln und Suchen, das ist schon
fertige Kunst in der Einfachheit und Noblesse des
Ausdrucks und der Charakterisierung. Dieses schon
vor der niederländischen Reise gemalte niederländische
Motiv ist typisch für die Auffassung Trübners von
seiner Kunst. Daran schließt sich dann der »Parade-
marsch« der köstlichen Porträts der siebziger Jahre, be-
ginnend mit dem Monumentalstück des Bürgermeisters
Hoffmeister, 1872 (Nr. 3) — kürzlich von der National-
galerie erworben — bis etwa zum »Knaben mit Dogge«,
1878 (Nri 9, 10, 12, 14, 37, 45, 49, 53, 65 u. a.),
die Trübnjer, wenn er sonst nichts geschaffen hätte,
in die erste Reihe der großen Porträtisten und Maler
des 19. Jahrhunderts — und auch anderer Zeiten —
stellen würden. Er arbeitet späterhin die Plastik, die
Raumwirkung, das Feuer der Farbe, die wuchtig ein-
fachen Farbenakkorde, neue Farbenkombinationen her-
aus und führt, seit er im Städelschen Studiengarten
zu Frankfurt die pleinairistischen Probleme des Frei-
lichtes studiert und zu ganz neuen, eigenartigen Farben-
anschauungen kommt, in den bekannten vier Fürsten-
Reiterbildnissen seine Porträtkunst zu einer Höhe, die
dem besten aller Zeit mindestens gleichwertig ist und