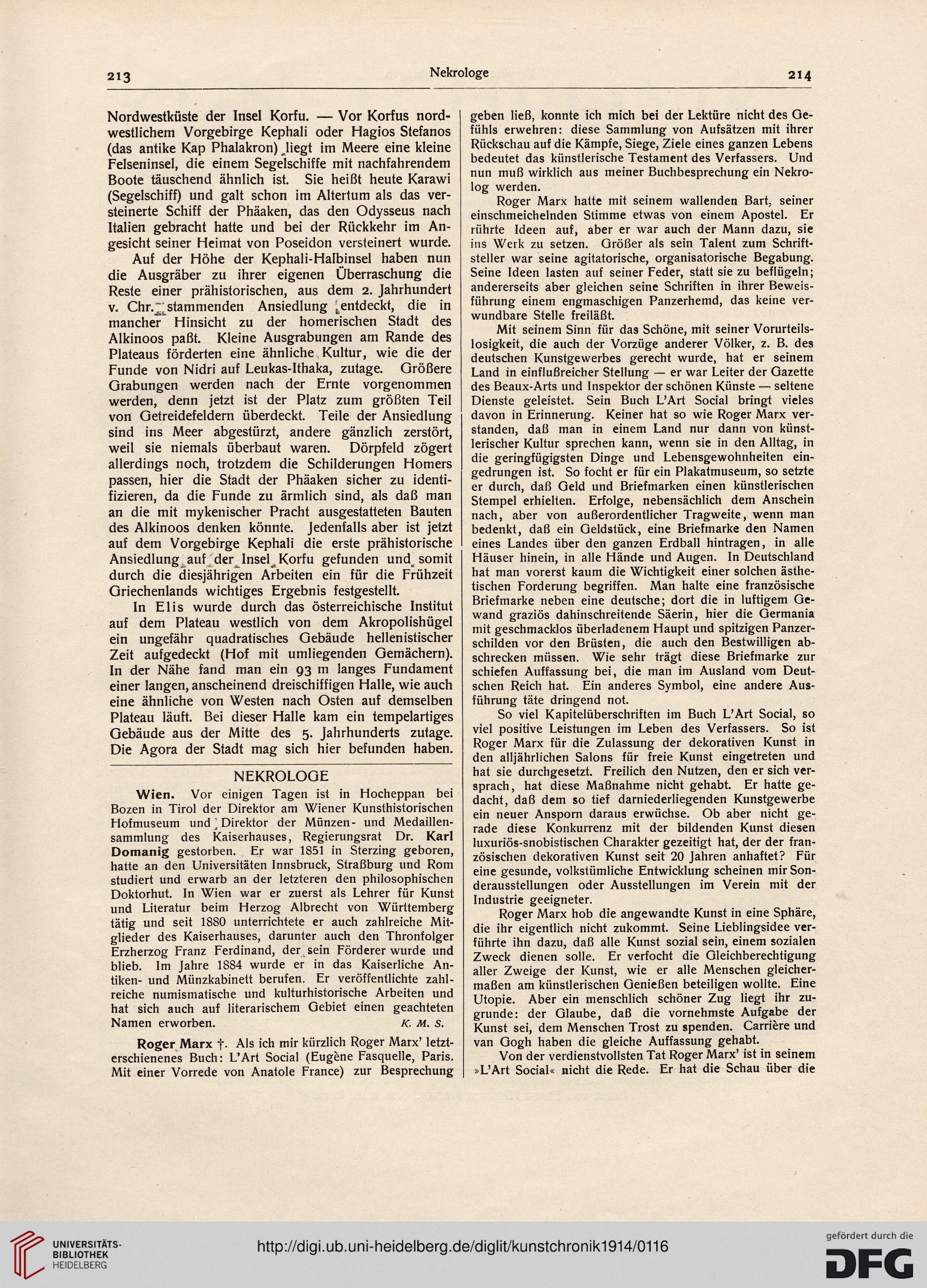213
Nekrologe
214
Nordwestküste der Insel Korfu. — Vor Korfus nord-
westlichem Vorgebirge Kephali oder Hagios Stefanos
(das antike Kap Phalakron) .liegt im Meere eine kleine
Felseninsel, die einem Segelschiffe mit nachfahrendem
Boote täuschend ähnlich ist. Sie heißt heute Karawi
(Segelschiff) und galt schon im Altertum als das ver-
steinerte Schiff der Phäaken, das den Odysseus nach
Italien gebracht hatte und bei der Rückkehr im An-
gesicht seiner Heimat von Poseidon versteinert wurde.
Auf der Höhe der Kephali-Halbinsel haben nun
die Ausgräber zu ihrer eigenen Überraschung die
Reste einer prähistorischen, aus dem 2. Jahrhundert
v. Chr.~t stammenden Ansiedlung ^entdeckt, die in
mancher Hinsicht zu der homerischen Stadt des
Alkinoos paßt. Kleine Ausgrabungen am Rande des
Plateaus förderten eine ähnliche Kultur, wie die der
Funde von Nidri auf Leukas-Ithaka, zutage. Größere
Grabungen werden nach der Ernte vorgenommen
werden, denn jetzt ist der Platz zum größten Teil
von Getreidefeldern überdeckt. Teile der Ansiedlung
sind ins Meer abgestürzt, andere gänzlich zerstört,
weil sie niemals überbaut waren. Dörpfeld zögert
allerdings noch, trotzdem die Schilderungen Homers
passen, hier die Stadt der Phäaken sicher zu identi-
fizieren, da die Funde zu ärmlich sind, als daß man
an die mit mykenischer Pracht ausgestatteten Bauten
des Alkinoos denken könnte. Jedenfalls aber ist jetzt
auf dem Vorgebirge Kephali die erste prähistorische
Ansiedlung. auf der Insel^ Korfu gefunden und, somit
durch die diesjährigen Arbeiten ein für die Frühzeit
Griechenlands wichtiges Ergebnis festgestellt.
In Elis wurde durch das österreichische Institut
auf dem Plateau westlich von dem Akropolishügel
ein ungefähr quadratisches Gebäude hellenistischer
Zeit aufgedeckt (Hof mit umliegenden Gemächern).
In der Nähe fand man ein 93 m langes Fundament
einer langen, anscheinend dreischiffigen Halle, wie auch
eine ähnliche von Westen nach Osten auf demselben
Plateau läuft. Bei dieser Halle kam ein tempelartiges
Gebäude aus der Mitte des 5. Jahrhunderts zutage.
Die Agora der Stadt mag sich hier befunden haben.
NEKROLOGE
Wien. Vor einigen Tagen ist in Hocheppan bei
Bozen in Tirol der Direktor am Wiener Kunsthistorischen
Hofmuseum und ^ Direktor der Münzen- und Medaillen-
sammlung des Kaiserhauses, Regierungsrat Dr. Karl
Domanig gestorben. Er war 1851 in Sterzing geboren,
hatte an den Universitäten Innsbruck, Straßburg und Rom
studiert und erwarb an der letzteren den philosophischen
Doktorhut. In Wien war er zuerst als Lehrer für Kunst
und Literatur beim Herzog Albrecht von Württemberg
tätig und seit 1880 unterrichtete er auch zahlreiche Mit-
glieder des Kaiserhauses, darunter auch den Thronfolger
Erzherzog Franz Ferdinand, der sein Förderer wurde und
blieb. Im Jahre 1884 wurde er in das Kaiserliche An-
tiken- und Münzkabinett berufen. Er veröffentlichte zahl-
reiche numismatische und kulturhistorische Arbeiten und
hat sich auch auf literarischem Gebiet einen geachteten
Namen erworben. AT. m. s.
Roger Marx f. Als ich mir kürzlich Roger Marx' letzt-
erschienenes Buch: L'Art Social (Eugene Fasquelle, Paris.
Mit einer Vorrede von Anatole France) zur Besprechung
geben ließ, konnte ich mich bei der Lektüre nicht des Ge-
fühls erwehren: diese Sammlung von Aufsätzen mit ihrer
Rückschau auf die Kämpfe, Siege, Ziele eines ganzen Lebens
bedeutet das künstlerische Testament des Verfassers. Und
nun muß wirklich aus meiner Buchbesprechung ein Nekro-
log werden.
Roger Marx hatte mit seinem wallenden Bart, seiner
einschmeichelnden Stimme etwas von einem Apostel. Er
rührte Ideen auf, aber er war auch der Mann dazu, sie
ins Werk zu setzen. Größer als sein Talent zum Schrift-
steller war seine agitatorische, organisatorische Begabung.
Seine Ideen lasten auf seiner Feder, statt sie zu beflügeln;
andererseits aber gleichen seine Schriften in ihrer Beweis-
führung einem engmaschigen Panzerhemd, das keine ver-
wundbare Stelle freiläßt.
Mit seinem Sinn für das Schöne, mit seiner Vorurteils-
losigkeit, die auch der Vorzüge anderer Völker, z. B. des
deutschen Kunstgewerbes gerecht wurde, hat er seinem
Land in einflußreicher Stellung — er war Leiter der Gazette
des Beaux-Arts und Inspektor der schönen Künste — seltene
Dienste geleistet. Sein Buch L'Art Social bringt vieles
davon in Erinnerung. Keiner hat so wie Roger Marx ver-
standen, daß man in einem Land nur dann von künst-
lerischer Kultur sprechen kann, wenn sie in den Alltag, in
die geringfügigsten Dinge und Lebensgewohnheiten ein-
gedrungen ist. So focht er für ein Plakatmuseum, so setzte
er durch, daß Geld und Briefmarken einen künstlerischen
Stempel erhielten. Erfolge, nebensächlich dem Anschein
nach, aber von außerordentlicher Tragweite, wenn man
bedenkt, daß ein Geldstück, eine Briefmarke den Namen
eines Landes über den ganzen Erdball hintragen, in alle
Häuser hinein, in alle Hände und Augen. In Deutschland
hat man vorerst kaum die Wichtigkeit einer solchen ästhe-
tischen Forderung begriffen. Man halte eine französische
Briefmarke neben eine deutsche; dort die in luftigem Ge-
wand graziös dahinschreitende Säerin, hier die Germania
mit geschmacklos überladenem Haupt und spitzigen Panzer-
schilden vor den Brüsten, die auch den Best willigen ab-
schrecken müssen. Wie sehr trägt diese Briefmarke zur
schiefen Auffassung bei, die man im Ausland vom Deut-
schen Reich hat. Ein anderes Symbol, eine andere Aus-
führung täte dringend not.
So viel Kapitelüberschriften im Buch L'Art Social, so
viel positive Leistungen im Leben des Verfassers. So ist
Roger Marx für die Zulassung der dekorativen Kunst in
den alljährlichen Salons für freie Kunst eingetreten und
hat sie durchgesetzt. Freilich den Nutzen, den er sich ver-
sprach, hat diese Maßnahme nicht gehabt. Er hatte ge-
dacht, daß dem so tief darniederliegenden Kunstgewerbe
ein neuer Ansporn daraus erwüchse. Ob aber nicht ge-
rade diese Konkurrenz mit der bildenden Kunst diesen
luxuriös-snobistischen Charakter gezeitigt hat, der der fran-
zösischen dekorativen Kunst seit 20 Jahren anhaftet? Für
eine gesunde, volkstümliche Entwicklung scheinen mir Son-
derausstellungen oder Ausstellungen im Verein mit der
Industrie geeigneter.
Roger Marx hob die angewandte Kunst in eine Sphäre,
die ihr eigentlich nicht zukommt. Seine Lieblingsidee ver-
führte ihn dazu, daß alle Kunst sozial sein, einem sozialen
Zweck dienen solle. Er verfocht die Gleichberechtigung
aller Zweige der Kunst, wie er alle Menschen gleicher-
maßen am künstlerischen Genießen beteiligen wollte. Eine
Utopie. Aber ein menschlich schöner Zug liegt ihr zu-
grunde: der Glaube, daß die vornehmste Aufgabe der
Kunst sei, dem Menschen Trost zu spenden. Carriere und
van Gogh haben die gleiche Auffassung gehabt.
Von der verdienstvollsten Tat Roger Marx' ist in seinem
»L'Art Social« nicht die Rede. Er hat die Schau über die
Nekrologe
214
Nordwestküste der Insel Korfu. — Vor Korfus nord-
westlichem Vorgebirge Kephali oder Hagios Stefanos
(das antike Kap Phalakron) .liegt im Meere eine kleine
Felseninsel, die einem Segelschiffe mit nachfahrendem
Boote täuschend ähnlich ist. Sie heißt heute Karawi
(Segelschiff) und galt schon im Altertum als das ver-
steinerte Schiff der Phäaken, das den Odysseus nach
Italien gebracht hatte und bei der Rückkehr im An-
gesicht seiner Heimat von Poseidon versteinert wurde.
Auf der Höhe der Kephali-Halbinsel haben nun
die Ausgräber zu ihrer eigenen Überraschung die
Reste einer prähistorischen, aus dem 2. Jahrhundert
v. Chr.~t stammenden Ansiedlung ^entdeckt, die in
mancher Hinsicht zu der homerischen Stadt des
Alkinoos paßt. Kleine Ausgrabungen am Rande des
Plateaus förderten eine ähnliche Kultur, wie die der
Funde von Nidri auf Leukas-Ithaka, zutage. Größere
Grabungen werden nach der Ernte vorgenommen
werden, denn jetzt ist der Platz zum größten Teil
von Getreidefeldern überdeckt. Teile der Ansiedlung
sind ins Meer abgestürzt, andere gänzlich zerstört,
weil sie niemals überbaut waren. Dörpfeld zögert
allerdings noch, trotzdem die Schilderungen Homers
passen, hier die Stadt der Phäaken sicher zu identi-
fizieren, da die Funde zu ärmlich sind, als daß man
an die mit mykenischer Pracht ausgestatteten Bauten
des Alkinoos denken könnte. Jedenfalls aber ist jetzt
auf dem Vorgebirge Kephali die erste prähistorische
Ansiedlung. auf der Insel^ Korfu gefunden und, somit
durch die diesjährigen Arbeiten ein für die Frühzeit
Griechenlands wichtiges Ergebnis festgestellt.
In Elis wurde durch das österreichische Institut
auf dem Plateau westlich von dem Akropolishügel
ein ungefähr quadratisches Gebäude hellenistischer
Zeit aufgedeckt (Hof mit umliegenden Gemächern).
In der Nähe fand man ein 93 m langes Fundament
einer langen, anscheinend dreischiffigen Halle, wie auch
eine ähnliche von Westen nach Osten auf demselben
Plateau läuft. Bei dieser Halle kam ein tempelartiges
Gebäude aus der Mitte des 5. Jahrhunderts zutage.
Die Agora der Stadt mag sich hier befunden haben.
NEKROLOGE
Wien. Vor einigen Tagen ist in Hocheppan bei
Bozen in Tirol der Direktor am Wiener Kunsthistorischen
Hofmuseum und ^ Direktor der Münzen- und Medaillen-
sammlung des Kaiserhauses, Regierungsrat Dr. Karl
Domanig gestorben. Er war 1851 in Sterzing geboren,
hatte an den Universitäten Innsbruck, Straßburg und Rom
studiert und erwarb an der letzteren den philosophischen
Doktorhut. In Wien war er zuerst als Lehrer für Kunst
und Literatur beim Herzog Albrecht von Württemberg
tätig und seit 1880 unterrichtete er auch zahlreiche Mit-
glieder des Kaiserhauses, darunter auch den Thronfolger
Erzherzog Franz Ferdinand, der sein Förderer wurde und
blieb. Im Jahre 1884 wurde er in das Kaiserliche An-
tiken- und Münzkabinett berufen. Er veröffentlichte zahl-
reiche numismatische und kulturhistorische Arbeiten und
hat sich auch auf literarischem Gebiet einen geachteten
Namen erworben. AT. m. s.
Roger Marx f. Als ich mir kürzlich Roger Marx' letzt-
erschienenes Buch: L'Art Social (Eugene Fasquelle, Paris.
Mit einer Vorrede von Anatole France) zur Besprechung
geben ließ, konnte ich mich bei der Lektüre nicht des Ge-
fühls erwehren: diese Sammlung von Aufsätzen mit ihrer
Rückschau auf die Kämpfe, Siege, Ziele eines ganzen Lebens
bedeutet das künstlerische Testament des Verfassers. Und
nun muß wirklich aus meiner Buchbesprechung ein Nekro-
log werden.
Roger Marx hatte mit seinem wallenden Bart, seiner
einschmeichelnden Stimme etwas von einem Apostel. Er
rührte Ideen auf, aber er war auch der Mann dazu, sie
ins Werk zu setzen. Größer als sein Talent zum Schrift-
steller war seine agitatorische, organisatorische Begabung.
Seine Ideen lasten auf seiner Feder, statt sie zu beflügeln;
andererseits aber gleichen seine Schriften in ihrer Beweis-
führung einem engmaschigen Panzerhemd, das keine ver-
wundbare Stelle freiläßt.
Mit seinem Sinn für das Schöne, mit seiner Vorurteils-
losigkeit, die auch der Vorzüge anderer Völker, z. B. des
deutschen Kunstgewerbes gerecht wurde, hat er seinem
Land in einflußreicher Stellung — er war Leiter der Gazette
des Beaux-Arts und Inspektor der schönen Künste — seltene
Dienste geleistet. Sein Buch L'Art Social bringt vieles
davon in Erinnerung. Keiner hat so wie Roger Marx ver-
standen, daß man in einem Land nur dann von künst-
lerischer Kultur sprechen kann, wenn sie in den Alltag, in
die geringfügigsten Dinge und Lebensgewohnheiten ein-
gedrungen ist. So focht er für ein Plakatmuseum, so setzte
er durch, daß Geld und Briefmarken einen künstlerischen
Stempel erhielten. Erfolge, nebensächlich dem Anschein
nach, aber von außerordentlicher Tragweite, wenn man
bedenkt, daß ein Geldstück, eine Briefmarke den Namen
eines Landes über den ganzen Erdball hintragen, in alle
Häuser hinein, in alle Hände und Augen. In Deutschland
hat man vorerst kaum die Wichtigkeit einer solchen ästhe-
tischen Forderung begriffen. Man halte eine französische
Briefmarke neben eine deutsche; dort die in luftigem Ge-
wand graziös dahinschreitende Säerin, hier die Germania
mit geschmacklos überladenem Haupt und spitzigen Panzer-
schilden vor den Brüsten, die auch den Best willigen ab-
schrecken müssen. Wie sehr trägt diese Briefmarke zur
schiefen Auffassung bei, die man im Ausland vom Deut-
schen Reich hat. Ein anderes Symbol, eine andere Aus-
führung täte dringend not.
So viel Kapitelüberschriften im Buch L'Art Social, so
viel positive Leistungen im Leben des Verfassers. So ist
Roger Marx für die Zulassung der dekorativen Kunst in
den alljährlichen Salons für freie Kunst eingetreten und
hat sie durchgesetzt. Freilich den Nutzen, den er sich ver-
sprach, hat diese Maßnahme nicht gehabt. Er hatte ge-
dacht, daß dem so tief darniederliegenden Kunstgewerbe
ein neuer Ansporn daraus erwüchse. Ob aber nicht ge-
rade diese Konkurrenz mit der bildenden Kunst diesen
luxuriös-snobistischen Charakter gezeitigt hat, der der fran-
zösischen dekorativen Kunst seit 20 Jahren anhaftet? Für
eine gesunde, volkstümliche Entwicklung scheinen mir Son-
derausstellungen oder Ausstellungen im Verein mit der
Industrie geeigneter.
Roger Marx hob die angewandte Kunst in eine Sphäre,
die ihr eigentlich nicht zukommt. Seine Lieblingsidee ver-
führte ihn dazu, daß alle Kunst sozial sein, einem sozialen
Zweck dienen solle. Er verfocht die Gleichberechtigung
aller Zweige der Kunst, wie er alle Menschen gleicher-
maßen am künstlerischen Genießen beteiligen wollte. Eine
Utopie. Aber ein menschlich schöner Zug liegt ihr zu-
grunde: der Glaube, daß die vornehmste Aufgabe der
Kunst sei, dem Menschen Trost zu spenden. Carriere und
van Gogh haben die gleiche Auffassung gehabt.
Von der verdienstvollsten Tat Roger Marx' ist in seinem
»L'Art Social« nicht die Rede. Er hat die Schau über die