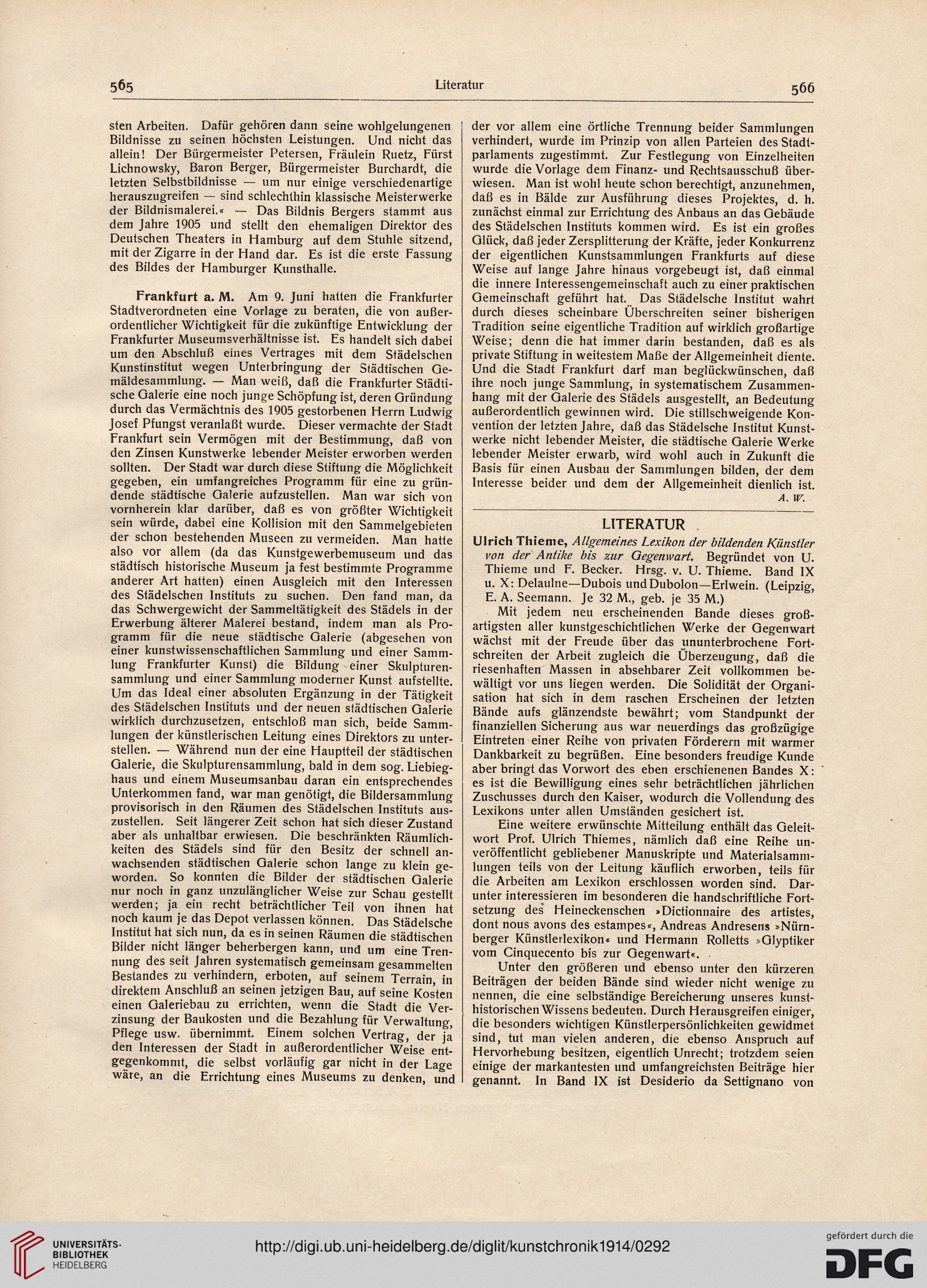565
Literatur
566
sten Arbeiten. Dafür gehören dann seine wohlgelungenen
Bildnisse zu seinen höchsten Leistungen. Und nicht das
allein! Der Bürgermeister Petersen, Fräulein Ruetz, Fürst
Lichnowsky, Baron Berger, Bürgermeister Burchardt, die
letzten Selbstbildnisse — um nur einige verschiedenartige
herauszugreifen — sind schlechthin klassische Meisterwerke
der Bildnismalerei.« — Das Bildnis Bergers stammt aus
dem Jahre 1905 und stellt den ehemaligen Direktor des
Deutschen Theaters in Hamburg auf dem Stuhle sitzend,
mit der Zigarre in der Hand dar. Es ist die erste Fassung
des Bildes der Hamburger Kunslhalle.
Frankfurt a. M. Am 9. Juni hatten die Frankfurter
Stadtverordneten eine Vorlage zu beraten, die von außer-
ordentlicher Wichtigkeit für die zukünftige Entwicklung der
Frankfurter Museumsverhältnisse ist. Es handelt sich dabei
um den Abschluß eines Vertrages mit dem Städelschen
Kunstinstitut wegen Unterbringung der Städtischen Ge-
mäldesammlung. — Man weiß, daß die Frankfurter Städti-
sche Galerie eine noch junge Schöpfung ist, deren Gründung
durch das Vermächtnis des 1905 gestorbenen Herrn Ludwig
Josef Pfungst veranlaßt wurde. Dieser vermachte der Stadt
Frankfurt sein Vermögen mit der Bestimmung, daß von
den Zinsen Kunstwerke lebender Meister erworben werden
sollten. Der Stadt war durch diese Stiftung die Möglichkeit
gegeben, ein umfangreiches Programm für eine zu grün-
dende städtische Galerie aufzustellen. Man war sich von
vornherein klar darüber, daß es von größter Wichtigkeit
sein würde, dabei eine Kollision mit den Sammelgebieten
der schon bestehenden Museen zu vermeiden. Man hatte
also vor allem (da das Kunstgewerbemuseum und das
städtisch historische Museum ja fest bestimmte Programme
anderer Art hatten) einen Ausgleich mit den Interessen
des Städelschen Instituts zu suchen. Den fand man, da
das Schwergewicht der Sammeltätigkeit des Städels in der
Erwerbung älterer Malerei bestand, indem man als Pro-
gramm für die neue städtische Galerie (abgesehen von
einer kunstwissenschaftlichen Sammlung und einer Samm-
lung Frankfurter Kunst) die Bildung einer Skulpturen-
sammlung und einer Sammlung moderner Kunst aufstellte.
Um das Ideal einer absoluten Ergänzung in der Tätigkeit
des Städelschen Instituts und der neuen städtischen Galerie
wirklich durchzusetzen, entschloß man sich, beide Samm-
lungen der künstlerischen Leitung eines Direktors zu unter-
stellen. — Während nun der eine Hauptteil der städtischen
Galerie, die Skulpturensammlung, bald in dem sog. Liebieg-
haus und einem Museumsanbau daran ein entsprechendes
Unterkommen fand, war man genötigt, die Bildersammlung
provisorisch in den Räumen des Städelschen Instituts aus-
zustellen. Seit längerer Zeit schon hat sich dieser Zustand
aber als unhaltbar erwiesen. Die beschränkten Räumlich-
keiten des Städels sind für den Besitz der schnell an-
wachsenden städtischen Galerie schon lange zu klein ge-
worden. So konnten die Bilder der städtischen Galerie
nur noch in ganz unzulänglicher Weise zur Schau gestellt
werden; ja ein recht beträchtlicher Teil von ihnen hat
noch kaum je das Depot verlassen können. Das Städelsche
Institut hat sich nun, da es in seinen Räumen die städtischen
Bilder nicht länger beherbergen kann, und um eine Tren-
nung des seit Jahren systematisch gemeinsam gesammelten
Bestandes zu verhindern, erboten, auf seinem Terrain, in
direktem Anschluß an seinen jetzigen Bau, auf seine Kosten
einen Galeriebau zu errichten, wenn die Stadt die Ver-
zinsung der Baukosten und die Bezahlung für Verwaltung,
Pflege usw. übernimmt. Einem solchen Vertrag, der ja
den Interessen der Stadt in außerordentlicher Weise ent-
gegenkommt, die selbst vorläufig gar nicht in der Lage
wäre, an die Errichtung eines Museums zu denken, und
der vor allem eine örtliche Trennung beider Sammlungen
verhindert, wurde im Prinzip von allen Parteien des Stadl-
parlaments zugestimmt. Zur Festlegung von Einzelheiten
wurde die Vorlage dem Finanz- und Rechtsausschuß über-
wiesen. Man ist wohl heute schon berechtigt, anzunehmen,
daß es in Bälde zur Ausführung dieses Projektes, d. h.
zunächst einmal zur Errichtung des Anbaus an das Gebäude
des Städelschen Instituts kommen wird. Es ist ein großes
Glück, daß jeder Zersplitterung der Kräfte, jeder Konkurrenz
der eigentlichen Kunstsammlungen Frankfurts auf diese
Weise auf lange Jahre hinaus vorgebeugt ist, daß einmal
die innere Interessengemeinschaft auch zu einer praktischen
Gemeinschaft geführt hat. Das Städelsche Institut wahrt
durch dieses scheinbare Überschreiten seiner bisherigen
Tradition seine eigentliche Tradition auf wirklich großartige
Weise; denn die hat immer darin bestanden, daß es als
private Stiftung in weitestem Maße der Allgemeinheit diente.
Und die Stadt Frankfurt darf man beglückwünschen, daß
ihre noch junge Sammlung, in systematischem Zusammen-
hang mit der Galerie des Städels ausgestellt, an Bedeutung
außerordentlich gewinnen wird. Die stillschweigende Kon-
vention der letzten Jahre, daß das Städelsche Institut Kunst-
werke nicht lebender Meister, die städtische Galerie Werke
lebender Meister erwarb, wird wohl auch in Zukunft die
Basis für einen Ausbau der Sammlungen bilden, der dem
Interesse beider und dem der Allgemeinheit dienlich ist.
A. w.
LITERATUR
Ulrich Thienie, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von U.
Thieme und F. Becker. Hrsg. v. U. Thieme. Band IX
u. X: Delaulne—Dubois und Dubolon—Erlwein. (Leipzig,
E. A. Seemann. Je 32 M., geb. je 35 M.)
Mit jedem neu erscheinenden Bande dieses groß-
artigsten aller kunstgeschichtlichen Werke der Gegenwart
wächst mit der Freude über das ununterbrochene Fort-
schreiten der Arbeit zugleich die Überzeugung, daß die
riesenhaften Massen in absehbarer Zeit vollkommen be-
wältigt vor uns liegen werden. Die Solidität der Organi-
sation hat sich in dem raschen Erscheinen der letzten
Bände aufs glänzendste bewährt; vom Standpunkt der
finanziellen Sicherung aus war neuerdings das großzügige
Eintreten einer Reihe von privaten Förderern mit warmer
Dankbarkeit zu begrüßen. Eine besonders freudige Kunde
aber bringt das Vorwort des eben erschienenen Bandes X:
es ist die Bewilligung eines sehr beträchtlichen jährlichen
Zuschusses durch den Kaiser, wodurch die Vollendung des
Lexikons unter allen Umständen gesichert ist.
Eine weitere erwünschte Mitteilung enthält das Geleit-
wort Prof. Ulrich Thiemes, nämlich daß eine Reihe un-
veröffentlicht gebliebener Manuskripte und Materialsamm-
lungen teils von der Leitung käuflich erworben, teils für
die Arbeiten am Lexikon erschlossen worden sind. Dar-
unter interessieren im besonderen die handschriftliche Fort-
setzung des" Heineckenschen »Dictionnaire des artistes,
dont nous avons des estampes«, Andreas Andresens »Nürn-
berger Künstlerlexikon« und Hermann Rolletts »Glyptiker
vom Cinquecento bis zur Gegenwart«.
Unter den größeren und ebenso unter den kürzeren
Beiträgen der beiden Bände sind wieder nicht wenige zu
nennen, die eine selbständige Bereicherung unseres kunst-
historischen Wissens bedeuten. Durch Herausgreifen einiger,
die besonders wichtigen Künstlerpersönlichkeiten gewidmet
sind, tut man vielen anderen, die ebenso Anspruch auf
Hervorhebung besitzen, eigentlich Unrecht; trotzdem seien
einige der markantesten und umfangreichsten Beiträge hier
genannt. In Band IX ist Desiderio da Settignano von
Literatur
566
sten Arbeiten. Dafür gehören dann seine wohlgelungenen
Bildnisse zu seinen höchsten Leistungen. Und nicht das
allein! Der Bürgermeister Petersen, Fräulein Ruetz, Fürst
Lichnowsky, Baron Berger, Bürgermeister Burchardt, die
letzten Selbstbildnisse — um nur einige verschiedenartige
herauszugreifen — sind schlechthin klassische Meisterwerke
der Bildnismalerei.« — Das Bildnis Bergers stammt aus
dem Jahre 1905 und stellt den ehemaligen Direktor des
Deutschen Theaters in Hamburg auf dem Stuhle sitzend,
mit der Zigarre in der Hand dar. Es ist die erste Fassung
des Bildes der Hamburger Kunslhalle.
Frankfurt a. M. Am 9. Juni hatten die Frankfurter
Stadtverordneten eine Vorlage zu beraten, die von außer-
ordentlicher Wichtigkeit für die zukünftige Entwicklung der
Frankfurter Museumsverhältnisse ist. Es handelt sich dabei
um den Abschluß eines Vertrages mit dem Städelschen
Kunstinstitut wegen Unterbringung der Städtischen Ge-
mäldesammlung. — Man weiß, daß die Frankfurter Städti-
sche Galerie eine noch junge Schöpfung ist, deren Gründung
durch das Vermächtnis des 1905 gestorbenen Herrn Ludwig
Josef Pfungst veranlaßt wurde. Dieser vermachte der Stadt
Frankfurt sein Vermögen mit der Bestimmung, daß von
den Zinsen Kunstwerke lebender Meister erworben werden
sollten. Der Stadt war durch diese Stiftung die Möglichkeit
gegeben, ein umfangreiches Programm für eine zu grün-
dende städtische Galerie aufzustellen. Man war sich von
vornherein klar darüber, daß es von größter Wichtigkeit
sein würde, dabei eine Kollision mit den Sammelgebieten
der schon bestehenden Museen zu vermeiden. Man hatte
also vor allem (da das Kunstgewerbemuseum und das
städtisch historische Museum ja fest bestimmte Programme
anderer Art hatten) einen Ausgleich mit den Interessen
des Städelschen Instituts zu suchen. Den fand man, da
das Schwergewicht der Sammeltätigkeit des Städels in der
Erwerbung älterer Malerei bestand, indem man als Pro-
gramm für die neue städtische Galerie (abgesehen von
einer kunstwissenschaftlichen Sammlung und einer Samm-
lung Frankfurter Kunst) die Bildung einer Skulpturen-
sammlung und einer Sammlung moderner Kunst aufstellte.
Um das Ideal einer absoluten Ergänzung in der Tätigkeit
des Städelschen Instituts und der neuen städtischen Galerie
wirklich durchzusetzen, entschloß man sich, beide Samm-
lungen der künstlerischen Leitung eines Direktors zu unter-
stellen. — Während nun der eine Hauptteil der städtischen
Galerie, die Skulpturensammlung, bald in dem sog. Liebieg-
haus und einem Museumsanbau daran ein entsprechendes
Unterkommen fand, war man genötigt, die Bildersammlung
provisorisch in den Räumen des Städelschen Instituts aus-
zustellen. Seit längerer Zeit schon hat sich dieser Zustand
aber als unhaltbar erwiesen. Die beschränkten Räumlich-
keiten des Städels sind für den Besitz der schnell an-
wachsenden städtischen Galerie schon lange zu klein ge-
worden. So konnten die Bilder der städtischen Galerie
nur noch in ganz unzulänglicher Weise zur Schau gestellt
werden; ja ein recht beträchtlicher Teil von ihnen hat
noch kaum je das Depot verlassen können. Das Städelsche
Institut hat sich nun, da es in seinen Räumen die städtischen
Bilder nicht länger beherbergen kann, und um eine Tren-
nung des seit Jahren systematisch gemeinsam gesammelten
Bestandes zu verhindern, erboten, auf seinem Terrain, in
direktem Anschluß an seinen jetzigen Bau, auf seine Kosten
einen Galeriebau zu errichten, wenn die Stadt die Ver-
zinsung der Baukosten und die Bezahlung für Verwaltung,
Pflege usw. übernimmt. Einem solchen Vertrag, der ja
den Interessen der Stadt in außerordentlicher Weise ent-
gegenkommt, die selbst vorläufig gar nicht in der Lage
wäre, an die Errichtung eines Museums zu denken, und
der vor allem eine örtliche Trennung beider Sammlungen
verhindert, wurde im Prinzip von allen Parteien des Stadl-
parlaments zugestimmt. Zur Festlegung von Einzelheiten
wurde die Vorlage dem Finanz- und Rechtsausschuß über-
wiesen. Man ist wohl heute schon berechtigt, anzunehmen,
daß es in Bälde zur Ausführung dieses Projektes, d. h.
zunächst einmal zur Errichtung des Anbaus an das Gebäude
des Städelschen Instituts kommen wird. Es ist ein großes
Glück, daß jeder Zersplitterung der Kräfte, jeder Konkurrenz
der eigentlichen Kunstsammlungen Frankfurts auf diese
Weise auf lange Jahre hinaus vorgebeugt ist, daß einmal
die innere Interessengemeinschaft auch zu einer praktischen
Gemeinschaft geführt hat. Das Städelsche Institut wahrt
durch dieses scheinbare Überschreiten seiner bisherigen
Tradition seine eigentliche Tradition auf wirklich großartige
Weise; denn die hat immer darin bestanden, daß es als
private Stiftung in weitestem Maße der Allgemeinheit diente.
Und die Stadt Frankfurt darf man beglückwünschen, daß
ihre noch junge Sammlung, in systematischem Zusammen-
hang mit der Galerie des Städels ausgestellt, an Bedeutung
außerordentlich gewinnen wird. Die stillschweigende Kon-
vention der letzten Jahre, daß das Städelsche Institut Kunst-
werke nicht lebender Meister, die städtische Galerie Werke
lebender Meister erwarb, wird wohl auch in Zukunft die
Basis für einen Ausbau der Sammlungen bilden, der dem
Interesse beider und dem der Allgemeinheit dienlich ist.
A. w.
LITERATUR
Ulrich Thienie, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von U.
Thieme und F. Becker. Hrsg. v. U. Thieme. Band IX
u. X: Delaulne—Dubois und Dubolon—Erlwein. (Leipzig,
E. A. Seemann. Je 32 M., geb. je 35 M.)
Mit jedem neu erscheinenden Bande dieses groß-
artigsten aller kunstgeschichtlichen Werke der Gegenwart
wächst mit der Freude über das ununterbrochene Fort-
schreiten der Arbeit zugleich die Überzeugung, daß die
riesenhaften Massen in absehbarer Zeit vollkommen be-
wältigt vor uns liegen werden. Die Solidität der Organi-
sation hat sich in dem raschen Erscheinen der letzten
Bände aufs glänzendste bewährt; vom Standpunkt der
finanziellen Sicherung aus war neuerdings das großzügige
Eintreten einer Reihe von privaten Förderern mit warmer
Dankbarkeit zu begrüßen. Eine besonders freudige Kunde
aber bringt das Vorwort des eben erschienenen Bandes X:
es ist die Bewilligung eines sehr beträchtlichen jährlichen
Zuschusses durch den Kaiser, wodurch die Vollendung des
Lexikons unter allen Umständen gesichert ist.
Eine weitere erwünschte Mitteilung enthält das Geleit-
wort Prof. Ulrich Thiemes, nämlich daß eine Reihe un-
veröffentlicht gebliebener Manuskripte und Materialsamm-
lungen teils von der Leitung käuflich erworben, teils für
die Arbeiten am Lexikon erschlossen worden sind. Dar-
unter interessieren im besonderen die handschriftliche Fort-
setzung des" Heineckenschen »Dictionnaire des artistes,
dont nous avons des estampes«, Andreas Andresens »Nürn-
berger Künstlerlexikon« und Hermann Rolletts »Glyptiker
vom Cinquecento bis zur Gegenwart«.
Unter den größeren und ebenso unter den kürzeren
Beiträgen der beiden Bände sind wieder nicht wenige zu
nennen, die eine selbständige Bereicherung unseres kunst-
historischen Wissens bedeuten. Durch Herausgreifen einiger,
die besonders wichtigen Künstlerpersönlichkeiten gewidmet
sind, tut man vielen anderen, die ebenso Anspruch auf
Hervorhebung besitzen, eigentlich Unrecht; trotzdem seien
einige der markantesten und umfangreichsten Beiträge hier
genannt. In Band IX ist Desiderio da Settignano von