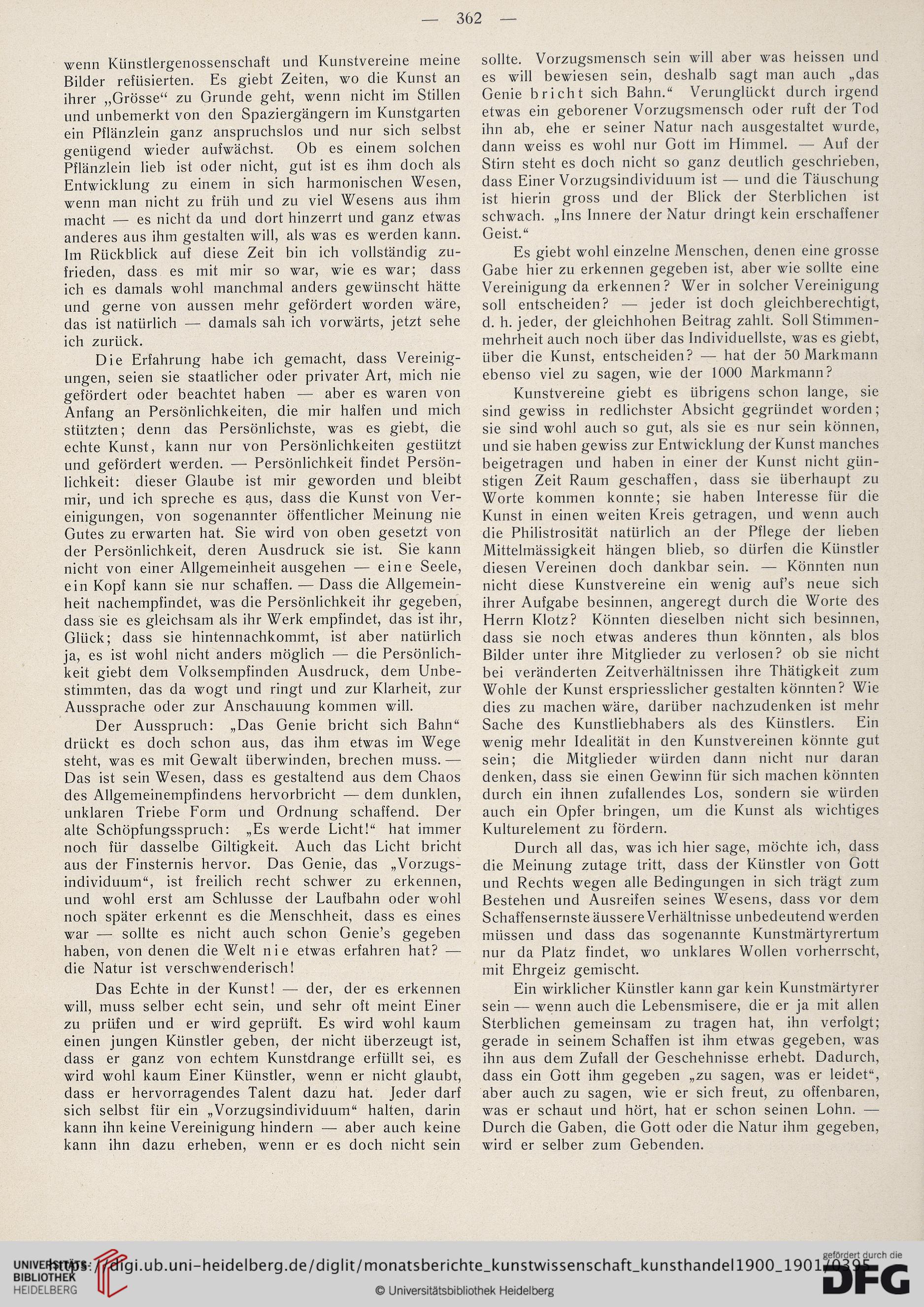362
wenn Künstlergenossenschaft und Kunstvereine meine
Bilder refüsierten. Es giebt Zeiten, wo die Kunst an
ihrer „Grösse“ zu Grunde geht, wenn nicht im Stillen
und unbemerkt von den Spaziergängern im Kunstgarten
ein Pflänzlein ganz anspruchslos und nur sich selbst
genügend wieder aufwächst. Ob es einem solchen
Pflänzlein lieb ist oder nicht, gut ist es ihm doch als
Entwicklung zu einem in sich harmonischen Wesen,
wenn man nicht zu früh und zu viel Wesens aus ihm
macht — es nicht da und dort hinzerrt und ganz etwas
anderes aus ihm gestalten will, als was es werden kann.
Im Rückblick auf diese Zeit bin ich vollständig zu-
frieden, dass es mit mir so war, wie es war; dass
ich es damals wohl manchmal anders gewünscht hätte
und gerne von aussen mehr gefördert worden wäre,
das ist natürlich — damals sah ich vorwärts, jetzt sehe
ich zurück.
Die Erfahrung habe ich gemacht, dass Vereinig-
ungen, seien sie staatlicher oder privater Art, mich nie
gefördert oder beachtet haben — aber es waren von
Anfang an Persönlichkeiten, die mir halfen und mich
stützten; denn das Persönlichste, was es giebt, die
echte Kunst, kann nur von Persönlichkeiten gestützt
und gefördert werden. — Persönlichkeit findet Persön-
lichkeit: dieser Glaube ist mir geworden und bleibt
mir, und ich spreche es aus, dass die Kunst von Ver-
einigungen, von sogenannter öffentlicher Meinung nie
Gutes zu erwarten hat. Sie wird von oben gesetzt von
der Persönlichkeit, deren Ausdruck sie ist. Sie kann
nicht von einer Allgemeinheit ausgehen — eine Seele,
ein Kopf kann sie nur schaffen. — Dass die Allgemein-
heit nachempfindet, was die Persönlichkeit ihr gegeben,
dass sie es gleichsam als ihr Werk empfindet, das ist ihr,
Glück; dass sie hintennachkommt, ist aber natürlich
ja, es ist wohl nicht anders möglich — die Persönlich-
keit giebt dem Volksempfinden Ausdruck, dem Unbe-
stimmten, das da wogt und ringt und zur Klarheit, zur
Aussprache oder zur Anschauung kommen will.
Der Ausspruch: „Das Genie bricht sich Bahn“
drückt es doch schon aus, das ihm etwas im Wege
steht, was es mit Gewalt überwinden, brechen muss. —
Das ist sein Wesen, dass es gestaltend aus dem Chaos
des Allgemeinempfindens hervorbricht — dem dunklen,
unklaren Triebe Form und Ordnung schaffend. Der
alte Schöpfungsspruch: „Es werde Licht!“ hat immer
noch für dasselbe Giltigkeit. Auch das Licht bricht
aus der Finsternis hervor. Das Genie, das „Vorzugs-
individuum“, ist freilich recht schwer zu erkennen,
und wohl erst am Schlüsse der Laufbahn oder wohl
noch später erkennt es die Menschheit, dass es eines
war — sollte es nicht auch schon Genie’s gegeben
haben, von denen die Welt nie etwas erfahren hat? —
die Natur ist verschwenderisch!
Das Echte in der Kunst! — der, der es erkennen
will, muss selber echt sein, und sehr oft meint Einer
zu prüfen und er wird geprüft. Es wird wohl kaum
einen jungen Künstler geben, der nicht überzeugt ist,
dass er ganz von echtem Kunstdrange erfüllt sei, es
wird wohl kaum Einer Künstler, wenn er nicht glaubt,
dass er hervorragendes Talent dazu hat. Jeder darf
sich selbst für ein „Vorzugsindividuum“ halten, darin
kann ihn keine Vereinigung hindern — aber auch keine
kann ihn dazu erheben, wenn er es doch nicht sein
sollte. Vorzugsmensch sein will aber was heissen und
es will bewiesen sein, deshalb sagt man auch „das
Genie bricht sich Bahn.“ Verunglückt durch irgend
etwas ein geborener Vorzugsmensch oder ruft der Tod
ihn ab, ehe er seiner Natur nach ausgestaltet wurde,
dann weiss es wohl nur Gott im Himmel. — Auf der
Stirn steht es doch nicht so ganz deutlich geschrieben,
dass EinerVorzugsindividuum ist — und die Täuschung
ist hierin gross und der Blick der Sterblichen ist
schwach. „Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener
Geist.“
Es giebt wohl einzelne Menschen, denen eine grosse
Gabe hier zu erkennen gegeben ist, aber wie sollte eine
Vereinigung da erkennen? Wer in solcher Vereinigung
soll entscheiden? — jeder ist doch gleichberechtigt,
d. h. jeder, der gleichhohen Beitrag zahlt. Soll Stimmen-
mehrheit auch noch über das Individuellste, was es giebt,
über die Kunst, entscheiden? — hat der 50 Markmann
ebenso viel zu sagen, wie der 1000 Markmann?
Kunstvereine giebt es übrigens schon lange, sie
sind gewiss in redlichster Absicht gegründet worden;
sie sind wohl auch so gut, als sie es nur sein können,
und sie haben gewiss zur Entwicklung der Kunst manches
beigetragen und haben in einer der Kunst nicht gün-
stigen Zeit Raum geschaffen, dass sie überhaupt zu
Worte kommen konnte; sie haben Interesse für die
Kunst in einen weiten Kreis getragen, und wenn auch
die Philistrosität natürlich an der Pflege der lieben
Mittelmässigkeit hängen blieb, so dürfen die Künstler
diesen Vereinen doch dankbar sein. — Könnten nun
nicht diese Kunstvereine ein wenig auf’s neue sich
ihrer Aufgabe besinnen, angeregt durch die Worte des
Herrn Klotz? Könnten dieselben nicht sich besinnen,
dass sie noch etwas anderes thun könnten, als blos
Bilder unter ihre Mitglieder zu verlosen? ob sie nicht
bei veränderten Zeitverhältnissen ihre Thätigkeit zum
Wohle der Kunst erspriesslicher gestalten könnten? Wie
dies zu machen wäre, darüber nachzudenken ist mehr
Sache des Kunstliebhabers als des Künstlers. Ein
wenig mehr Idealität in den Kunstvereinen könnte gut
sein; die Mitglieder würden dann nicht nur daran
denken, dass sie einen Gewinn für sich machen könnten
durch ein ihnen zufallendes Los, sondern sie würden
auch ein Opfer bringen, um die Kunst als wichtiges
Kulturelement zu fördern.
Durch all das, was ich hier sage, möchte ich, dass
die Meinung zutage tritt, dass der Künstler von Gott
und Rechts wegen alle Bedingungen in sich trägt zum
Bestehen und Ausreifen seines Wesens, dass vor dem
Schaffensernste äussere Verhältnisse unbedeutend werden
müssen und dass das sogenannte Kunstmärtyrertum
nur da Platz findet, wo unklares Wollen vorherrscht,
mit Ehrgeiz gemischt.
Ein wirklicher Künstler kann gar kein Kunstmärtyrer
sein — wenn auch die Lebensmisere, die er ja mit allen
Sterblichen gemeinsam zu tragen hat, ihn verfolgt;
gerade in seinem Schaffen ist ihm etwas gegeben, was
ihn aus dem Zufall der Geschehnisse erhebt. Dadurch,
dass ein Gott ihm gegeben „zu sagen, was er leidet“,
aber auch zu sagen, wie er sich freut, zu offenbaren,
was er schaut und hört, hat er schon seinen Lohn. —
Durch die Gaben, die Gott oder die Natur ihm gegeben,
wird er selber zum Gebenden.
wenn Künstlergenossenschaft und Kunstvereine meine
Bilder refüsierten. Es giebt Zeiten, wo die Kunst an
ihrer „Grösse“ zu Grunde geht, wenn nicht im Stillen
und unbemerkt von den Spaziergängern im Kunstgarten
ein Pflänzlein ganz anspruchslos und nur sich selbst
genügend wieder aufwächst. Ob es einem solchen
Pflänzlein lieb ist oder nicht, gut ist es ihm doch als
Entwicklung zu einem in sich harmonischen Wesen,
wenn man nicht zu früh und zu viel Wesens aus ihm
macht — es nicht da und dort hinzerrt und ganz etwas
anderes aus ihm gestalten will, als was es werden kann.
Im Rückblick auf diese Zeit bin ich vollständig zu-
frieden, dass es mit mir so war, wie es war; dass
ich es damals wohl manchmal anders gewünscht hätte
und gerne von aussen mehr gefördert worden wäre,
das ist natürlich — damals sah ich vorwärts, jetzt sehe
ich zurück.
Die Erfahrung habe ich gemacht, dass Vereinig-
ungen, seien sie staatlicher oder privater Art, mich nie
gefördert oder beachtet haben — aber es waren von
Anfang an Persönlichkeiten, die mir halfen und mich
stützten; denn das Persönlichste, was es giebt, die
echte Kunst, kann nur von Persönlichkeiten gestützt
und gefördert werden. — Persönlichkeit findet Persön-
lichkeit: dieser Glaube ist mir geworden und bleibt
mir, und ich spreche es aus, dass die Kunst von Ver-
einigungen, von sogenannter öffentlicher Meinung nie
Gutes zu erwarten hat. Sie wird von oben gesetzt von
der Persönlichkeit, deren Ausdruck sie ist. Sie kann
nicht von einer Allgemeinheit ausgehen — eine Seele,
ein Kopf kann sie nur schaffen. — Dass die Allgemein-
heit nachempfindet, was die Persönlichkeit ihr gegeben,
dass sie es gleichsam als ihr Werk empfindet, das ist ihr,
Glück; dass sie hintennachkommt, ist aber natürlich
ja, es ist wohl nicht anders möglich — die Persönlich-
keit giebt dem Volksempfinden Ausdruck, dem Unbe-
stimmten, das da wogt und ringt und zur Klarheit, zur
Aussprache oder zur Anschauung kommen will.
Der Ausspruch: „Das Genie bricht sich Bahn“
drückt es doch schon aus, das ihm etwas im Wege
steht, was es mit Gewalt überwinden, brechen muss. —
Das ist sein Wesen, dass es gestaltend aus dem Chaos
des Allgemeinempfindens hervorbricht — dem dunklen,
unklaren Triebe Form und Ordnung schaffend. Der
alte Schöpfungsspruch: „Es werde Licht!“ hat immer
noch für dasselbe Giltigkeit. Auch das Licht bricht
aus der Finsternis hervor. Das Genie, das „Vorzugs-
individuum“, ist freilich recht schwer zu erkennen,
und wohl erst am Schlüsse der Laufbahn oder wohl
noch später erkennt es die Menschheit, dass es eines
war — sollte es nicht auch schon Genie’s gegeben
haben, von denen die Welt nie etwas erfahren hat? —
die Natur ist verschwenderisch!
Das Echte in der Kunst! — der, der es erkennen
will, muss selber echt sein, und sehr oft meint Einer
zu prüfen und er wird geprüft. Es wird wohl kaum
einen jungen Künstler geben, der nicht überzeugt ist,
dass er ganz von echtem Kunstdrange erfüllt sei, es
wird wohl kaum Einer Künstler, wenn er nicht glaubt,
dass er hervorragendes Talent dazu hat. Jeder darf
sich selbst für ein „Vorzugsindividuum“ halten, darin
kann ihn keine Vereinigung hindern — aber auch keine
kann ihn dazu erheben, wenn er es doch nicht sein
sollte. Vorzugsmensch sein will aber was heissen und
es will bewiesen sein, deshalb sagt man auch „das
Genie bricht sich Bahn.“ Verunglückt durch irgend
etwas ein geborener Vorzugsmensch oder ruft der Tod
ihn ab, ehe er seiner Natur nach ausgestaltet wurde,
dann weiss es wohl nur Gott im Himmel. — Auf der
Stirn steht es doch nicht so ganz deutlich geschrieben,
dass EinerVorzugsindividuum ist — und die Täuschung
ist hierin gross und der Blick der Sterblichen ist
schwach. „Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener
Geist.“
Es giebt wohl einzelne Menschen, denen eine grosse
Gabe hier zu erkennen gegeben ist, aber wie sollte eine
Vereinigung da erkennen? Wer in solcher Vereinigung
soll entscheiden? — jeder ist doch gleichberechtigt,
d. h. jeder, der gleichhohen Beitrag zahlt. Soll Stimmen-
mehrheit auch noch über das Individuellste, was es giebt,
über die Kunst, entscheiden? — hat der 50 Markmann
ebenso viel zu sagen, wie der 1000 Markmann?
Kunstvereine giebt es übrigens schon lange, sie
sind gewiss in redlichster Absicht gegründet worden;
sie sind wohl auch so gut, als sie es nur sein können,
und sie haben gewiss zur Entwicklung der Kunst manches
beigetragen und haben in einer der Kunst nicht gün-
stigen Zeit Raum geschaffen, dass sie überhaupt zu
Worte kommen konnte; sie haben Interesse für die
Kunst in einen weiten Kreis getragen, und wenn auch
die Philistrosität natürlich an der Pflege der lieben
Mittelmässigkeit hängen blieb, so dürfen die Künstler
diesen Vereinen doch dankbar sein. — Könnten nun
nicht diese Kunstvereine ein wenig auf’s neue sich
ihrer Aufgabe besinnen, angeregt durch die Worte des
Herrn Klotz? Könnten dieselben nicht sich besinnen,
dass sie noch etwas anderes thun könnten, als blos
Bilder unter ihre Mitglieder zu verlosen? ob sie nicht
bei veränderten Zeitverhältnissen ihre Thätigkeit zum
Wohle der Kunst erspriesslicher gestalten könnten? Wie
dies zu machen wäre, darüber nachzudenken ist mehr
Sache des Kunstliebhabers als des Künstlers. Ein
wenig mehr Idealität in den Kunstvereinen könnte gut
sein; die Mitglieder würden dann nicht nur daran
denken, dass sie einen Gewinn für sich machen könnten
durch ein ihnen zufallendes Los, sondern sie würden
auch ein Opfer bringen, um die Kunst als wichtiges
Kulturelement zu fördern.
Durch all das, was ich hier sage, möchte ich, dass
die Meinung zutage tritt, dass der Künstler von Gott
und Rechts wegen alle Bedingungen in sich trägt zum
Bestehen und Ausreifen seines Wesens, dass vor dem
Schaffensernste äussere Verhältnisse unbedeutend werden
müssen und dass das sogenannte Kunstmärtyrertum
nur da Platz findet, wo unklares Wollen vorherrscht,
mit Ehrgeiz gemischt.
Ein wirklicher Künstler kann gar kein Kunstmärtyrer
sein — wenn auch die Lebensmisere, die er ja mit allen
Sterblichen gemeinsam zu tragen hat, ihn verfolgt;
gerade in seinem Schaffen ist ihm etwas gegeben, was
ihn aus dem Zufall der Geschehnisse erhebt. Dadurch,
dass ein Gott ihm gegeben „zu sagen, was er leidet“,
aber auch zu sagen, wie er sich freut, zu offenbaren,
was er schaut und hört, hat er schon seinen Lohn. —
Durch die Gaben, die Gott oder die Natur ihm gegeben,
wird er selber zum Gebenden.