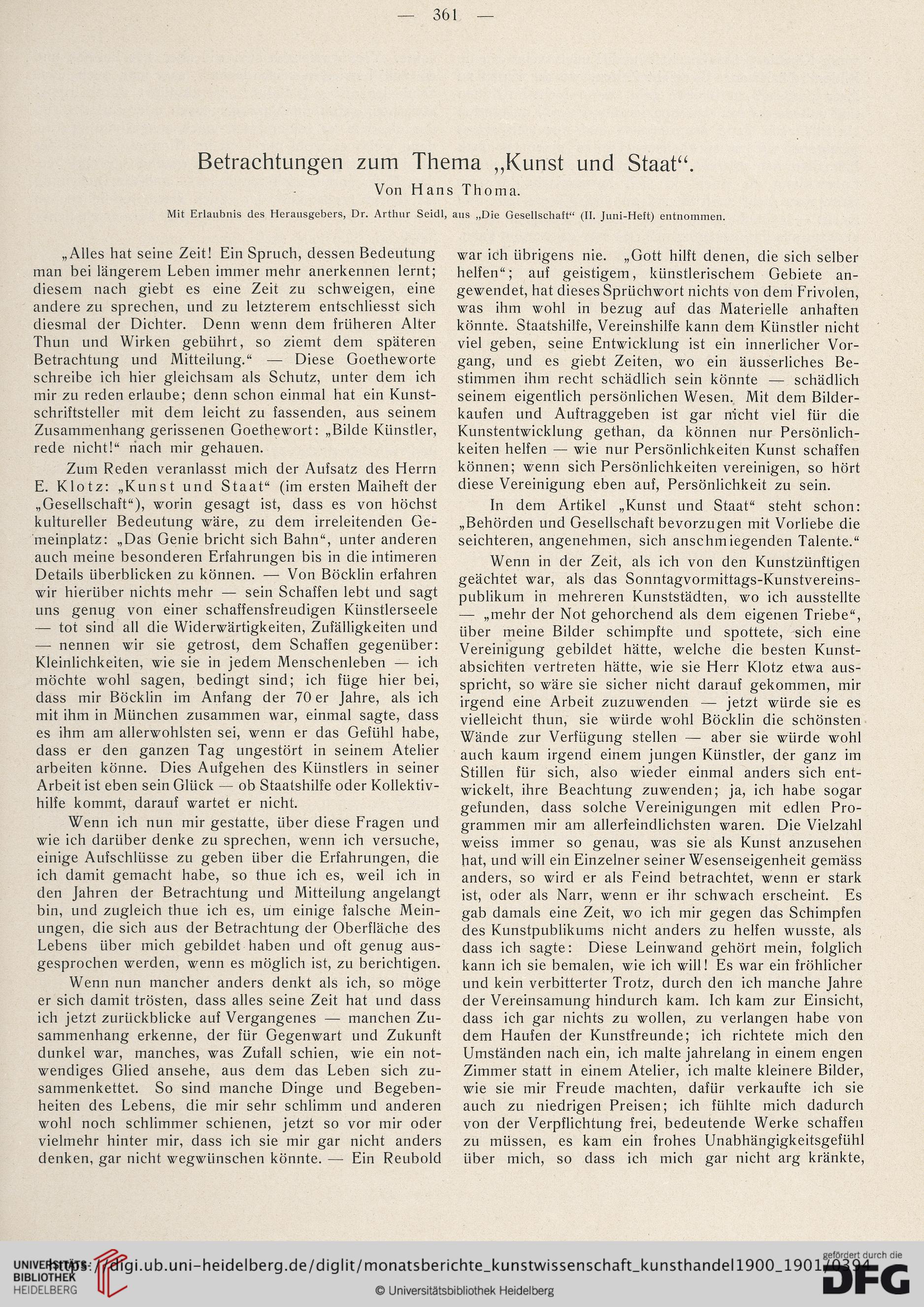361
Betrachtungen zum Thema „Kunst und Staat“.
Von Hans Thoma.
Mit Erlaubnis des Herausgebers, Dr. Arthur Seidl, aus „Die Gesellschaft“ (II. Juni-Heft) entnommen.
„Alles hat seine Zeit! Ein Spruch, dessen Bedeutung
man bei längerem Leben immer mehr anerkennen lernt;
diesem nach giebt es eine Zeit zu schweigen, eine
andere zu sprechen, und zu letzterem entschliesst sich
diesmal der Dichter. Denn wenn dem früheren Alter
Thun und Wirken gebührt, so ziemt dem späteren
Betrachtung und Mitteilung.“ — Diese Goetheworte
schreibe ich hier gleichsam als Schutz, unter dem ich
mir zu reden erlaube; denn schon einmal hat ein Kunst-
schriftsteller mit dem leicht zu fassenden, aus seinem
Zusammenhang gerissenen Goethewort: „Bilde Künstler,
rede nicht!“ nach mir gehauen.
Zum Reden veranlasst mich der Aufsatz des Herrn
E. Klotz: „Kunst und Staat“ (im ersten Maiheft der
„Gesellschaft“), worin gesagt ist, dass es von höchst
kultureller Bedeutung wäre, zu dem irreleitenden Ge-
meinplatz: „Das Genie bricht sich Bahn“, unter anderen
auch meine besonderen Erfahrungen bis in die intimeren
Details überblicken zu können. — Von Böcklin erfahren
wir hierüber nichts mehr — sein Schaffen lebt und sagt
uns genug von einer schaffensfreudigen Künstlerseele
— tot sind all die Widerwärtigkeiten, Zufälligkeiten und
— nennen wir sie getrost, dem Schaffen gegenüber:
Kleinlichkeiten, wie sie in jedem Menschenleben — ich
möchte wohl sagen, bedingt sind; ich füge hier bei,
dass mir Böcklin im Anfang der 70 er Jahre, als ich
mit ihm in München zusammen war, einmal sagte, dass
es ihm am allerwohlsten sei, wenn er das Gefühl habe,
dass er den ganzen Tag ungestört in seinem Atelier
arbeiten könne. Dies Aufgehen des Künstlers in seiner
Arbeit ist eben sein Glück — ob Staatshilfe oder Kollektiv-
hilfe kommt, darauf wartet er nicht.
Wenn ich nun mir gestatte, über diese Fragen und
wie ich darüber denke zu sprechen, wenn ich versuche,
einige Aufschlüsse zu geben über die Erfahrungen, die
ich damit gemacht habe, so thue ich es, weil ich in
den Jahren der Betrachtung und Mitteilung angelangt
bin, und zugleich thue ich es, um einige falsche Mein-
ungen, die sich aus der Betrachtung der Oberfläche des
Lebens über mich gebildet haben und oft genug aus-
gesprochen werden, wenn es möglich ist, zu berichtigen.
Wenn nun mancher anders denkt als ich, so möge
er sich damit trösten, dass alles seine Zeit hat und dass
ich jetzt zurückblicke auf Vergangenes — manchen Zu-
sammenhang erkenne, der für Gegenwart und Zukunft
dunkel war, manches, was Zufall schien, wie ein not-
wendiges Glied ansehe, aus dem das Leben sich zu-
sammenkettet. So sind manche Dinge und Begeben-
heiten des Lebens, die mir sehr schlimm und anderen
wohl noch schlimmer schienen, jetzt so vor mir oder
vielmehr hinter mir, dass ich sie mir gar nicht anders
denken, gar nicht wegwünschen könnte. — Ein Reubolcl
war ich übrigens nie. „Gott hilft denen, die sich selber
helfen“; auf geistigem, künstlerischem Gebiete an-
gewendet, hat dieses Sprüchwort nichts von dem Frivolen,
was ihm wohl in bezug auf das Materielle anhaften
könnte. Staatshilfe, Vereinshilfe kann dem Künstler nicht
viel geben, seine Entwicklung ist ein innerlicher Vor-
gang, und es giebt Zeiten, wo ein äusserliches Be-
stimmen ihm recht schädlich sein könnte — schädlich
seinem eigentlich persönlichen Wesen. Mit dem Bilder-
kaufen und Auftraggeben ist gar nicht viel für die
Kunstentwicklung gethan, da können nur Persönlich-
keiten helfen — wie nur Persönlichkeiten Kunst schaffen
können; wenn sich Persönlichkeiten vereinigen, so hört
diese Vereinigung eben auf, Persönlichkeit zu sein.
In dem Artikel „Kunst und Staat“ steht schon:
„Behörden und Gesellschaft bevorzugen mit Vorliebe die
seichteren, angenehmen, sich anschmiegenden Talente.“
Wenn in der Zeit, als ich von den Kunstzünftigen
geächtet war, als das Sonntagvormittags-Kunstvereins-
publikum in mehreren Kunststädten, wo ich ausstellte
— „mehr der Not gehorchend als dem eigenen Triebe“,
über meine Bilder schimpfte und spottete, sich eine
Vereinigung gebildet hätte, welche die besten Kunst-
absichten vertreten hätte, wie sie Herr Klotz etwa aus-
spricht, so wäre sie sicher nicht darauf gekommen, mir
irgend eine Arbeit zuzuwenden — jetzt würde sie es
vielleicht thun, sie würde wohl Böcklin die schönsten
Wände zur Verfügung stellen — aber sie würde wohl
auch kaum irgend einem jungen Künstler, der ganz im
Stillen für sich, also wieder einmal anders sich ent-
wickelt, ihre Beachtung zuwenden; ja, ich habe sogar
gefunden, dass solche Vereinigungen mit edlen Pro-
grammen mir am allerfeindlichsten waren. Die Vielzahl
weiss immer so genau, was sie als Kunst anzusehen
hat, und will ein Einzelner seinerWesenseigenheit gemäss
anders, so wird er als Feind betrachtet, wenn er stark
ist, oder als Narr, wenn er ihr schwach erscheint. Es
gab damals eine Zeit, wo ich mir gegen das Schimpfen
des Kunstpublikums nicht anders zu helfen wusste, als
dass ich sagte: Diese Leinwand gehört mein, folglich
kann ich sie bemalen, wie ich will! Es war ein fröhlicher
und kein verbitterter Trotz, durch den ich manche Jahre
der Vereinsamung hindurch kam. Ich kam zur Einsicht,
dass ich gar nichts zu wollen, zu verlangen habe von
dem Haufen der Kunstfreunde; ich richtete mich den
Umständen nach ein, ich malte jahrelang in einem engen
Zimmer statt in einem Atelier, ich malte kleinere Bilder,
wie sie mir Freude machten, dafür verkaufte ich sie
auch zu niedrigen Preisen; ich fühlte mich dadurch
von der Verpflichtung frei, bedeutende Werke schaffen
zu müssen, es kam ein frohes Unabhängigkeitsgefühl
über mich, so dass ich mich gar nicht arg kränkte,
Betrachtungen zum Thema „Kunst und Staat“.
Von Hans Thoma.
Mit Erlaubnis des Herausgebers, Dr. Arthur Seidl, aus „Die Gesellschaft“ (II. Juni-Heft) entnommen.
„Alles hat seine Zeit! Ein Spruch, dessen Bedeutung
man bei längerem Leben immer mehr anerkennen lernt;
diesem nach giebt es eine Zeit zu schweigen, eine
andere zu sprechen, und zu letzterem entschliesst sich
diesmal der Dichter. Denn wenn dem früheren Alter
Thun und Wirken gebührt, so ziemt dem späteren
Betrachtung und Mitteilung.“ — Diese Goetheworte
schreibe ich hier gleichsam als Schutz, unter dem ich
mir zu reden erlaube; denn schon einmal hat ein Kunst-
schriftsteller mit dem leicht zu fassenden, aus seinem
Zusammenhang gerissenen Goethewort: „Bilde Künstler,
rede nicht!“ nach mir gehauen.
Zum Reden veranlasst mich der Aufsatz des Herrn
E. Klotz: „Kunst und Staat“ (im ersten Maiheft der
„Gesellschaft“), worin gesagt ist, dass es von höchst
kultureller Bedeutung wäre, zu dem irreleitenden Ge-
meinplatz: „Das Genie bricht sich Bahn“, unter anderen
auch meine besonderen Erfahrungen bis in die intimeren
Details überblicken zu können. — Von Böcklin erfahren
wir hierüber nichts mehr — sein Schaffen lebt und sagt
uns genug von einer schaffensfreudigen Künstlerseele
— tot sind all die Widerwärtigkeiten, Zufälligkeiten und
— nennen wir sie getrost, dem Schaffen gegenüber:
Kleinlichkeiten, wie sie in jedem Menschenleben — ich
möchte wohl sagen, bedingt sind; ich füge hier bei,
dass mir Böcklin im Anfang der 70 er Jahre, als ich
mit ihm in München zusammen war, einmal sagte, dass
es ihm am allerwohlsten sei, wenn er das Gefühl habe,
dass er den ganzen Tag ungestört in seinem Atelier
arbeiten könne. Dies Aufgehen des Künstlers in seiner
Arbeit ist eben sein Glück — ob Staatshilfe oder Kollektiv-
hilfe kommt, darauf wartet er nicht.
Wenn ich nun mir gestatte, über diese Fragen und
wie ich darüber denke zu sprechen, wenn ich versuche,
einige Aufschlüsse zu geben über die Erfahrungen, die
ich damit gemacht habe, so thue ich es, weil ich in
den Jahren der Betrachtung und Mitteilung angelangt
bin, und zugleich thue ich es, um einige falsche Mein-
ungen, die sich aus der Betrachtung der Oberfläche des
Lebens über mich gebildet haben und oft genug aus-
gesprochen werden, wenn es möglich ist, zu berichtigen.
Wenn nun mancher anders denkt als ich, so möge
er sich damit trösten, dass alles seine Zeit hat und dass
ich jetzt zurückblicke auf Vergangenes — manchen Zu-
sammenhang erkenne, der für Gegenwart und Zukunft
dunkel war, manches, was Zufall schien, wie ein not-
wendiges Glied ansehe, aus dem das Leben sich zu-
sammenkettet. So sind manche Dinge und Begeben-
heiten des Lebens, die mir sehr schlimm und anderen
wohl noch schlimmer schienen, jetzt so vor mir oder
vielmehr hinter mir, dass ich sie mir gar nicht anders
denken, gar nicht wegwünschen könnte. — Ein Reubolcl
war ich übrigens nie. „Gott hilft denen, die sich selber
helfen“; auf geistigem, künstlerischem Gebiete an-
gewendet, hat dieses Sprüchwort nichts von dem Frivolen,
was ihm wohl in bezug auf das Materielle anhaften
könnte. Staatshilfe, Vereinshilfe kann dem Künstler nicht
viel geben, seine Entwicklung ist ein innerlicher Vor-
gang, und es giebt Zeiten, wo ein äusserliches Be-
stimmen ihm recht schädlich sein könnte — schädlich
seinem eigentlich persönlichen Wesen. Mit dem Bilder-
kaufen und Auftraggeben ist gar nicht viel für die
Kunstentwicklung gethan, da können nur Persönlich-
keiten helfen — wie nur Persönlichkeiten Kunst schaffen
können; wenn sich Persönlichkeiten vereinigen, so hört
diese Vereinigung eben auf, Persönlichkeit zu sein.
In dem Artikel „Kunst und Staat“ steht schon:
„Behörden und Gesellschaft bevorzugen mit Vorliebe die
seichteren, angenehmen, sich anschmiegenden Talente.“
Wenn in der Zeit, als ich von den Kunstzünftigen
geächtet war, als das Sonntagvormittags-Kunstvereins-
publikum in mehreren Kunststädten, wo ich ausstellte
— „mehr der Not gehorchend als dem eigenen Triebe“,
über meine Bilder schimpfte und spottete, sich eine
Vereinigung gebildet hätte, welche die besten Kunst-
absichten vertreten hätte, wie sie Herr Klotz etwa aus-
spricht, so wäre sie sicher nicht darauf gekommen, mir
irgend eine Arbeit zuzuwenden — jetzt würde sie es
vielleicht thun, sie würde wohl Böcklin die schönsten
Wände zur Verfügung stellen — aber sie würde wohl
auch kaum irgend einem jungen Künstler, der ganz im
Stillen für sich, also wieder einmal anders sich ent-
wickelt, ihre Beachtung zuwenden; ja, ich habe sogar
gefunden, dass solche Vereinigungen mit edlen Pro-
grammen mir am allerfeindlichsten waren. Die Vielzahl
weiss immer so genau, was sie als Kunst anzusehen
hat, und will ein Einzelner seinerWesenseigenheit gemäss
anders, so wird er als Feind betrachtet, wenn er stark
ist, oder als Narr, wenn er ihr schwach erscheint. Es
gab damals eine Zeit, wo ich mir gegen das Schimpfen
des Kunstpublikums nicht anders zu helfen wusste, als
dass ich sagte: Diese Leinwand gehört mein, folglich
kann ich sie bemalen, wie ich will! Es war ein fröhlicher
und kein verbitterter Trotz, durch den ich manche Jahre
der Vereinsamung hindurch kam. Ich kam zur Einsicht,
dass ich gar nichts zu wollen, zu verlangen habe von
dem Haufen der Kunstfreunde; ich richtete mich den
Umständen nach ein, ich malte jahrelang in einem engen
Zimmer statt in einem Atelier, ich malte kleinere Bilder,
wie sie mir Freude machten, dafür verkaufte ich sie
auch zu niedrigen Preisen; ich fühlte mich dadurch
von der Verpflichtung frei, bedeutende Werke schaffen
zu müssen, es kam ein frohes Unabhängigkeitsgefühl
über mich, so dass ich mich gar nicht arg kränkte,