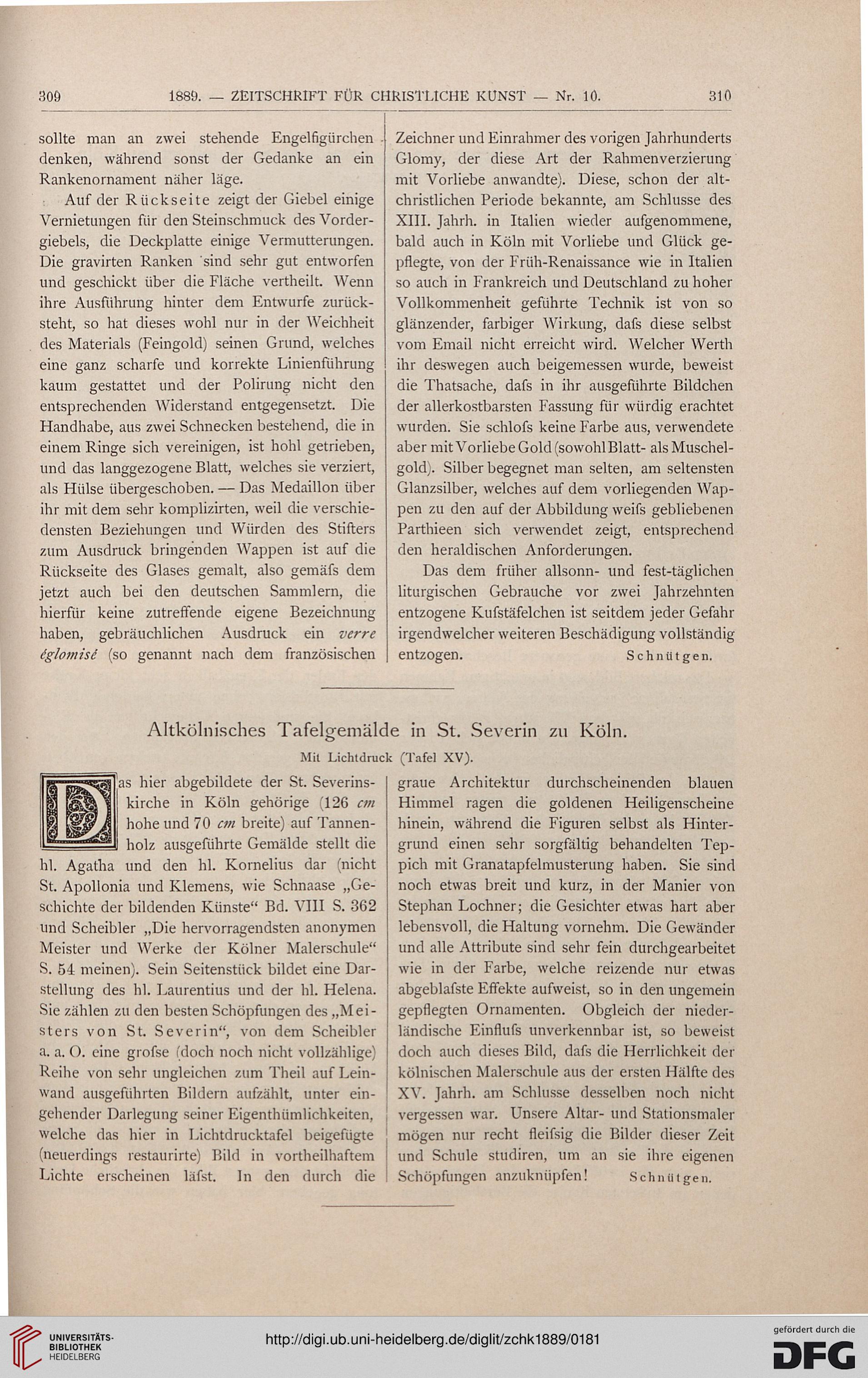306
1889. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
310
sollte man an zwei stehende Engelfigürchen .
denken, während sonst der Gedanke an ein
Rankenornament näher läge.
Auf der Rückseite zeigt der Giebel einige
Vernietungen für den Steinschmuck des Vorder-
giebels, die Deckplatte einige Vermutterungen.
Die gravirten Ranken sind sehr gut entworfen
und geschickt über die Fläche vertheilt. Wenn
ihre Ausführung hinter dem Entwürfe zurück-
steht, so hat dieses wohl nur in der Weichheit
des Materials (Feingold) seinen Grund, welches
eine ganz scharfe und korrekte Linienführung
kaum gestattet und der Polirung nicht den
entsprechenden Widerstand entgegensetzt. Die
Handhabe, aus zwei Schnecken bestehend, die in
einem Ringe sich vereinigen, ist hohl getrieben,
und das langgezogene Blatt, welches sie verziert,
als Hülse übergeschoben. — Das Medaillon über
ihr mit dem sehr komplizirten, weil die verschie-
densten Beziehungen und Würden des Stifters
zum Ausdruck bringenden Wappen ist auf die
Rückseite des Glases gemalt, also gemäfs dem
jetzt auch bei den deutschen Sammlern, die
hierfür keine zutreffende eigene Bezeichnung
haben, gebräuchlichen Ausdruck ein vcrre
iglomisi (so genannt nach dem französischen
Zeichner und Einrahmer des vorigen Jahrhunderts
Glomy, der diese Art der Rahmenverzierung
mit Vorliebe anwandte). Diese, schon der alt-
christlichen Periode bekannte, am Schlüsse des
XIII. Jahrh. in Italien wieder aufgenommene,
bald auch in Köln mit Vorliebe und Glück ge-
pflegte, von der Früh-Renaissance wie in Italien
so auch in Frankreich und Deutschland zu hoher
Vollkommenheit geführte Technik ist von so
glänzender, farbiger Wirkung, dafs diese selbst
vom Email nicht erreicht wird. Welcher Werth
ihr deswegen auch beigemessen wurde, beweist
die Thatsache, dafs in ihr ausgeführte Bildchen
der allerkostbarsten Fassung für würdig erachtet
wurden. Sie schlofs keine Farbe aus, verwendete
aber mit Vorliebe Gold (sowohl Blatt- alsMuschel-
gold). Silber begegnet man selten, am seltensten
Glanzsilber, welches auf dem vorliegenden Wap-
pen zu den auf der Abbildung weifs gebliebenen
Parthieen sich verwendet zeigt, entsprechend
den heraldischen Anforderungen.
Das dem früher allsonn- und fest-täglichen
liturgischen Gebrauche vor zwei Jahrzehnten
entzogene Kufstäfelchen ist seitdem jeder Gefahr
irgendwelcher weiteren Beschädigung vollständig
entzogen. Schnitt gen.
Altkölnisches Tafelgemälde in St. Severin zu Köln.
Mit Lichtdruck (Tafel XV).
as hier abgebildete der St. Severins-
kirche in Köln gehörige (126 an
hohe und 70 cm breite) auf Tannen-
holz ausgeführte Gemälde stellt die
hl. Agatha und den hl. Kornelius dar (nicht
St. Apollonia und Klemens, wie Schnaase „Ge-
schichte der bildenden Künste" Bd. VIII S. 362
und Scheibler „Die hervorragendsten anonymen
Meister und Werke der Kölner Malerschule"
S. 54 meinen). Sein Seitenstück bildet eine Dar-
stellung des hl. Laurentius und der hl. Helena.
Sie zählen zu den besten Schöpfungen des „Mei-
sters von St. Severin", von dem Scheibler
a. a. 0. eine grofse (doch noch nicht vollzählige)
Reihe von sehr ungleichen zum Theil auf Lein-
wand ausgeführten Bildern aufzählt, unter ein-
gehender Darlegung seiner Eigenthümlichkeiten,
welche das hier in Lichtdrucktafel beigefügte
(neuerdings restaurirte) Bild in vorteilhaftem
Lichte erscheinen läfst. In den durch die
graue Architektur durchscheinenden blauen
Himmel ragen die goldenen Heiligenscheine
hinein, während die Figuren selbst als Hinter-
grund einen sehr sorgfältig behandelten Tep-
pich mit Granatapfelmusterung haben. Sie sind
noch etwas breit und kurz, in der Manier von
Stephan Lochner; die Gesichter etwas hart aber
lebensvoll, die Haltung vornehm. Die Gewänder
und alle Attribute sind sehr fein durchgearbeitet
wie in der Farbe, welche reizende nur etwas
abgeblafste Effekte aufweist, so in den ungemein
gepflegten Ornamenten. Obgleich der nieder-
ländische Einflufs unverkennbar ist, so beweist
doch auch dieses Bild, dafs die Herrlichkeit der
kölnischen Malerschule aus der ersten Hälfte des
XV. Jahrh. am Schlüsse desselben noch nicht
vergessen war. Unsere Altar- und Stationsmaler
mögen nur recht fleifsig die Bilder dieser Zeit
und Schule studiren, um an sie ihre eigenen
Schöpfungen anzuknüpfen! Schniitgen.
1889. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
310
sollte man an zwei stehende Engelfigürchen .
denken, während sonst der Gedanke an ein
Rankenornament näher läge.
Auf der Rückseite zeigt der Giebel einige
Vernietungen für den Steinschmuck des Vorder-
giebels, die Deckplatte einige Vermutterungen.
Die gravirten Ranken sind sehr gut entworfen
und geschickt über die Fläche vertheilt. Wenn
ihre Ausführung hinter dem Entwürfe zurück-
steht, so hat dieses wohl nur in der Weichheit
des Materials (Feingold) seinen Grund, welches
eine ganz scharfe und korrekte Linienführung
kaum gestattet und der Polirung nicht den
entsprechenden Widerstand entgegensetzt. Die
Handhabe, aus zwei Schnecken bestehend, die in
einem Ringe sich vereinigen, ist hohl getrieben,
und das langgezogene Blatt, welches sie verziert,
als Hülse übergeschoben. — Das Medaillon über
ihr mit dem sehr komplizirten, weil die verschie-
densten Beziehungen und Würden des Stifters
zum Ausdruck bringenden Wappen ist auf die
Rückseite des Glases gemalt, also gemäfs dem
jetzt auch bei den deutschen Sammlern, die
hierfür keine zutreffende eigene Bezeichnung
haben, gebräuchlichen Ausdruck ein vcrre
iglomisi (so genannt nach dem französischen
Zeichner und Einrahmer des vorigen Jahrhunderts
Glomy, der diese Art der Rahmenverzierung
mit Vorliebe anwandte). Diese, schon der alt-
christlichen Periode bekannte, am Schlüsse des
XIII. Jahrh. in Italien wieder aufgenommene,
bald auch in Köln mit Vorliebe und Glück ge-
pflegte, von der Früh-Renaissance wie in Italien
so auch in Frankreich und Deutschland zu hoher
Vollkommenheit geführte Technik ist von so
glänzender, farbiger Wirkung, dafs diese selbst
vom Email nicht erreicht wird. Welcher Werth
ihr deswegen auch beigemessen wurde, beweist
die Thatsache, dafs in ihr ausgeführte Bildchen
der allerkostbarsten Fassung für würdig erachtet
wurden. Sie schlofs keine Farbe aus, verwendete
aber mit Vorliebe Gold (sowohl Blatt- alsMuschel-
gold). Silber begegnet man selten, am seltensten
Glanzsilber, welches auf dem vorliegenden Wap-
pen zu den auf der Abbildung weifs gebliebenen
Parthieen sich verwendet zeigt, entsprechend
den heraldischen Anforderungen.
Das dem früher allsonn- und fest-täglichen
liturgischen Gebrauche vor zwei Jahrzehnten
entzogene Kufstäfelchen ist seitdem jeder Gefahr
irgendwelcher weiteren Beschädigung vollständig
entzogen. Schnitt gen.
Altkölnisches Tafelgemälde in St. Severin zu Köln.
Mit Lichtdruck (Tafel XV).
as hier abgebildete der St. Severins-
kirche in Köln gehörige (126 an
hohe und 70 cm breite) auf Tannen-
holz ausgeführte Gemälde stellt die
hl. Agatha und den hl. Kornelius dar (nicht
St. Apollonia und Klemens, wie Schnaase „Ge-
schichte der bildenden Künste" Bd. VIII S. 362
und Scheibler „Die hervorragendsten anonymen
Meister und Werke der Kölner Malerschule"
S. 54 meinen). Sein Seitenstück bildet eine Dar-
stellung des hl. Laurentius und der hl. Helena.
Sie zählen zu den besten Schöpfungen des „Mei-
sters von St. Severin", von dem Scheibler
a. a. 0. eine grofse (doch noch nicht vollzählige)
Reihe von sehr ungleichen zum Theil auf Lein-
wand ausgeführten Bildern aufzählt, unter ein-
gehender Darlegung seiner Eigenthümlichkeiten,
welche das hier in Lichtdrucktafel beigefügte
(neuerdings restaurirte) Bild in vorteilhaftem
Lichte erscheinen läfst. In den durch die
graue Architektur durchscheinenden blauen
Himmel ragen die goldenen Heiligenscheine
hinein, während die Figuren selbst als Hinter-
grund einen sehr sorgfältig behandelten Tep-
pich mit Granatapfelmusterung haben. Sie sind
noch etwas breit und kurz, in der Manier von
Stephan Lochner; die Gesichter etwas hart aber
lebensvoll, die Haltung vornehm. Die Gewänder
und alle Attribute sind sehr fein durchgearbeitet
wie in der Farbe, welche reizende nur etwas
abgeblafste Effekte aufweist, so in den ungemein
gepflegten Ornamenten. Obgleich der nieder-
ländische Einflufs unverkennbar ist, so beweist
doch auch dieses Bild, dafs die Herrlichkeit der
kölnischen Malerschule aus der ersten Hälfte des
XV. Jahrh. am Schlüsse desselben noch nicht
vergessen war. Unsere Altar- und Stationsmaler
mögen nur recht fleifsig die Bilder dieser Zeit
und Schule studiren, um an sie ihre eigenen
Schöpfungen anzuknüpfen! Schniitgen.