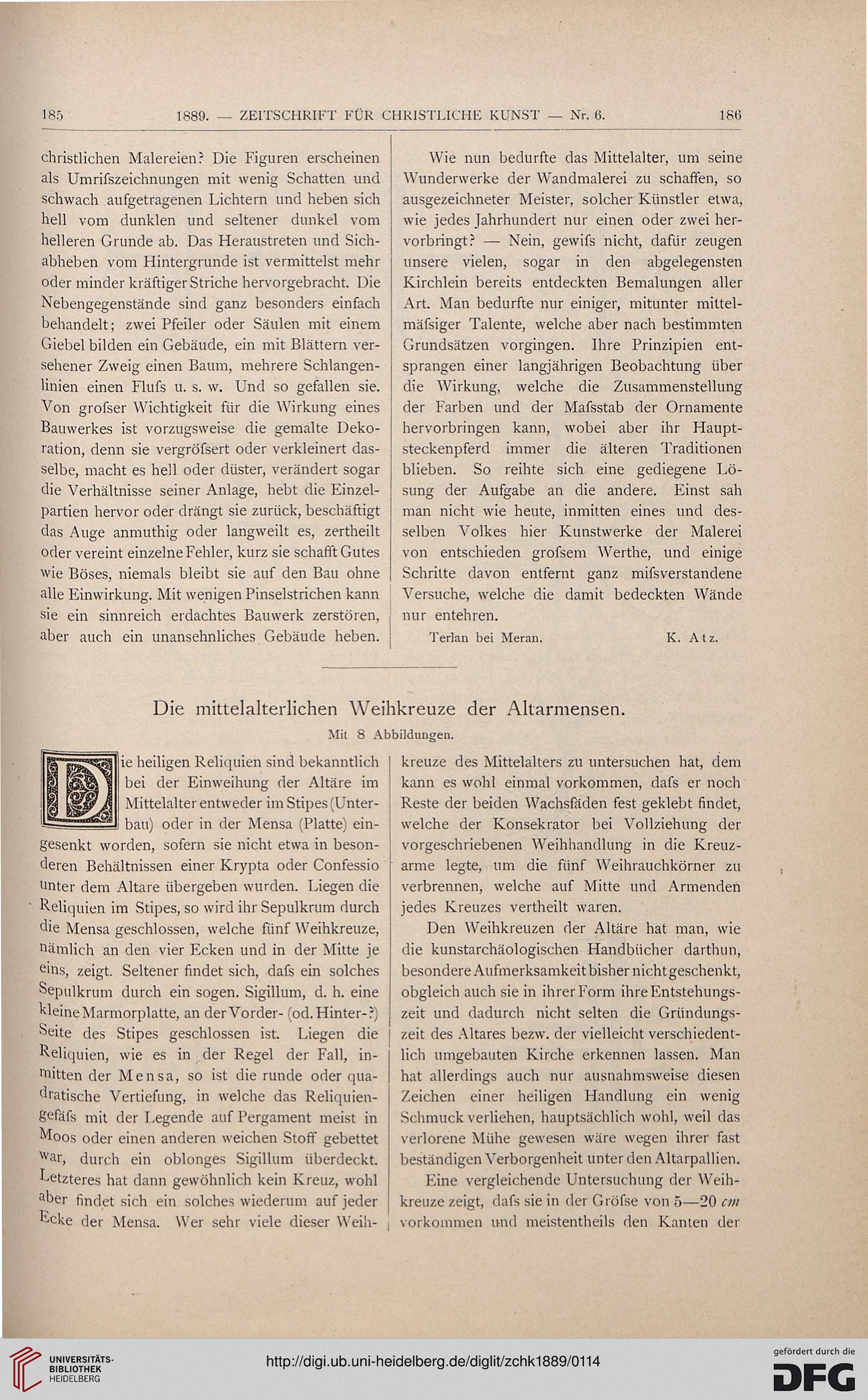185
1889. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 6.
18(5
christlichen Malereien? Die Figuren erscheinen
als Umrifszeichnungen mit wenig Schatten und
schwach aufgetragenen Lichtern und heben sich
hell vom dunklen und seltener dunkel vom
helleren Grunde ab. Das Heraustreten und Sich-
abheben vom Hintergrunde ist vermittelst mehr
oder minder kräftiger Striche hervorgebracht. Die
Nebengegenstände sind ganz besonders einfach
behandelt; zwei Pfeiler oder Säulen mit einem
Giebel bilden ein Gebäude, ein mit Blättern ver-
sehener Zweig einen Baum, mehrere Schlangen-
linien einen Flufs u. s. w. Und so gefallen sie.
Von grofser Wichtigkeit für die Wirkung eines
Bauwerkes ist vorzugsweise die gemalte Deko-
ration, denn sie vergröfsert oder verkleinert das-
selbe, macht es hell oder düster, verändert sogar
die Verhältnisse seiner Anlage, hebt die Einzel-
partien hervor oder drängt sie zurück, beschäftigt
das Auge anmuthig oder langweilt es, zertheilt
oder vereint einzelne Fehler, kurz sie schafft Gutes
wie Böses, niemals bleibt sie auf den Bau ohne
alle Einwirkung. Mit wenigen Pinselstrichen kann
sie ein sinnreich erdachtes Bauwerk zerstören,
aber auch ein unansehnliches Gebäude heben.
Wie nun bedurfte das Mittelalter, um seine
Wunderwerke der Wandmalerei zu schaffen, so
ausgezeichneter Meister, solcher Künstler etwa,
wie jedes Jahrhundert nur einen oder zwei her-
vorbringt? — Nein, gewifs nicht, dafür zeugen
unsere vielen, sogar in den abgelegensten
Kirchlein bereits entdeckten Bemalungen aller
Art. Man bedurfte nur einiger, mitunter mittel-
mäfsiger Talente, welche aber nach bestimmten
Grundsätzen vorgingen. Ihre Prinzipien ent-
sprangen einer langjährigen Beobachtung über
die Wirkung, welche die Zusammenstellung
der Farben und der Mafsstab der Ornamente
hervorbringen kann, wobei aber ihr Haupt-
steckenpferd immer die älteren Traditionen
blieben. So reihte sich eine gediegene Lö-
sung der Aufgabe an die andere. Einst sah
man nicht wie heute, inmitten eines und des-
selben Volkes hier Kunstwerke der Malerei
von entschieden grofsem Werthe, und einige
Schritte davon entfernt ganz mifsverstandene
Versuche, welche die damit bedeckten Wände
nur entehren.
Terlan bei Meran. K. Atz.
Die mittelalterlichen Weihkreuze der Altarmensen.
Mit 8 Abbildungen.
ie heiligen Reliquien sind bekanntlich
bei der Einweihung der Altäre im
Mittelalter entweder im Stipes (Unter-
bau) oder in der Mensa (Platte) ein-
gesenkt worden, sofern sie nicht etwa in beson-
deren Behältnissen einer Krypta oder Confessio
unter dem Altare übergeben wurden. Liegen die
Reliquien im Stipes, so wird ihr Sepulkrum durch
die Mensa geschlossen, welche fünf Weihkreuze,
Dämlich an den vier Ecken und in der Mitte je
eins, zeigt. Seltener findet sich, dafs ein solches
Sepulkrum durch ein sogen. Sigillum, d. h. eine
kleine Marmorplatte, an der Vorder- (od. Hinter-?)
Seite des Stipes geschlossen ist. Liegen die
Reliquien, wie es in der Regel der Fall, in-
mitten der Mensa, so ist die runde oder qua-
dratische Vertiefung, in welche das Reliquien-
gefäfs mit der Legende auf Pergament meist in
Moos oder einen anderen weichen Stofif gebettet
war, durch ein oblonges Sigillum überdeckt.
Letzteres hat dann gewöhnlich kein Kreuz, wohl
aber findet sich ein solches wiederum auf jeder
Kcke der Mensa. Wer sehr viele dieser Weih-
kreuze des Mittelalters zu untersuchen hat, dem
kann es wohl einmal vorkommen, dafs er noch
Reste der beiden Wachsfäden fest geklebt findet,
welche der Konsekrator bei Vollziehung der
vorgeschriebenen Weihhandlung in die Kreuz-
arme legte, um die fünf Weihrauchkörner zu
verbrennen, welche auf Mitte und Armenden
jedes Kreuzes vertheilt waren.
Den Weihkreuzen der Altäre hat man, wie
die kunstarchäologischen Handbücher darthun,
besondere Aufmerksamkeit bisher nicht geschenkt,
obgleich auch sie in ihrer Form ihre Entstehungs-
zeit und dadurch nicht selten die Gründungs-
zeit des Altares bezw. der vielleicht verschiedent-
lich umgebauten Kirche erkennen lassen. Man
hat allerdings auch nur ausnahmsweise diesen
Zeichen einer heiligen Handlung ein wenig
Schmuck verliehen, hauptsächlich wohl, weil das
verlorene Mühe gewesen wäre wegen ihrer fast
beständigen Verborgenheit unter den Altarpallien.
Eine vergleichende Untersuchung der Weih-
kreuze zeigt, dafs sie in der Gröfse von 5—20 cm
vorkommen und meistentheils den Kanten der
1889. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 6.
18(5
christlichen Malereien? Die Figuren erscheinen
als Umrifszeichnungen mit wenig Schatten und
schwach aufgetragenen Lichtern und heben sich
hell vom dunklen und seltener dunkel vom
helleren Grunde ab. Das Heraustreten und Sich-
abheben vom Hintergrunde ist vermittelst mehr
oder minder kräftiger Striche hervorgebracht. Die
Nebengegenstände sind ganz besonders einfach
behandelt; zwei Pfeiler oder Säulen mit einem
Giebel bilden ein Gebäude, ein mit Blättern ver-
sehener Zweig einen Baum, mehrere Schlangen-
linien einen Flufs u. s. w. Und so gefallen sie.
Von grofser Wichtigkeit für die Wirkung eines
Bauwerkes ist vorzugsweise die gemalte Deko-
ration, denn sie vergröfsert oder verkleinert das-
selbe, macht es hell oder düster, verändert sogar
die Verhältnisse seiner Anlage, hebt die Einzel-
partien hervor oder drängt sie zurück, beschäftigt
das Auge anmuthig oder langweilt es, zertheilt
oder vereint einzelne Fehler, kurz sie schafft Gutes
wie Böses, niemals bleibt sie auf den Bau ohne
alle Einwirkung. Mit wenigen Pinselstrichen kann
sie ein sinnreich erdachtes Bauwerk zerstören,
aber auch ein unansehnliches Gebäude heben.
Wie nun bedurfte das Mittelalter, um seine
Wunderwerke der Wandmalerei zu schaffen, so
ausgezeichneter Meister, solcher Künstler etwa,
wie jedes Jahrhundert nur einen oder zwei her-
vorbringt? — Nein, gewifs nicht, dafür zeugen
unsere vielen, sogar in den abgelegensten
Kirchlein bereits entdeckten Bemalungen aller
Art. Man bedurfte nur einiger, mitunter mittel-
mäfsiger Talente, welche aber nach bestimmten
Grundsätzen vorgingen. Ihre Prinzipien ent-
sprangen einer langjährigen Beobachtung über
die Wirkung, welche die Zusammenstellung
der Farben und der Mafsstab der Ornamente
hervorbringen kann, wobei aber ihr Haupt-
steckenpferd immer die älteren Traditionen
blieben. So reihte sich eine gediegene Lö-
sung der Aufgabe an die andere. Einst sah
man nicht wie heute, inmitten eines und des-
selben Volkes hier Kunstwerke der Malerei
von entschieden grofsem Werthe, und einige
Schritte davon entfernt ganz mifsverstandene
Versuche, welche die damit bedeckten Wände
nur entehren.
Terlan bei Meran. K. Atz.
Die mittelalterlichen Weihkreuze der Altarmensen.
Mit 8 Abbildungen.
ie heiligen Reliquien sind bekanntlich
bei der Einweihung der Altäre im
Mittelalter entweder im Stipes (Unter-
bau) oder in der Mensa (Platte) ein-
gesenkt worden, sofern sie nicht etwa in beson-
deren Behältnissen einer Krypta oder Confessio
unter dem Altare übergeben wurden. Liegen die
Reliquien im Stipes, so wird ihr Sepulkrum durch
die Mensa geschlossen, welche fünf Weihkreuze,
Dämlich an den vier Ecken und in der Mitte je
eins, zeigt. Seltener findet sich, dafs ein solches
Sepulkrum durch ein sogen. Sigillum, d. h. eine
kleine Marmorplatte, an der Vorder- (od. Hinter-?)
Seite des Stipes geschlossen ist. Liegen die
Reliquien, wie es in der Regel der Fall, in-
mitten der Mensa, so ist die runde oder qua-
dratische Vertiefung, in welche das Reliquien-
gefäfs mit der Legende auf Pergament meist in
Moos oder einen anderen weichen Stofif gebettet
war, durch ein oblonges Sigillum überdeckt.
Letzteres hat dann gewöhnlich kein Kreuz, wohl
aber findet sich ein solches wiederum auf jeder
Kcke der Mensa. Wer sehr viele dieser Weih-
kreuze des Mittelalters zu untersuchen hat, dem
kann es wohl einmal vorkommen, dafs er noch
Reste der beiden Wachsfäden fest geklebt findet,
welche der Konsekrator bei Vollziehung der
vorgeschriebenen Weihhandlung in die Kreuz-
arme legte, um die fünf Weihrauchkörner zu
verbrennen, welche auf Mitte und Armenden
jedes Kreuzes vertheilt waren.
Den Weihkreuzen der Altäre hat man, wie
die kunstarchäologischen Handbücher darthun,
besondere Aufmerksamkeit bisher nicht geschenkt,
obgleich auch sie in ihrer Form ihre Entstehungs-
zeit und dadurch nicht selten die Gründungs-
zeit des Altares bezw. der vielleicht verschiedent-
lich umgebauten Kirche erkennen lassen. Man
hat allerdings auch nur ausnahmsweise diesen
Zeichen einer heiligen Handlung ein wenig
Schmuck verliehen, hauptsächlich wohl, weil das
verlorene Mühe gewesen wäre wegen ihrer fast
beständigen Verborgenheit unter den Altarpallien.
Eine vergleichende Untersuchung der Weih-
kreuze zeigt, dafs sie in der Gröfse von 5—20 cm
vorkommen und meistentheils den Kanten der