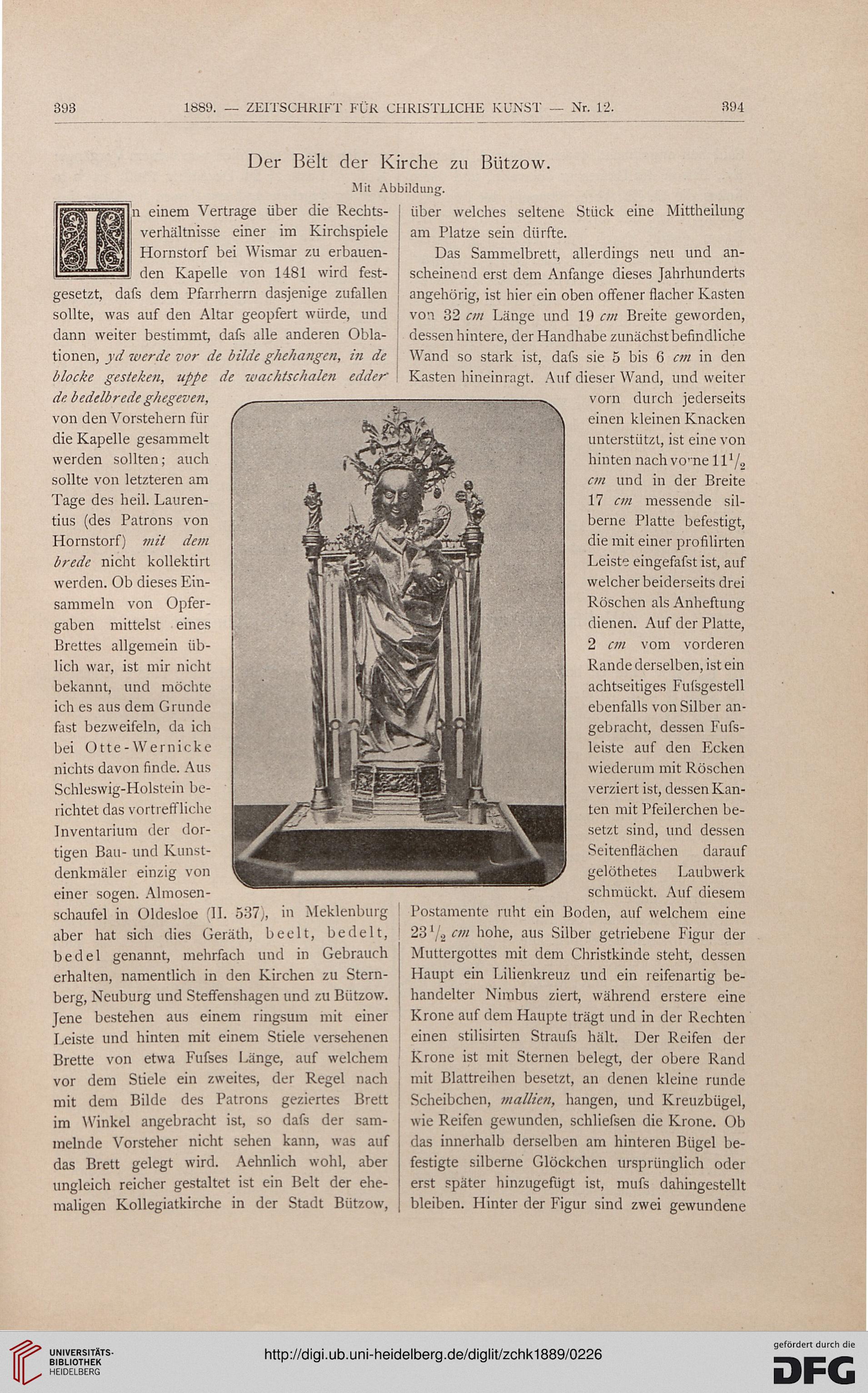393
1889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
394
Der Belt der Kirche zu Bützow.
Mit Abbildung:.
n einem Vertrage über die Rechts-
verhältnisse einer im Kirchspiele
Hornstorf bei Wismar zu erbauen-
]i den Kapelle von 1481 wird fest-
gesetzt, dafs dem Pfarrherrn dasjenige zufallen
sollte, was auf den Altar geopfert würde, und
dann weiter bestimmt, dafs alle anderen Obla-
tionen, yd werde vor de bilde ghehangen, in de
blocke gestehen, uppe de wachtschalen edder'
de bedelbrede ghegeven,
von den Vorstehern für
die Kapelle gesammelt
werden sollten; auch
sollte von letzteren am
Tage des heil. Lauren-
tius (des Patrons von
Hornstorf) mit dem
brede nicht kollektirt
werden. Ob dieses Ein-
sammeln von Opfer-
gaben mittelst eines
Brettes allgemein üb-
lich war, ist mir nicht
bekannt, und möchte
ich es aus dem Grunde
fast bezweifeln, da ich
bei Otte-Wernicke
nichts davon finde. Aus
Schleswig-Holstein be-
richtet das vortreffliche
Inventarium der dor-
tigen Bau- und Kunst-
denkmäler einzig von
einer sogen. Almosen-
schaufel in Oldesloe (II. 537), in Meklenburg
aber hat sich dies Geräth, beelt, bedelt,
bedel genannt, mehrfach und in Gebrauch
erhalten, namentlich in den Kirchen zu Stern-
berg, Neuburg und Steffenshagen und zu Bützow.
Jene bestehen aus einem ringsum mit einer
Leiste und hinten mit einem Stiele versehenen
Brette von etwa Fufses Länge, auf welchem
vor dem Stiele ein zweites, der Regel nach
mit dem Bilde des Patrons geziertes Brett
im Winkel angebracht ist, so dafs der sam-
melnde Vorsteher nicht sehen kann, was auf
das Brett gelegt wird. Aehnlich wohl, aber
ungleich reicher gestaltet ist ein Belt der ehe-
maligen Kollegiatkirche in der Stadt Bützow,
über welches seltene Stück eine Mittheilung
am Platze sein dürfte.
Das Sammelbrett, allerdings neu und an-
scheinend erst dem Anfange dieses Jahrhunderts
angehörig, ist hier ein oben offener flacher Kasten
von 32 cm Länge und 19 cm Breite geworden,
dessen hintere, der Handhabe zunächst befindliche
Wand so stark ist, dafs sie 5 bis 6 cm in den
Kasten hineinragt. Auf dieser Wand, und weiter
vorn durch jederseits
einen kleinen Knacken
unterstützt, ist eine von
hinten nach vo-ne ll1^
cm und in der Breite
17 cm messende sil-
berne Platte befestigt,
die mit einer profilirten
Leiste eingefafst ist, auf
welcher beiderseits drei
Röschen als Anheftung
dienen. Auf der Platte,
2 cm vom vorderen
Rande derselben, ist ein
achtseitiges Fufsgestell
ebenfalls von Silber an-
gebracht, dessen Fufs-
leiste auf den Ecken
wiederum mit Röschen
verziert ist, dessen Kan-
ten mit Pfeilerchen be-
setzt sind, und dessen
Seitenflächen darauf
gelöthetes Laubwerk
schmückt. Auf diesem
Postamente ruht ein Boden, auf welchem eine
23 7-2 cm bohe, aus Silber getriebene Figur der
Muttergottes mit dem Christkinde steht, dessen
Haupt ein Lilienkreuz und ein reifenartig be-
handelter Nimbus ziert, während erstere eine
Krone auf dem Haupte trägt und in der Rechten
einen stilisirten Straufs hält. Der Reifen der
Krone ist mit Sternen belegt, der obere Rand
mit Blattreihen besetzt, an denen kleine runde
Scheibchen, mallicn, hangen, und Kreuzbügel,
wie Reifen gewunden, schliefsen die Krone. Ob
das innerhalb derselben am hinteren Bügel be-
festigte silberne Glöckchen ursprünglich oder
erst später hinzugefügt ist, mufs dahingestellt
bleiben. Hinter der Figur sind zwei gewundene
1889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
394
Der Belt der Kirche zu Bützow.
Mit Abbildung:.
n einem Vertrage über die Rechts-
verhältnisse einer im Kirchspiele
Hornstorf bei Wismar zu erbauen-
]i den Kapelle von 1481 wird fest-
gesetzt, dafs dem Pfarrherrn dasjenige zufallen
sollte, was auf den Altar geopfert würde, und
dann weiter bestimmt, dafs alle anderen Obla-
tionen, yd werde vor de bilde ghehangen, in de
blocke gestehen, uppe de wachtschalen edder'
de bedelbrede ghegeven,
von den Vorstehern für
die Kapelle gesammelt
werden sollten; auch
sollte von letzteren am
Tage des heil. Lauren-
tius (des Patrons von
Hornstorf) mit dem
brede nicht kollektirt
werden. Ob dieses Ein-
sammeln von Opfer-
gaben mittelst eines
Brettes allgemein üb-
lich war, ist mir nicht
bekannt, und möchte
ich es aus dem Grunde
fast bezweifeln, da ich
bei Otte-Wernicke
nichts davon finde. Aus
Schleswig-Holstein be-
richtet das vortreffliche
Inventarium der dor-
tigen Bau- und Kunst-
denkmäler einzig von
einer sogen. Almosen-
schaufel in Oldesloe (II. 537), in Meklenburg
aber hat sich dies Geräth, beelt, bedelt,
bedel genannt, mehrfach und in Gebrauch
erhalten, namentlich in den Kirchen zu Stern-
berg, Neuburg und Steffenshagen und zu Bützow.
Jene bestehen aus einem ringsum mit einer
Leiste und hinten mit einem Stiele versehenen
Brette von etwa Fufses Länge, auf welchem
vor dem Stiele ein zweites, der Regel nach
mit dem Bilde des Patrons geziertes Brett
im Winkel angebracht ist, so dafs der sam-
melnde Vorsteher nicht sehen kann, was auf
das Brett gelegt wird. Aehnlich wohl, aber
ungleich reicher gestaltet ist ein Belt der ehe-
maligen Kollegiatkirche in der Stadt Bützow,
über welches seltene Stück eine Mittheilung
am Platze sein dürfte.
Das Sammelbrett, allerdings neu und an-
scheinend erst dem Anfange dieses Jahrhunderts
angehörig, ist hier ein oben offener flacher Kasten
von 32 cm Länge und 19 cm Breite geworden,
dessen hintere, der Handhabe zunächst befindliche
Wand so stark ist, dafs sie 5 bis 6 cm in den
Kasten hineinragt. Auf dieser Wand, und weiter
vorn durch jederseits
einen kleinen Knacken
unterstützt, ist eine von
hinten nach vo-ne ll1^
cm und in der Breite
17 cm messende sil-
berne Platte befestigt,
die mit einer profilirten
Leiste eingefafst ist, auf
welcher beiderseits drei
Röschen als Anheftung
dienen. Auf der Platte,
2 cm vom vorderen
Rande derselben, ist ein
achtseitiges Fufsgestell
ebenfalls von Silber an-
gebracht, dessen Fufs-
leiste auf den Ecken
wiederum mit Röschen
verziert ist, dessen Kan-
ten mit Pfeilerchen be-
setzt sind, und dessen
Seitenflächen darauf
gelöthetes Laubwerk
schmückt. Auf diesem
Postamente ruht ein Boden, auf welchem eine
23 7-2 cm bohe, aus Silber getriebene Figur der
Muttergottes mit dem Christkinde steht, dessen
Haupt ein Lilienkreuz und ein reifenartig be-
handelter Nimbus ziert, während erstere eine
Krone auf dem Haupte trägt und in der Rechten
einen stilisirten Straufs hält. Der Reifen der
Krone ist mit Sternen belegt, der obere Rand
mit Blattreihen besetzt, an denen kleine runde
Scheibchen, mallicn, hangen, und Kreuzbügel,
wie Reifen gewunden, schliefsen die Krone. Ob
das innerhalb derselben am hinteren Bügel be-
festigte silberne Glöckchen ursprünglich oder
erst später hinzugefügt ist, mufs dahingestellt
bleiben. Hinter der Figur sind zwei gewundene