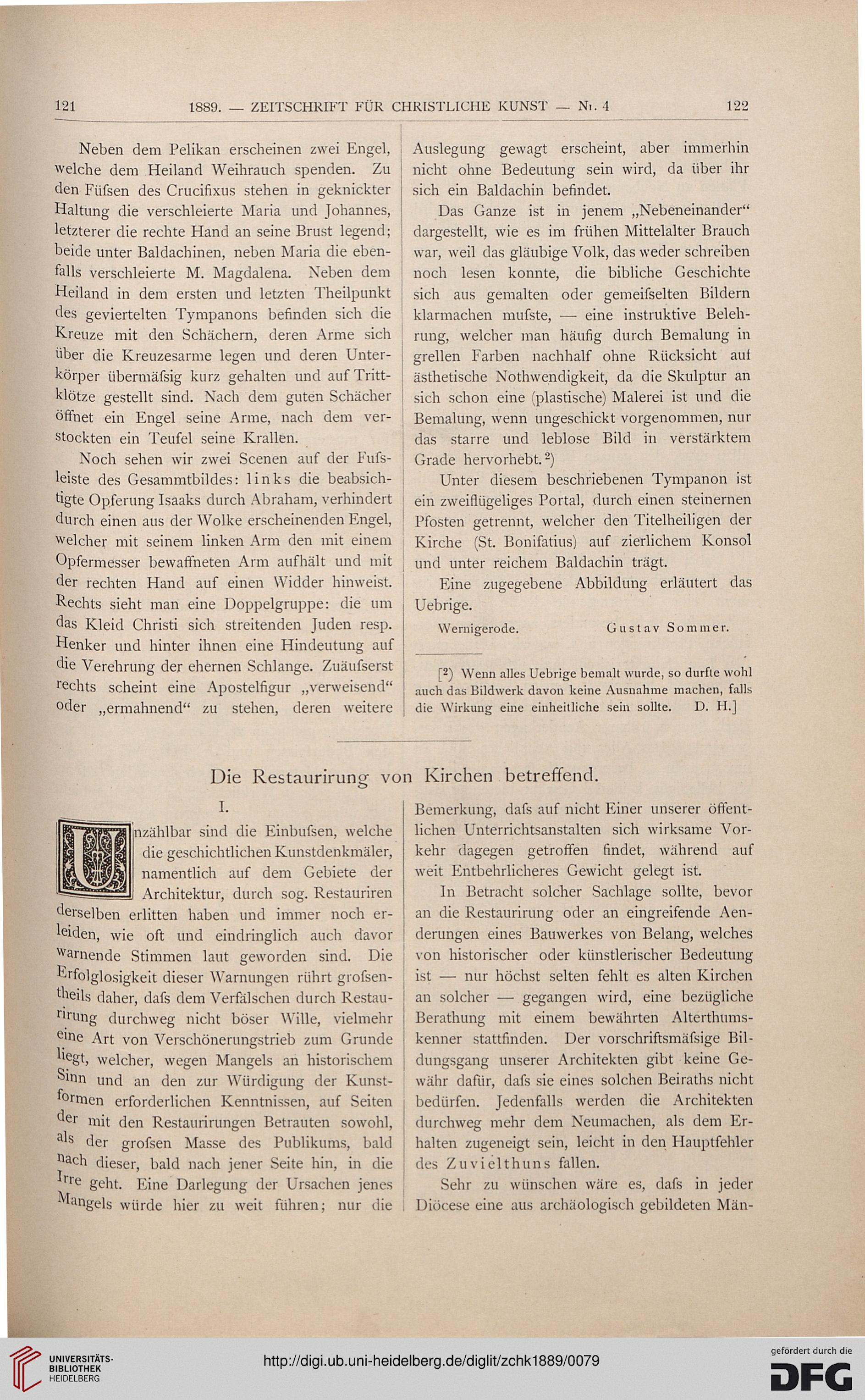121
1889. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Ni. 4
122
Neben dem Pelikan erscheinen zwei Engel,
welche dem Heiland Weihrauch spenden. Zu
den Füfsen des Crucifixus stehen in geknickter
Haltung die verschleierte Maria und Johannes,
letzterer die rechte Hand an seine Brust legend;
beide unter Baldachinen, neben Maria die eben-
falls verschleierte M. Magdalena. Neben dem
Heiland in dem ersten und letzten Theilpunkt
des geviertelten Tympanons befinden sich die
Kreuze mit den Schachern, deren Arme sich
über die Kreuzesarme legen und deren Unter-
körper übermäfsig kurz gehalten und auf Tritt-
klötze gestellt sind. Nach dem guten Schacher
öffnet ein Engel seine Arme, nach dem ver-
stockten ein Teufel seine Krallen.
Noch sehen wir zwei Scenen auf der Fufs-
leiste des Gesammtbildes: links die beabsich-
tigte Opferung Isaaks durch Abraham, verhindert
durch einen aus der Wolke erscheinenden Engel,
welcher mit seinem linken Arm den mit einem
Opfermesser bewaffneten Arm aufhält und mit
der rechten Hand auf einen Widder hinweist.
Rechts sieht man eine Doppelgruppe: die um
das Kleid Christi sich streitenden Juden resp.
Henker und hinter ihnen eine Hindeutung auf
die Verehrung der ehernen Schlange. Zuäufserst
rechts scheint eine Apostelfigur „verweisend"
°der „ermahnend" zu stehen, deren weitere
Auslegung gewagt erscheint, aber immerhin
nicht ohne Bedeutung sein wird, da über ihr
sich ein Baldachin befindet.
Das Ganze ist in jenem „Nebeneinander"
dargestellt, wie es im frühen Mittelalter Brauch
war, weil das gläubige Volk, das weder schreiben
noch lesen konnte, die bibliche Geschichte
sich aus gemalten oder gemeifselten Bildern
klarmachen mufste, — eine instruktive Beleh-
rung, welcher man häufig durch Bemalung in
grellen Farben nachhalf ohne Rücksicht auf
ästhetische Nothwendigkeit, da die Skulptur an
sich schon eine (plastische) Malerei ist und die
Bemalung, wenn ungeschickt vorgenommen, nur
das starre und leblose Bild in verstärktem
Grade hervorhebt.2)
Unter diesem beschriebenen Tympanon ist
ein zweiflügeliges Portal, durch einen steinernen
Pfosten getrennt, welcher den Titelheiligen der
Kirche (St. Bonifatius) auf zierlichem Konsol
und unter reichem Baldachin trägt.
Eine zugegebene Abbildung erläutert das
Uebrige.
Wernigerode.
Gustav Sommer.
[2) Wenn alles Uebrige bemalt wurde, so durfte wohl
auch das Bildwerk davon keine Ausnahme machen, falls
die Wirkung eine einheitliche sein sollte. D. H.]
Die Restaurirung von
I.
nzählbar sind die Einbufsen, welche
die geschichtlichen Kunstdenkmäler,
namentlich auf dem Gebiete der
Architektur, durch sog. Restauriren
derselben erlitten haben und immer noch er-
leiden, wie oft und eindringlich auch davor
Warnende Stimmen laut geworden sind. Die
Erfolglosigkeit dieser Warnungen rührt grofsen-
weils daher, dafs dem Verfälschen durch Restau-
rirung durchweg nicht böser Wille, vielmehr
eme Art von Verschönerungstrieb zum Grunde
legt, welcher, wegen Mangels an historischem
sinn und an den zur Würdigung der Kunst-
0rmen erforderlichen Kenntnissen, auf Seiten
aer mit den Restaurirungen Betrauten sowohl,
als der grofsen Masse des Publikums, bald
nach dieser, bald nach jener Seite hin, in die
rre geht. Eine Darlegung der Ursachen jenes
Mangels würde hier zu weit führen; nur die
Kirchen betreffend.
Bemerkung, dafs auf nicht Einer unserer öffent-
lichen Unterrichtsanstalten sich wirksame Vor-
kehr dagegen getroffen findet, während auf
weit Entbehrlicheres Gewicht gelegt ist.
In Betracht solcher Sachlage sollte, bevor
an die Restaurirung oder an eingreifende Aen-
derungen eines Bauwerkes von Belang, welches
von historischer oder künstlerischer Bedeutung
ist — nur höchst selten fehlt es alten Kirchen
an solcher — gegangen wird, eine bezügliche
Berathung mit einem bewährten Alterthums-
kenner stattfinden. Der vorschriftsmäfsige Bil-
dungsgang unserer Architekten gibt keine Ge-
währ dafür, dafs sie eines solchen Beiraths nicht
bedürfen. Jedenfalls werden die Architekten
durchweg mehr dem Neumachen, als dem Er-
halten zugeneigt sein, leicht in den Hauptfehler
des Zuvielthuns fallen.
Sehr zu wünschen wäre es, dafs in jeder
Diöcese eine aus archäologisch gebildeten Man-
1889. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Ni. 4
122
Neben dem Pelikan erscheinen zwei Engel,
welche dem Heiland Weihrauch spenden. Zu
den Füfsen des Crucifixus stehen in geknickter
Haltung die verschleierte Maria und Johannes,
letzterer die rechte Hand an seine Brust legend;
beide unter Baldachinen, neben Maria die eben-
falls verschleierte M. Magdalena. Neben dem
Heiland in dem ersten und letzten Theilpunkt
des geviertelten Tympanons befinden sich die
Kreuze mit den Schachern, deren Arme sich
über die Kreuzesarme legen und deren Unter-
körper übermäfsig kurz gehalten und auf Tritt-
klötze gestellt sind. Nach dem guten Schacher
öffnet ein Engel seine Arme, nach dem ver-
stockten ein Teufel seine Krallen.
Noch sehen wir zwei Scenen auf der Fufs-
leiste des Gesammtbildes: links die beabsich-
tigte Opferung Isaaks durch Abraham, verhindert
durch einen aus der Wolke erscheinenden Engel,
welcher mit seinem linken Arm den mit einem
Opfermesser bewaffneten Arm aufhält und mit
der rechten Hand auf einen Widder hinweist.
Rechts sieht man eine Doppelgruppe: die um
das Kleid Christi sich streitenden Juden resp.
Henker und hinter ihnen eine Hindeutung auf
die Verehrung der ehernen Schlange. Zuäufserst
rechts scheint eine Apostelfigur „verweisend"
°der „ermahnend" zu stehen, deren weitere
Auslegung gewagt erscheint, aber immerhin
nicht ohne Bedeutung sein wird, da über ihr
sich ein Baldachin befindet.
Das Ganze ist in jenem „Nebeneinander"
dargestellt, wie es im frühen Mittelalter Brauch
war, weil das gläubige Volk, das weder schreiben
noch lesen konnte, die bibliche Geschichte
sich aus gemalten oder gemeifselten Bildern
klarmachen mufste, — eine instruktive Beleh-
rung, welcher man häufig durch Bemalung in
grellen Farben nachhalf ohne Rücksicht auf
ästhetische Nothwendigkeit, da die Skulptur an
sich schon eine (plastische) Malerei ist und die
Bemalung, wenn ungeschickt vorgenommen, nur
das starre und leblose Bild in verstärktem
Grade hervorhebt.2)
Unter diesem beschriebenen Tympanon ist
ein zweiflügeliges Portal, durch einen steinernen
Pfosten getrennt, welcher den Titelheiligen der
Kirche (St. Bonifatius) auf zierlichem Konsol
und unter reichem Baldachin trägt.
Eine zugegebene Abbildung erläutert das
Uebrige.
Wernigerode.
Gustav Sommer.
[2) Wenn alles Uebrige bemalt wurde, so durfte wohl
auch das Bildwerk davon keine Ausnahme machen, falls
die Wirkung eine einheitliche sein sollte. D. H.]
Die Restaurirung von
I.
nzählbar sind die Einbufsen, welche
die geschichtlichen Kunstdenkmäler,
namentlich auf dem Gebiete der
Architektur, durch sog. Restauriren
derselben erlitten haben und immer noch er-
leiden, wie oft und eindringlich auch davor
Warnende Stimmen laut geworden sind. Die
Erfolglosigkeit dieser Warnungen rührt grofsen-
weils daher, dafs dem Verfälschen durch Restau-
rirung durchweg nicht böser Wille, vielmehr
eme Art von Verschönerungstrieb zum Grunde
legt, welcher, wegen Mangels an historischem
sinn und an den zur Würdigung der Kunst-
0rmen erforderlichen Kenntnissen, auf Seiten
aer mit den Restaurirungen Betrauten sowohl,
als der grofsen Masse des Publikums, bald
nach dieser, bald nach jener Seite hin, in die
rre geht. Eine Darlegung der Ursachen jenes
Mangels würde hier zu weit führen; nur die
Kirchen betreffend.
Bemerkung, dafs auf nicht Einer unserer öffent-
lichen Unterrichtsanstalten sich wirksame Vor-
kehr dagegen getroffen findet, während auf
weit Entbehrlicheres Gewicht gelegt ist.
In Betracht solcher Sachlage sollte, bevor
an die Restaurirung oder an eingreifende Aen-
derungen eines Bauwerkes von Belang, welches
von historischer oder künstlerischer Bedeutung
ist — nur höchst selten fehlt es alten Kirchen
an solcher — gegangen wird, eine bezügliche
Berathung mit einem bewährten Alterthums-
kenner stattfinden. Der vorschriftsmäfsige Bil-
dungsgang unserer Architekten gibt keine Ge-
währ dafür, dafs sie eines solchen Beiraths nicht
bedürfen. Jedenfalls werden die Architekten
durchweg mehr dem Neumachen, als dem Er-
halten zugeneigt sein, leicht in den Hauptfehler
des Zuvielthuns fallen.
Sehr zu wünschen wäre es, dafs in jeder
Diöcese eine aus archäologisch gebildeten Man-