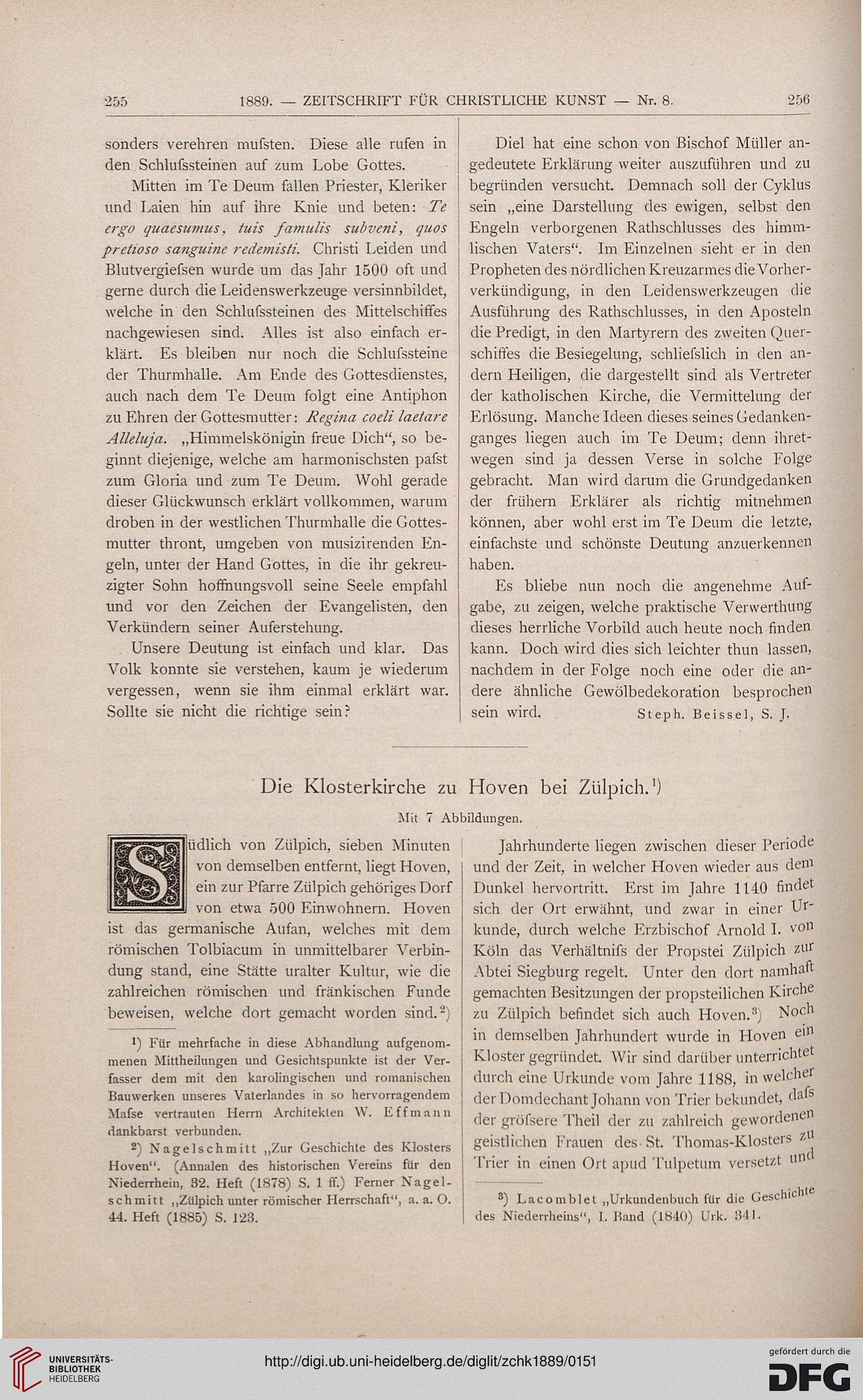1889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
256
sonders verehren mufsten. Diese alle rufen in
den Schlufssteinen auf zum Lobe Gottes.
Mitten im Te Deum fallen Priester, Kleriker
und Laien hin auf ihre Knie und beten: Te
ergo quaesumus, tuis fatnulis subveni, quos
pretioso sanguine redemisti. Christi Leiden und
Blutvergiefsen wurde um das Jahr 1500 oft und
gerne durch die Leidenswerkzeuge versinnbildet,
welche in den Schlufssteinen des Mittelschiffes
nachgewiesen sind. Alles ist also einfach er-
klärt. Es bleiben nur noch die Schlufssteine
der Thurmhalle. Am Ende des Gottesdienstes,
auch nach dem Te Deum folgt eine Antiphon
zu Ehren der Gottesmutter: Regina coeli laetare
Alleluja. „Himmelskönigin freue Dich", so be-
ginnt diejenige, welche am harmonischsten pafst
zum Gloria und zum Te Deum. Wohl gerade
dieser Glückwunsch erklärt vollkommen, warum
droben in der westlichen Thurmhalle die Gottes-
mutter thront, umgeben von musizirenden En-
geln, unter der Hand Gottes, in die ihr gekreu-
zigter Sohn hoffnungsvoll seine Seele empfahl
und vor den Zeichen der Evangelisten, den
Verkündern seiner Auferstehung.
Unsere Deutung ist einfach und klar. Das
Volk konnte sie verstehen, kaum je wiederum
vergessen, wenn sie ihm einmal erklärt war.
Sollte sie nicht die richtige sein?
Diel hat eine schon von Bischof Müller an-
gedeutete Erklärung weiter auszuführen und zu
begründen versucht. Demnach soll der Cyklus
sein „eine Darstellung des ewigen, selbst den
Engeln verborgenen Rathschlusses des himm-
lischen Vaters". Im Einzelnen sieht er in den
Propheten des nördlichen Kreuzarmes die Vorher-
verkündigung, in den Leidenswerkzeugen die
Ausführung des Rathschlusses, in den Aposteln
die Predigt, in den Märtyrern des zweiten Quer-
schiffes die Besiegelung, schliefslich in den an-
dern Heiligen, die dargestellt sind als Vertreter
der katholischen Kirche, die Vermittelung der
Erlösung. Manche Ideen dieses seines Gedanken-
ganges liegen auch im Te Deum; denn ihret-
wegen sind ja dessen Verse in solche Folge
gebracht. Man wird darum die Grundgedanken
der frühem Erklärer als richtig mitnehmen
können, aber wohl erst im Te Deum die letzte,
einfachste und schönste Deutung anzuerkennen
haben.
Es bliebe nun noch die angenehme Auf-
gabe, zu zeigen, welche praktische Verwerthung
dieses herrliche Vorbild auch heute noch finden
kann. Doch wird dies sich leichter thun lassen,
nachdem in der Folge noch eine oder die an-
dere ähnliche Gewölbedekoration besprochen
sein wird. Steph. Beisse], S. J.
Die Klosterkirche zu Hoven bei Zülpich.
Mit 7 Abbildungen.
üdlich von Zülpich, sieben Minuten
von demselben entfernt, liegt Hoven,
ein zur Pfarre Zülpich gehöriges Dorf
von etwa 500 Einwohnern. Hoven
ist das germanische Aufan, welches mit dem
römischen Tolbiacum in unmittelbarer Verbin-
dung stand, eine Stätte uralter Kultur, wie die
zahlreichen römischen und fränkischen Funde
beweisen, welche dort gemacht worden sind.2)
') F'ür mehrfache in diese Abhandlung aufgenom-
menen Mittheilungen und Gesichtspunkte ist der Ver-
fasser dem mit den karolingischen und romanischen
Bauwerken unseres Vaterlandes in so hervorragendem
Mafse vertrauten Herrn Architekten W. Effmann
dankbarst verbunden.
2) Nagelschmitt „Zur Geschichte des Klosters
Hoven". (Annalen des historischen Vereins für den
Niederrhein, 32. Heft (1878) S. 1 ff.) Ferner Nagel-
schmitt „Zülpich unter römischer Herrschaft", a.a.O.
44. Heft (1885) S. 123.
Jahrhunderte liegen zwischen dieser Periode
und der Zeit, in welcher Hoven wieder aus dem
Dunkel hervortritt. Erst im Jahre 1140 findet
sich der Ort erwähnt, und zwar in einer Ur-
kunde, durch welche Erzbischof Arnold 1. von
Köln das Verhältnifs der Propstei Zülpich zur
Abtei Siegburg regelt. Unter den dort namhaft
gemachten Besitzungen der propsteilichen Kirche
zu Zülpich befindet sich auch Hoven.'1) Noch
in demselben Jahrhundert wurde in Hoven ein
Kloster gegründet. Wir sind darüber unterrichtet
durch eine Urkunde vom Jahre 1188, in welcher
der Domdechant Johann von Trier bekundet, dais
der gröfsere Theil der zu zahlreich gewordene"
geistlichen Frauen des St. Thomas-Klosters zu
frier in einen Ort apud Tulpetum versetzt un
8) Lacomblet „Urkundenbuch für die Geschic
des Niederrheins", I. Band (1840) Urk. 841.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.
256
sonders verehren mufsten. Diese alle rufen in
den Schlufssteinen auf zum Lobe Gottes.
Mitten im Te Deum fallen Priester, Kleriker
und Laien hin auf ihre Knie und beten: Te
ergo quaesumus, tuis fatnulis subveni, quos
pretioso sanguine redemisti. Christi Leiden und
Blutvergiefsen wurde um das Jahr 1500 oft und
gerne durch die Leidenswerkzeuge versinnbildet,
welche in den Schlufssteinen des Mittelschiffes
nachgewiesen sind. Alles ist also einfach er-
klärt. Es bleiben nur noch die Schlufssteine
der Thurmhalle. Am Ende des Gottesdienstes,
auch nach dem Te Deum folgt eine Antiphon
zu Ehren der Gottesmutter: Regina coeli laetare
Alleluja. „Himmelskönigin freue Dich", so be-
ginnt diejenige, welche am harmonischsten pafst
zum Gloria und zum Te Deum. Wohl gerade
dieser Glückwunsch erklärt vollkommen, warum
droben in der westlichen Thurmhalle die Gottes-
mutter thront, umgeben von musizirenden En-
geln, unter der Hand Gottes, in die ihr gekreu-
zigter Sohn hoffnungsvoll seine Seele empfahl
und vor den Zeichen der Evangelisten, den
Verkündern seiner Auferstehung.
Unsere Deutung ist einfach und klar. Das
Volk konnte sie verstehen, kaum je wiederum
vergessen, wenn sie ihm einmal erklärt war.
Sollte sie nicht die richtige sein?
Diel hat eine schon von Bischof Müller an-
gedeutete Erklärung weiter auszuführen und zu
begründen versucht. Demnach soll der Cyklus
sein „eine Darstellung des ewigen, selbst den
Engeln verborgenen Rathschlusses des himm-
lischen Vaters". Im Einzelnen sieht er in den
Propheten des nördlichen Kreuzarmes die Vorher-
verkündigung, in den Leidenswerkzeugen die
Ausführung des Rathschlusses, in den Aposteln
die Predigt, in den Märtyrern des zweiten Quer-
schiffes die Besiegelung, schliefslich in den an-
dern Heiligen, die dargestellt sind als Vertreter
der katholischen Kirche, die Vermittelung der
Erlösung. Manche Ideen dieses seines Gedanken-
ganges liegen auch im Te Deum; denn ihret-
wegen sind ja dessen Verse in solche Folge
gebracht. Man wird darum die Grundgedanken
der frühem Erklärer als richtig mitnehmen
können, aber wohl erst im Te Deum die letzte,
einfachste und schönste Deutung anzuerkennen
haben.
Es bliebe nun noch die angenehme Auf-
gabe, zu zeigen, welche praktische Verwerthung
dieses herrliche Vorbild auch heute noch finden
kann. Doch wird dies sich leichter thun lassen,
nachdem in der Folge noch eine oder die an-
dere ähnliche Gewölbedekoration besprochen
sein wird. Steph. Beisse], S. J.
Die Klosterkirche zu Hoven bei Zülpich.
Mit 7 Abbildungen.
üdlich von Zülpich, sieben Minuten
von demselben entfernt, liegt Hoven,
ein zur Pfarre Zülpich gehöriges Dorf
von etwa 500 Einwohnern. Hoven
ist das germanische Aufan, welches mit dem
römischen Tolbiacum in unmittelbarer Verbin-
dung stand, eine Stätte uralter Kultur, wie die
zahlreichen römischen und fränkischen Funde
beweisen, welche dort gemacht worden sind.2)
') F'ür mehrfache in diese Abhandlung aufgenom-
menen Mittheilungen und Gesichtspunkte ist der Ver-
fasser dem mit den karolingischen und romanischen
Bauwerken unseres Vaterlandes in so hervorragendem
Mafse vertrauten Herrn Architekten W. Effmann
dankbarst verbunden.
2) Nagelschmitt „Zur Geschichte des Klosters
Hoven". (Annalen des historischen Vereins für den
Niederrhein, 32. Heft (1878) S. 1 ff.) Ferner Nagel-
schmitt „Zülpich unter römischer Herrschaft", a.a.O.
44. Heft (1885) S. 123.
Jahrhunderte liegen zwischen dieser Periode
und der Zeit, in welcher Hoven wieder aus dem
Dunkel hervortritt. Erst im Jahre 1140 findet
sich der Ort erwähnt, und zwar in einer Ur-
kunde, durch welche Erzbischof Arnold 1. von
Köln das Verhältnifs der Propstei Zülpich zur
Abtei Siegburg regelt. Unter den dort namhaft
gemachten Besitzungen der propsteilichen Kirche
zu Zülpich befindet sich auch Hoven.'1) Noch
in demselben Jahrhundert wurde in Hoven ein
Kloster gegründet. Wir sind darüber unterrichtet
durch eine Urkunde vom Jahre 1188, in welcher
der Domdechant Johann von Trier bekundet, dais
der gröfsere Theil der zu zahlreich gewordene"
geistlichen Frauen des St. Thomas-Klosters zu
frier in einen Ort apud Tulpetum versetzt un
8) Lacomblet „Urkundenbuch für die Geschic
des Niederrheins", I. Band (1840) Urk. 841.