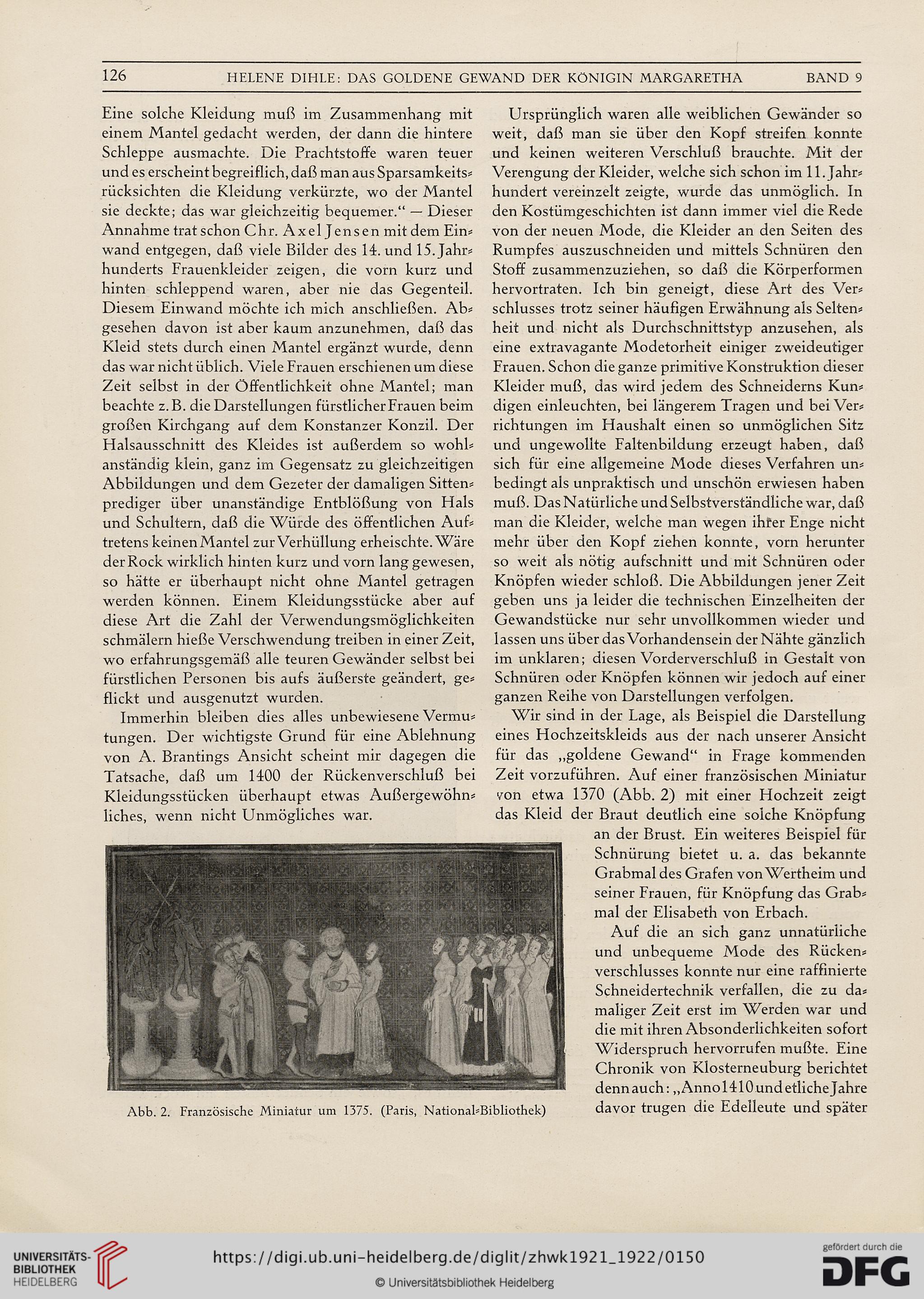126
HELENE DIHLE: DAS GOLDENE GEWAND DER KÖNIGIN MARGARETHA
BAND 9
Eine solche Kleidung muß im Zusammenhang mit
einem Mantel gedacht werden, der dann die hintere
Schleppe ausmachte. Die Prachtstoffe waren teuer
und es erscheint begreiflich, daß man aus Sparsamkeits*
rücksichten die Kleidung verkürzte, wo der Mantel
sie deckte; das war gleichzeitig bequemer.“ — Dieser
Annahme trat schon Chr. Axeljensen mit dem Ein*
wand entgegen, daß viele Bilder des 14. und 15. Jahr*
hunderts Frauenkleider zeigen, die vorn kurz und
hinten schleppend waren, aber nie das Gegenteil.
Diesem Einwand möchte ich mich anschließen. Ab*
gesehen davon ist aber kaum anzunehmen, daß das
Kleid stets durch einen Mantel ergänzt wurde, denn
das war nicht üblich. Viele Frauen erschienen um diese
Zeit selbst in der Öffentlichkeit ohne Mantel; man
beachte z. B. die Darstellungen fürstlicher Frauen beim
großen Kirchgang auf dem Konstanzer Konzil. Der
Halsausschnitt des Kleides ist außerdem so wohl*
anständig klein, ganz im Gegensatz zu gleichzeitigen
Abbildungen und dem Gezeter der damaligen Sitten*
prediger über unanständige Entblößung von Hals
und Schultern, daß die Würde des öffentlichen Auf*
tretens keinen Mantel zur Verhüllung erheischte. Wäre
der Rock wirklich hinten kurz und vorn lang gewesen,
so hätte er überhaupt nicht ohne Mantel getragen
werden können. Einem Kleidungsstücke aber auf
diese Art die Zahl der Verwendungsmöglichkeiten
schmälern hieße Verschwendung treiben in einer Zeit,
wo erfahrungsgemäß alle teuren Gewänder selbst bei
fürstlichen Personen bis aufs äußerste geändert, ge*
flickt und ausgenutzt wurden.
Immerhin bleiben dies alles unbewiesene Vermu*
tungen. Der wichtigste Grund für eine Ablehnung
von A. Brantings Ansicht scheint mir dagegen die
Tatsache, daß um 1400 der Rückenverschluß bei
Kleidungsstücken überhaupt etwas Außergewöhn*
liches, wenn nicht Unmögliches war.
Ursprünglich waren alle weiblichen Gewänder so
weit, daß man sie über den Kopf streifen konnte
und keinen weiteren Verschluß brauchte. Mit der
Verengung der Kleider, welche sich schon im 11. Jahr*
hundert vereinzelt zeigte, wurde das unmöglich. In
den Kostümgeschichten ist dann immer viel die Rede
von der neuen Mode, die Kleider an den Seiten des
Rumpfes auszuschneiden und mittels Schnüren den
Stoff zusammenzuziehen, so daß die Körperformen
hervortraten. Ich bin geneigt, diese Art des Ver*
Schlusses trotz seiner häufigen Erwähnung als Selten*
heit und nicht als Durchschnittstyp anzusehen, als
eine extravagante Modetorheit einiger zweideutiger
Frauen. Schon die ganze primitive Konstruktion dieser
Kleider muß, das wird jedem des Schneiderns Kun*
digen einleuchten, bei längerem Tragen und bei Ver*
richtungen im Haushalt einen so unmöglichen Sitz
und ungewollte Faltenbildung erzeugt haben, daß
sich für eine allgemeine Mode dieses Verfahren un*
bedingt als unpraktisch und unschön erwiesen haben
muß. Das Natürliche und Selbstverständliche war, daß
man die Kleider, welche man wegen ihrer Enge nicht
mehr über den Kopf ziehen konnte, vorn herunter
so weit als nötig aufschnitt und mit Schnüren oder
Knöpfen wieder schloß. Die Abbildungen jener Zeit
geben uns ja leider die technischen Einzelheiten der
Gewandstücke nur sehr unvollkommen wieder und
lassen uns überdasVorhandensein der Nähte gänzlich
im unklaren; diesen Vorderverschluß in Gestalt von
Schnüren oder Knöpfen können wir jedoch auf einer
ganzen Reihe von Darstellungen verfolgen.
Wir sind in der Lage, als Beispiel die Darstellung
eines Hochzeitskleids aus der nach unserer Ansicht
für das „goldene Gewand“ in Frage kommenden
Zeit vorzuführen. Auf einer französischen Miniatur
von etwa 1370 (Abb. 2) mit einer Hochzeit zeigt
das Kleid der Braut deutlich eine solche Knopfung
an der Brust. Ein weiteres Beispiel für
Schnürung bietet u. a. das bekannte
Grabmal des Grafen von Wertheim und
seiner Frauen, für Knopfung das Grab*
mal der Elisabeth von Erbach.
Auf die an sich ganz unnatürliche
und unbequeme Mode des Rücken*
Verschlusses konnte nur eine raffinierte
Schneidertechnik verfallen, die zu da*
maliger Zeit erst im Werden war und
die mit ihren Absonderlichkeiten sofort
Widerspruch hervorrufen mußte. Eine
Chronik von Klosterneuburg berichtet
denn auch: „Anno 1410 und etliche Jahre
davor trugen die Edeileute und später
Abb. 2. Französische Miniatur um 1375. (Paris, NationabBibliothek)
HELENE DIHLE: DAS GOLDENE GEWAND DER KÖNIGIN MARGARETHA
BAND 9
Eine solche Kleidung muß im Zusammenhang mit
einem Mantel gedacht werden, der dann die hintere
Schleppe ausmachte. Die Prachtstoffe waren teuer
und es erscheint begreiflich, daß man aus Sparsamkeits*
rücksichten die Kleidung verkürzte, wo der Mantel
sie deckte; das war gleichzeitig bequemer.“ — Dieser
Annahme trat schon Chr. Axeljensen mit dem Ein*
wand entgegen, daß viele Bilder des 14. und 15. Jahr*
hunderts Frauenkleider zeigen, die vorn kurz und
hinten schleppend waren, aber nie das Gegenteil.
Diesem Einwand möchte ich mich anschließen. Ab*
gesehen davon ist aber kaum anzunehmen, daß das
Kleid stets durch einen Mantel ergänzt wurde, denn
das war nicht üblich. Viele Frauen erschienen um diese
Zeit selbst in der Öffentlichkeit ohne Mantel; man
beachte z. B. die Darstellungen fürstlicher Frauen beim
großen Kirchgang auf dem Konstanzer Konzil. Der
Halsausschnitt des Kleides ist außerdem so wohl*
anständig klein, ganz im Gegensatz zu gleichzeitigen
Abbildungen und dem Gezeter der damaligen Sitten*
prediger über unanständige Entblößung von Hals
und Schultern, daß die Würde des öffentlichen Auf*
tretens keinen Mantel zur Verhüllung erheischte. Wäre
der Rock wirklich hinten kurz und vorn lang gewesen,
so hätte er überhaupt nicht ohne Mantel getragen
werden können. Einem Kleidungsstücke aber auf
diese Art die Zahl der Verwendungsmöglichkeiten
schmälern hieße Verschwendung treiben in einer Zeit,
wo erfahrungsgemäß alle teuren Gewänder selbst bei
fürstlichen Personen bis aufs äußerste geändert, ge*
flickt und ausgenutzt wurden.
Immerhin bleiben dies alles unbewiesene Vermu*
tungen. Der wichtigste Grund für eine Ablehnung
von A. Brantings Ansicht scheint mir dagegen die
Tatsache, daß um 1400 der Rückenverschluß bei
Kleidungsstücken überhaupt etwas Außergewöhn*
liches, wenn nicht Unmögliches war.
Ursprünglich waren alle weiblichen Gewänder so
weit, daß man sie über den Kopf streifen konnte
und keinen weiteren Verschluß brauchte. Mit der
Verengung der Kleider, welche sich schon im 11. Jahr*
hundert vereinzelt zeigte, wurde das unmöglich. In
den Kostümgeschichten ist dann immer viel die Rede
von der neuen Mode, die Kleider an den Seiten des
Rumpfes auszuschneiden und mittels Schnüren den
Stoff zusammenzuziehen, so daß die Körperformen
hervortraten. Ich bin geneigt, diese Art des Ver*
Schlusses trotz seiner häufigen Erwähnung als Selten*
heit und nicht als Durchschnittstyp anzusehen, als
eine extravagante Modetorheit einiger zweideutiger
Frauen. Schon die ganze primitive Konstruktion dieser
Kleider muß, das wird jedem des Schneiderns Kun*
digen einleuchten, bei längerem Tragen und bei Ver*
richtungen im Haushalt einen so unmöglichen Sitz
und ungewollte Faltenbildung erzeugt haben, daß
sich für eine allgemeine Mode dieses Verfahren un*
bedingt als unpraktisch und unschön erwiesen haben
muß. Das Natürliche und Selbstverständliche war, daß
man die Kleider, welche man wegen ihrer Enge nicht
mehr über den Kopf ziehen konnte, vorn herunter
so weit als nötig aufschnitt und mit Schnüren oder
Knöpfen wieder schloß. Die Abbildungen jener Zeit
geben uns ja leider die technischen Einzelheiten der
Gewandstücke nur sehr unvollkommen wieder und
lassen uns überdasVorhandensein der Nähte gänzlich
im unklaren; diesen Vorderverschluß in Gestalt von
Schnüren oder Knöpfen können wir jedoch auf einer
ganzen Reihe von Darstellungen verfolgen.
Wir sind in der Lage, als Beispiel die Darstellung
eines Hochzeitskleids aus der nach unserer Ansicht
für das „goldene Gewand“ in Frage kommenden
Zeit vorzuführen. Auf einer französischen Miniatur
von etwa 1370 (Abb. 2) mit einer Hochzeit zeigt
das Kleid der Braut deutlich eine solche Knopfung
an der Brust. Ein weiteres Beispiel für
Schnürung bietet u. a. das bekannte
Grabmal des Grafen von Wertheim und
seiner Frauen, für Knopfung das Grab*
mal der Elisabeth von Erbach.
Auf die an sich ganz unnatürliche
und unbequeme Mode des Rücken*
Verschlusses konnte nur eine raffinierte
Schneidertechnik verfallen, die zu da*
maliger Zeit erst im Werden war und
die mit ihren Absonderlichkeiten sofort
Widerspruch hervorrufen mußte. Eine
Chronik von Klosterneuburg berichtet
denn auch: „Anno 1410 und etliche Jahre
davor trugen die Edeileute und später
Abb. 2. Französische Miniatur um 1375. (Paris, NationabBibliothek)