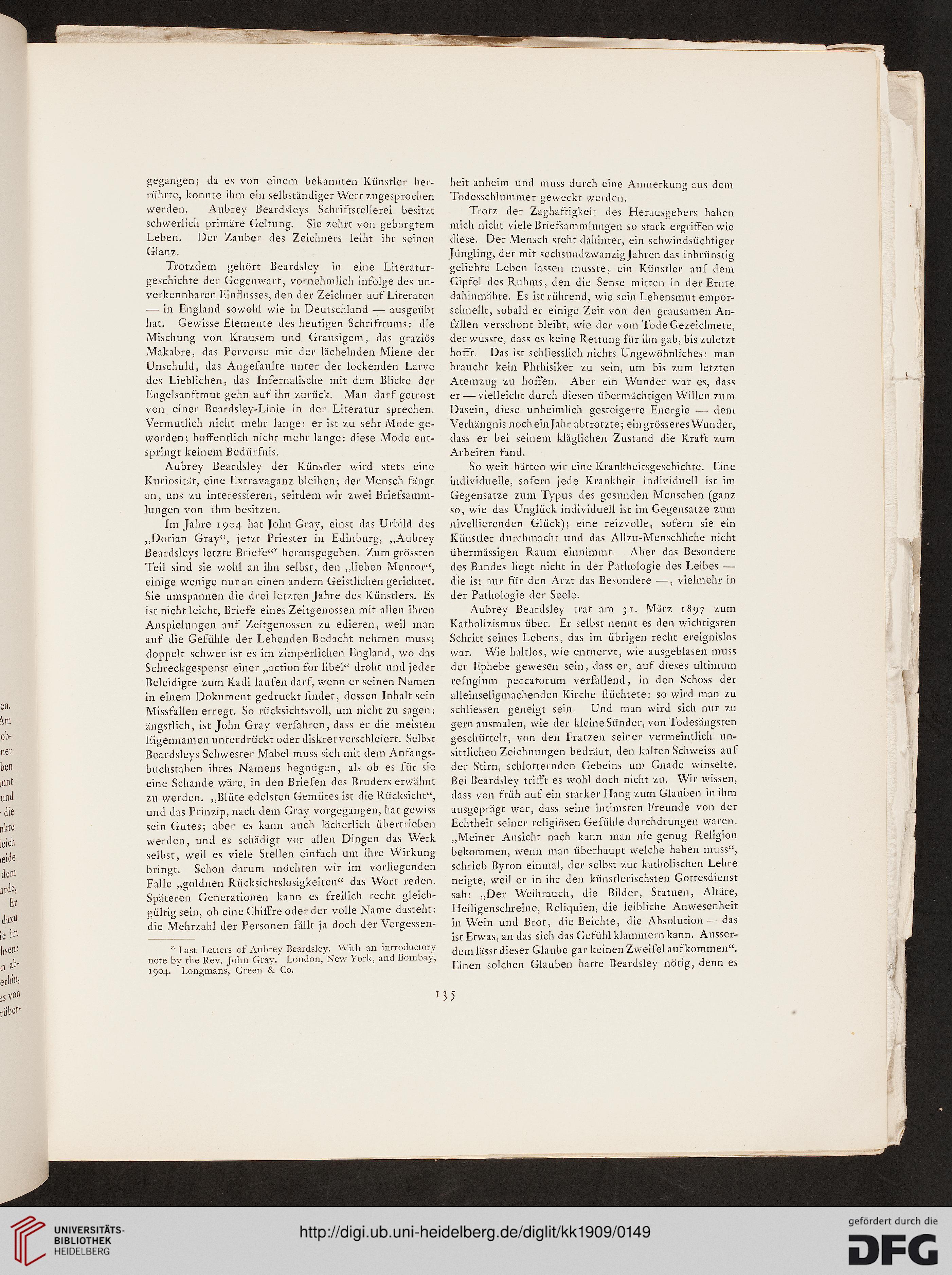gegangen; da es von einem bekannten Künstler her-
rührte, konnte ihm ein selbständiger Wert zugesprochen
werden. Aubrey Beardsleys Schriftstellerei besitzt
schwerlich primäre Geltung. Sie zehrt von geborgtem
Leben. Der Zauber des Zeichners leiht ihr seinen
Glanz.
Trotzdem gehört Beardsley in eine Literatur-
geschichte der Gegenwart, vornehmlich infolge des un-
verkennbaren Einflusses, den der Zeichner auf Literaten
— in England sowohl wie in Deutschland — ausgeübt
hat. Gewisse Elemente des heutigen Schrifttums: die
Mischung von Krausem und Grausigem, das graziös
Makabre, das Perverse mit der lächelnden Miene der
Unschuld, das Angefaulte unter der lockenden Larve
des Lieblichen, das Infernalische mit dem Blicke der
Engelsanftmut gehn auf ihn zurück. Man darf getrost
von einer Beardsley-Linie in der Literatur sprechen.
Vermutlich nicht mehr lange: er ist zu sehr Mode ge-
worden; hoffentlich nicht mehr lange: diese Mode ent-
springt keinem Bedürfnis.
Aubrey Beardsley der Künstler wird stets eine
Kuriosität, eine Extravaganz bleiben; der Mensch fängt
an, uns zu interessieren, seitdem wir zwei Briefsamm-
lungen von ihm besitzen.
Im Jahre 1904 hat John Gray, einst das Urbild des
„Dorian Gray", jetzt Priester in Edinburg, „Aubrey
Beardsleys letzte Briefe"* herausgegeben. Zum grössten
Teil sind sie wohl an ihn selbst, den „lieben Mentor",
einige wenige nur an einen andern Geistlichen gerichtet.
Sie umspannen die drei letzten Jahre des Künstlers. Es
ist nicht leicht, Briefe eines Zeitgenossen mit allen ihren
Anspielungen auf Zeitgenossen zu edieren, weil man
auf die Gefühle der Lebenden Bedacht nehmen muss;
doppelt schwer ist es im zimperlichen England, wo das
Schreckgespenst einer „action for libel" droht und jeder
Beleidigte zum Kadi laufen darf, wenn er seinen Namen
in einem Dokument gedruckt findet, dessen Inhalt sein
Missfallen erregt. So rücksichtsvoll, um nicht zu sagen:
ängstlich, ist John Gray verfahren, dass er die meisten
Eigennamen unterdrückt oder diskret verschleiert. Selbst
Beardsleys Schwester Mabel muss sich mit dem Anfangs-
buchstaben ihres Namens begnügen, als ob es für sie
eine Schande wäre, in den Briefen des Bruders erwähnt
zu werden. ,,Blüte edelsten Gemütes ist die Rücksicht",
und das Prinzip, nach dem Gray vorgegangen, hat gewiss
sein Gutes; aber es kann auch lächerlich übertrieben
werden, und es schädigt vor allen Dingen das Werk
selbst, weil es viele Stellen einfach um ihre Wirkung
bringt. Schon darum möchten wir im vorliegenden
Falle „goldnen Rücksichtslosigkeiten" das Wort reden.
Späteren Generationen kann es freilich recht gleich-
gültig sein, ob eine Chiffre oder der volle Name dasteht:
die Mehrzahl der Personen fällt ja doch der Vergessen-
* Last Letters of Aubrey Beardsley. With an introductory
note by the Rev. John Gray. London, New York, and Bombay,
1904. Longmans, Green & Co.
heit anheim und muss durch eine Anmerkung aus dem
Todesschlummer geweckt werden.
Trotz der Zaghaftigkeit des Herausgebers haben
mich nicht viele Briefsammlungen so stark ergriffen wie
diese. Der Mensch steht dahinter, ein schwindsüchtiger
Jüngling, der mit sechsundzwanzig Jahren das inbrünstig
geliebte Leben lassen musste, ein Künstler auf dem
Gipfel des Ruhms, den die Sense mitten in der Ernte
dahinmähte. Es ist rührend, wie sein Lebensmut empor-
schnellt, sobald er einige Zeit von den grausamen An-
fällen verschont bleibt, wie der vom Tode Gezeichnete,
der wusste, dass es keine Rettung für ihn gab, bis zuletzt
hofft. Das ist schliesslich nichts Ungewöhnliches: man
braucht kein Phthisiker zu sein, um bis zum letzten
Atemzug zu hoffen. Aber ein Wunder war es, dass
er — vielleicht durch diesen übermächtigen Willen zum
Dasein, diese unheimlich gesteigerte Energie — dem
Verhängnis noch ein Jahr abtrotzte; eingrösseres Wunder,
dass er bei seinem kläglichen Zustand die Kraft zum
Atbeiten fand.
So weit hätten wir eine Krankheitsgeschichte. Eine
individuelle, sofern jede Krankheit individuell ist im
Gegensatze zum Typus des gesunden Menschen (ganz
so, wie das Unglück individuell ist im Gegensatze zum
nivellierenden Glück); eine reizvolle, sofern sie ein
Künstler durchmacht und das Allzu-Menschliche nicht
übermässigen Raum einnimmt. Aber das Besondere
des Bandes liegt nicht in der Pathologie des Leibes —
die ist nur für den Arzt das Besondere —, vielmehr in
der Pathologie der Seele.
Aubrey Beardsley trat am 31. März 1897 zum
Katholizismus über. Er selbst nennt es den wichtigsten
Schritt seines Lebens, das im übrigen recht ereignislos
war. Wie haltlos, wie entnervt, wie ausgeblasen muss
der Ephebe gewesen sein, dass er, auf dieses ultimum
refugium peccatorum verfallend, in den Schoss der
alleinseligmachenden Kirche flüchtete: so wird man zu
schliessen geneigt sein. Und man wird sich nur zu
gern ausmalen, wie der kleine Sünder, von Todesängsten
geschüttelt, von den Fratzen seiner vermeintlich un-
sittlichen Zeichnungen bedräut, den kalten Schweiss auf
der Stirn, schlotternden Gebeins um Gnade winselte.
Bei Beardsley trifft es wohl doch nicht zu. Wir wissen,
dass von früh auf ein starker Hang zum Glauben in ihm
ausgeprägt war, dass seine intimsten Freunde von der
Echtheit seiner religiösen Gefühle durchdrungen waren.
„Meiner Ansicht nach kann man nie genug Religion
bekommen, wenn man überhaupt welche haben muss",
schrieb Byron einmal, der selbst zur katholischen Lehre
neigte, weil er in ihr den künstlerischsten Gottesdienst
sah: „Der Weihrauch, die Bilder, Statuen, Altäre,
Heiligenschreine, Reliquien, die leibliche Anwesenheit
in Wein und Brot, die Beichte, die Absolution — das
ist Etwas, an das sich das Gefühl klammern kann. Ausser-
dem lässt dieser Glaube gar keinen Zweifel aufkommen".
Einen solchen Glauben hatte Beardsley nötig, denn es
J
13 5
rührte, konnte ihm ein selbständiger Wert zugesprochen
werden. Aubrey Beardsleys Schriftstellerei besitzt
schwerlich primäre Geltung. Sie zehrt von geborgtem
Leben. Der Zauber des Zeichners leiht ihr seinen
Glanz.
Trotzdem gehört Beardsley in eine Literatur-
geschichte der Gegenwart, vornehmlich infolge des un-
verkennbaren Einflusses, den der Zeichner auf Literaten
— in England sowohl wie in Deutschland — ausgeübt
hat. Gewisse Elemente des heutigen Schrifttums: die
Mischung von Krausem und Grausigem, das graziös
Makabre, das Perverse mit der lächelnden Miene der
Unschuld, das Angefaulte unter der lockenden Larve
des Lieblichen, das Infernalische mit dem Blicke der
Engelsanftmut gehn auf ihn zurück. Man darf getrost
von einer Beardsley-Linie in der Literatur sprechen.
Vermutlich nicht mehr lange: er ist zu sehr Mode ge-
worden; hoffentlich nicht mehr lange: diese Mode ent-
springt keinem Bedürfnis.
Aubrey Beardsley der Künstler wird stets eine
Kuriosität, eine Extravaganz bleiben; der Mensch fängt
an, uns zu interessieren, seitdem wir zwei Briefsamm-
lungen von ihm besitzen.
Im Jahre 1904 hat John Gray, einst das Urbild des
„Dorian Gray", jetzt Priester in Edinburg, „Aubrey
Beardsleys letzte Briefe"* herausgegeben. Zum grössten
Teil sind sie wohl an ihn selbst, den „lieben Mentor",
einige wenige nur an einen andern Geistlichen gerichtet.
Sie umspannen die drei letzten Jahre des Künstlers. Es
ist nicht leicht, Briefe eines Zeitgenossen mit allen ihren
Anspielungen auf Zeitgenossen zu edieren, weil man
auf die Gefühle der Lebenden Bedacht nehmen muss;
doppelt schwer ist es im zimperlichen England, wo das
Schreckgespenst einer „action for libel" droht und jeder
Beleidigte zum Kadi laufen darf, wenn er seinen Namen
in einem Dokument gedruckt findet, dessen Inhalt sein
Missfallen erregt. So rücksichtsvoll, um nicht zu sagen:
ängstlich, ist John Gray verfahren, dass er die meisten
Eigennamen unterdrückt oder diskret verschleiert. Selbst
Beardsleys Schwester Mabel muss sich mit dem Anfangs-
buchstaben ihres Namens begnügen, als ob es für sie
eine Schande wäre, in den Briefen des Bruders erwähnt
zu werden. ,,Blüte edelsten Gemütes ist die Rücksicht",
und das Prinzip, nach dem Gray vorgegangen, hat gewiss
sein Gutes; aber es kann auch lächerlich übertrieben
werden, und es schädigt vor allen Dingen das Werk
selbst, weil es viele Stellen einfach um ihre Wirkung
bringt. Schon darum möchten wir im vorliegenden
Falle „goldnen Rücksichtslosigkeiten" das Wort reden.
Späteren Generationen kann es freilich recht gleich-
gültig sein, ob eine Chiffre oder der volle Name dasteht:
die Mehrzahl der Personen fällt ja doch der Vergessen-
* Last Letters of Aubrey Beardsley. With an introductory
note by the Rev. John Gray. London, New York, and Bombay,
1904. Longmans, Green & Co.
heit anheim und muss durch eine Anmerkung aus dem
Todesschlummer geweckt werden.
Trotz der Zaghaftigkeit des Herausgebers haben
mich nicht viele Briefsammlungen so stark ergriffen wie
diese. Der Mensch steht dahinter, ein schwindsüchtiger
Jüngling, der mit sechsundzwanzig Jahren das inbrünstig
geliebte Leben lassen musste, ein Künstler auf dem
Gipfel des Ruhms, den die Sense mitten in der Ernte
dahinmähte. Es ist rührend, wie sein Lebensmut empor-
schnellt, sobald er einige Zeit von den grausamen An-
fällen verschont bleibt, wie der vom Tode Gezeichnete,
der wusste, dass es keine Rettung für ihn gab, bis zuletzt
hofft. Das ist schliesslich nichts Ungewöhnliches: man
braucht kein Phthisiker zu sein, um bis zum letzten
Atemzug zu hoffen. Aber ein Wunder war es, dass
er — vielleicht durch diesen übermächtigen Willen zum
Dasein, diese unheimlich gesteigerte Energie — dem
Verhängnis noch ein Jahr abtrotzte; eingrösseres Wunder,
dass er bei seinem kläglichen Zustand die Kraft zum
Atbeiten fand.
So weit hätten wir eine Krankheitsgeschichte. Eine
individuelle, sofern jede Krankheit individuell ist im
Gegensatze zum Typus des gesunden Menschen (ganz
so, wie das Unglück individuell ist im Gegensatze zum
nivellierenden Glück); eine reizvolle, sofern sie ein
Künstler durchmacht und das Allzu-Menschliche nicht
übermässigen Raum einnimmt. Aber das Besondere
des Bandes liegt nicht in der Pathologie des Leibes —
die ist nur für den Arzt das Besondere —, vielmehr in
der Pathologie der Seele.
Aubrey Beardsley trat am 31. März 1897 zum
Katholizismus über. Er selbst nennt es den wichtigsten
Schritt seines Lebens, das im übrigen recht ereignislos
war. Wie haltlos, wie entnervt, wie ausgeblasen muss
der Ephebe gewesen sein, dass er, auf dieses ultimum
refugium peccatorum verfallend, in den Schoss der
alleinseligmachenden Kirche flüchtete: so wird man zu
schliessen geneigt sein. Und man wird sich nur zu
gern ausmalen, wie der kleine Sünder, von Todesängsten
geschüttelt, von den Fratzen seiner vermeintlich un-
sittlichen Zeichnungen bedräut, den kalten Schweiss auf
der Stirn, schlotternden Gebeins um Gnade winselte.
Bei Beardsley trifft es wohl doch nicht zu. Wir wissen,
dass von früh auf ein starker Hang zum Glauben in ihm
ausgeprägt war, dass seine intimsten Freunde von der
Echtheit seiner religiösen Gefühle durchdrungen waren.
„Meiner Ansicht nach kann man nie genug Religion
bekommen, wenn man überhaupt welche haben muss",
schrieb Byron einmal, der selbst zur katholischen Lehre
neigte, weil er in ihr den künstlerischsten Gottesdienst
sah: „Der Weihrauch, die Bilder, Statuen, Altäre,
Heiligenschreine, Reliquien, die leibliche Anwesenheit
in Wein und Brot, die Beichte, die Absolution — das
ist Etwas, an das sich das Gefühl klammern kann. Ausser-
dem lässt dieser Glaube gar keinen Zweifel aufkommen".
Einen solchen Glauben hatte Beardsley nötig, denn es
J
13 5