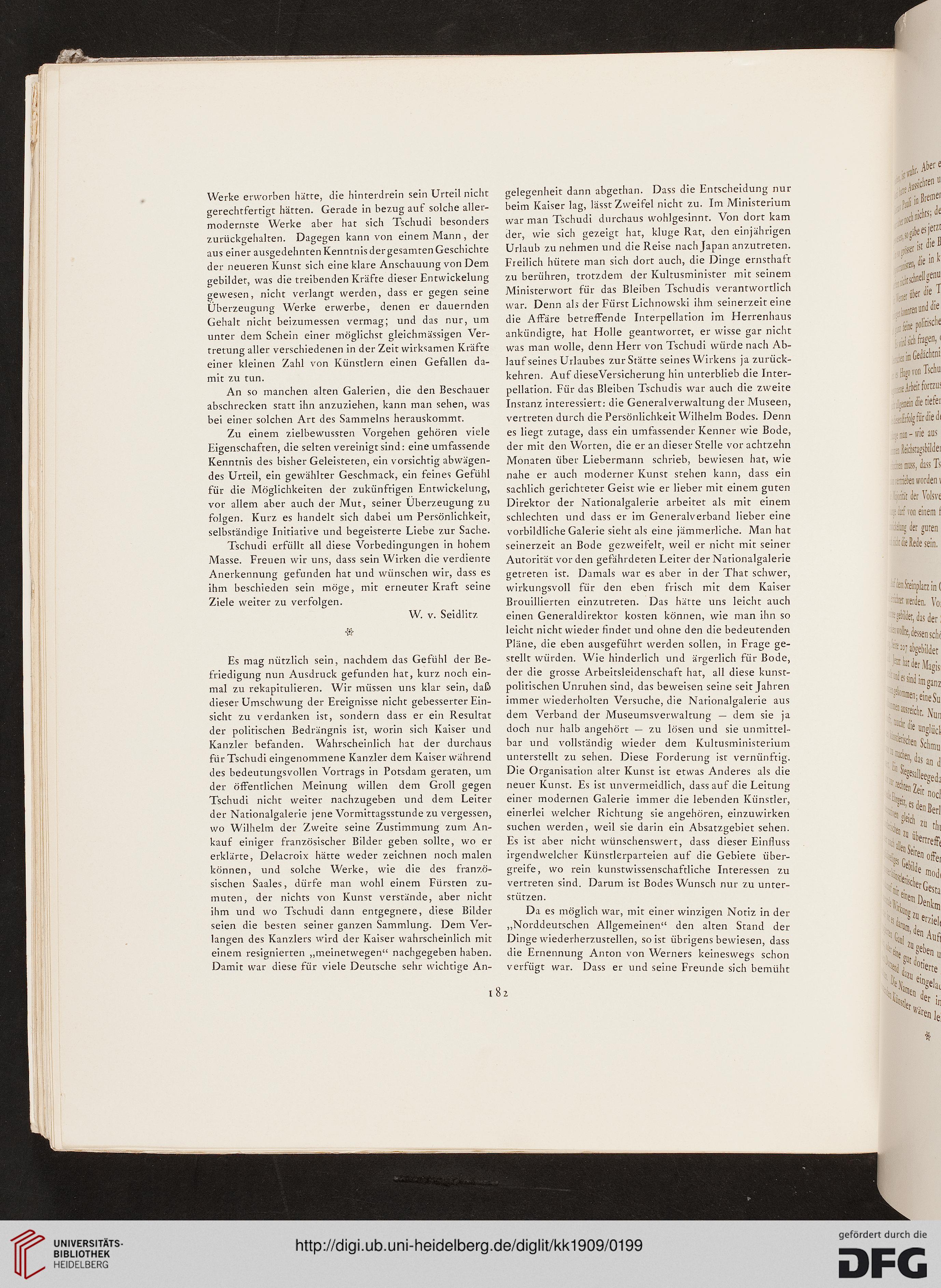Werke erworben hatte, die hinterdrein sein Urteil nicht
gerechtfertigt hätten. Gerade in bezug auf solche aller-
modernste Werke aber hat sich Tschudi besonders
zurückgehalten. Dagegen kann von einem Mann , der
aus einer ausgedehnten Kenntnis dergesamten Geschichte
der neueren Kunst sich eine klare Anschauung von Dem
gebilder, was die treibenden Kräfte dieser Entwickelung
gewesen, nicht verlangt werden, dass er gegen seine
Überzeugung Werke erwerbe, denen er dauernden
Gehalt nicht beizumessen vermag; und das nur, um
unter dem Schein einer möglichst gleichmässigen Ver-
tretung aller verschiedenen in der Zeit wirksamen Kräfte
einer kleinen Zahl von Künstlern einen Gefallen da-
mit zu tun.
An so manchen alten Galerien, die den Beschauer
abschrecken statt ihn anzuziehen, kann man sehen, was
bei einer solchen Art des Sammeins herauskommt.
Zu einem zielbewussten Vorgehen gehören viele
Eigenschaften, die selten vereinigt sind: eine umfassende
Kenntnis des bisher Geleisteten, ein vorsichtig abwägen-
des Urteil, ein gewählter Geschmack, ein feines Gefühl
für die Möglichkeiten der zukünftigen Entwickelung,
vor allem aber auch der Mut, seiner Überzeugung zu
folgen. Kurz es handelt sich dabei um Persönlichkeit,
selbständige Initiative und begeisterte Liebe zur Sache.
Tschudi erfüllt all diese Vorbedingungen in hohem
Masse. Freuen wir uns, dass sein Wirken die verdiente
Anerkennung gefunden hat und wünschen wir, dass es
ihm beschieden sein möge, mit erneuter Kraft seine
Ziele weiter zu verfolgen.
W. v. Seidlitz
Es mag nützlich sein, nachdem das Gefühl der Be-
friedigung nun Ausdruck gefunden hat, kurz noch ein-
mal zu rekapitulieren. Wir müssen uns klar sein, daß
dieser Umschwung der Ereignisse nicht gebesserter Ein-
sicht zu verdanken ist, sondern dass er ein Resultat
der politischen Bedrängnis ist, worin sich Kaiser und
Kanzler befanden. Wahrscheinlich hat der durchaus
für Tschudi eingenommene Kanzler dem Kaiser während
des bedeutungsvollen Vortrags in Potsdam geraten, um
der öffentlichen Meinung willen dem Groll gegen
Tschudi nicht weiter nachzugeben und dem Leiter
der Nationalgalerie jene Vormittagsstunde zu vergessen,
wo Wilhelm der Zweite seine Zustimmung zum An-
kauf einiger französischer Bilder geben sollte, wo er
erklärte, Delacroix hätte weder zeichnen noch malen
können, und solche Werke, wie die des franzö-
sischen Saales, dürfe man wohl einem Fürsten zu-
muten, der nichts von Kunst verstände, aber nicht
ihm und wo Tschudi dann entgegnete, diese Bilder
seien die besten seiner ganzen Sammlung. Dem Ver-
langen des Kanzlers wird der Kaiser wahrscheinlich mit
einem resignierten „meinetwegen" nachgegeben haben.
Damit war diese für viele Deutsche sehr wichtige An-
gelegenheit dann abgethan. Dass die Entscheidung nur
beim Kaiser lag, lässt Zweifel nicht zu. Im Ministerium
war man Tschudi durchaus wohlgesinnt. Von dort kam
der, wie sich gezeigt hat, kluge Rat, den einjährigen
Urlaub zu nehmen und die Reise nach Japan anzutreten.
Freilich hütete man sich dort auch, die Dinge ernsthaft
zu berühren, trotzdem der Kultusminister mit seinem
Ministerwort für das Bleiben Tschudis verantwortlich
war. Denn als der Fürst Lichnowski ihm seinerzeit eine
die Affäre betreffende Interpellation im Herrenhaus
ankündigte, hat Holle geantwortet, er wisse gar nicht
was man wolle, denn Herr von Tschudi würde nach Ab-
lauf seines Urlaubes zur Stätte seines Wirkens ja zurück-
kehren. Auf dieseVersicherung hin unterblieb die Inter-
pellation. Für das Bleiben Tschudis war auch die zweite
Instanz interessiert: die Generalverwaltung der Museen,
vertreten durch die Persönlichkeit Wilhelm Bodes. Denn
es liegt zutage, dass ein umfassender Kenner wie Bode,
der mit den Worten, die er an dieser Stelle vor achtzehn
Monaten über Liebermann schrieb, bewiesen hat, wie
nahe er auch moderner Kunst stehen kann, dass ein
sachlich gerichteter Geist wie er lieber mit einem guten
Direktor der Nationalgalerie arbeitet als mit einem
schlechten und dass er im Generalverband lieber eine
vorbildliche Galerie sieht als eine jämmerliche. Man hat
seinerzeit an Bode gezweifelt, weil er nicht mit seiner
Autorität vor den gefährdeten Leiter der Nationalgalerie
getreten ist. Damals war es aber in der That schwer,
wirkungsvoll für den eben frisch mit dem Kaiser
Brouillierten einzutreten. Das hätte uns leicht auch
einen Generaldirektor kosten können, wie man ihn so
leicht nicht wieder findet und ohne den die bedeutenden
Pläne, die eben ausgeführt werden sollen, in Frage ge-
stellt würden. Wie hinderlich und ärgerlich für Bode,
der die grosse Arbeitsleidenschaft hat, all diese kunst-
politischen Unruhen sind, das beweisen seine seit Jahren
immer wiederholten Versuche, die Narionalgalerie aus
dem Verband der Museumsverwaltung — dem sie ja
doch nur halb angehört — zu lösen und sie unmittel-
bar und vollständig wieder dem Kultusministerium
unterstellt zu sehen. Diese Forderung ist vernünftig.
Die Organisation alter Kunst ist etwas Anderes als die
neuer Kunst. Es ist unvermeidlich, dass auf die Leitung
einer modernen Galerie immer die lebenden Künstler,
einerlei welcher Richtung sie angehören, einzuwirken
suchen werden, weil sie darin ein Absatzgebiet sehen.
Es ist aber nicht wünschenswert, dass dieser Einfluss
irgendwelcher Künstlerparteien auf die Gebiete über-
greife, wo rein kunstwissenschaftliche Interessen zu
vertreten sind. Darum ist Bodes Wunsch nur zu unter-
stützen.
Da es möglich war, mit einer winzigen Notiz in der
„Norddeutschen Allgemeinen" den alten Stand der
Dinge wiederherzustellen, so ist übrigens bewiesen, dass
die Ernennung Anton von Werners keineswegs schon
verfügt war. Dass er und seine Freunde sich bemüht
gisse'
18;
K