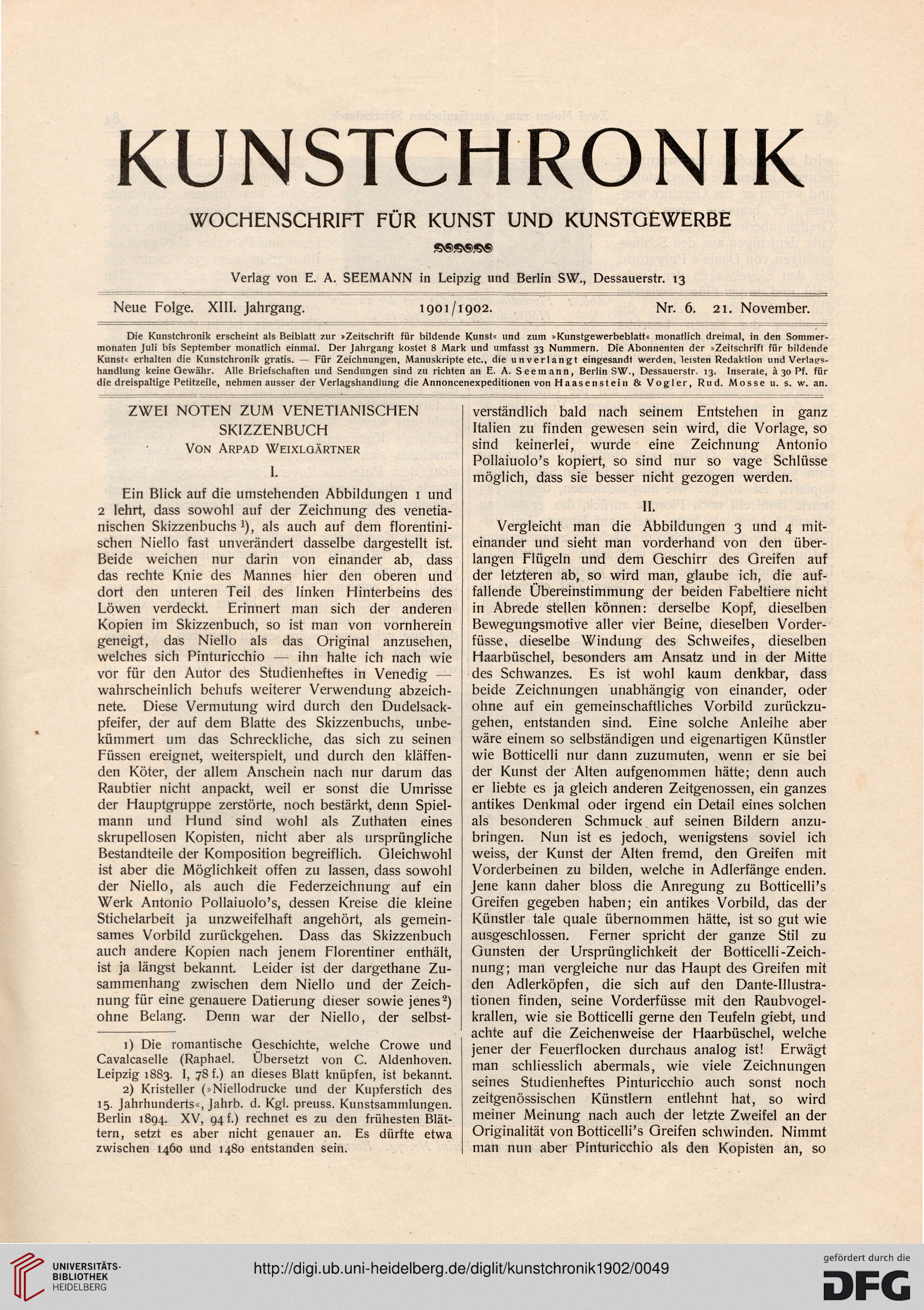KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig und Berlin SW., Dessauerstr. 13
Neue Folge. XIII. Jahrgang. 1901/1902. Nr. 6. 21. November.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlaes-
handlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Berlin SW., Dessauerstr. 13. Inserate, ä 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen ausser der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
ZWEI NOTEN ZUM VENETIANISCHEN
SKIZZENBUCH
Von Arpad Weixloärtner
I.
Ein Blick auf die umstehenden Abbildungen 1 und
2 lehrt, dass sowohl auf der Zeichnung des venetia-
nischen Skizzenbuchs1), als auch auf dem florentini-
schen Niello fast unverändert dasselbe dargestellt ist.
Beide weichen nur darin von einander ab, dass
das rechte Knie des Mannes hier den oberen und
dort den unteren Teil des linken Hinterbeins des
Löwen verdeckt. Erinnert man sich der anderen
Kopien im Skizzenbuch, so ist man von vornherein
geneigt, das Niello als das Original anzusehen,
welches sich Pinturicchio — ihn halte ich nach wie
vor für den Autor des Studienheftes in Venedig —
wahrscheinlich behufs weiterer Verwendung abzeich-
nete. Diese Vermutung wird durch den Dudelsack-
pfeifer, der auf dem Blatte des Skizzenbuchs, unbe-
kümmert um das Schreckliche, das sich zu seinen
Füssen ereignet, weiterspielt, und durch den kläffen-
den Köter, der allem Anschein nach nur darum das
Raubtier nicht anpackt, weil er sonst die Umrisse
der Hauptgruppe zerstörte, noch bestärkt, denn Spiel-
mann und Hund sind wohl als Zuthaten eines
skrupellosen Kopisten, nicht aber als ursprüngliche
Bestandteile der Komposition begreiflich. Gleichwohl
ist aber die Möglichkeit offen zu lassen, dass sowohl
der Niello, als auch die Federzeichnung auf ein
Werk Antonio Pollaiuolo's, dessen Kreise die kleine
Stichelarbeit ja unzweifelhaft angehört, als gemein-
sames Vorbild zurückgehen. Dass das Skizzenbuch
auch andere Kopien nach jenem Florentiner enthält,
ist ja längst bekannt. Leider ist der dargethane Zu-
sammenhang zwischen dem Niello und der Zeich-
nung für eine genauere Datierung dieser sowie jenes2)
ohne Belang. Denn war der Niello, der selbst-
1) Die romantische Geschichte, welche Crowe und
Cavalcaselle (Raphael. Übersetzt von C. Aldenhoven.
Leipzig 1883. I, 78 f.) an dieses Blatt knüpfen, ist bekannt.
2) Kristeller (»Niellodrucke und der Kupferstich des
15. Jahrhunderts«, Jahrb. d. Kgl. preuss. Kunstsammlungen.
Berlin 1894. XV, 94 f.) rechnet es zu den frühesten Blät-
tern, setzt es aber nicht genauer an. Es dürfte etwa
zwischen 1460 und 1480 entstanden sein.
verständlich bald nach seinem Entstehen in ganz
Italien zu finden gewesen sein wird, die Vorlage, so
sind keinerlei, wurde eine Zeichnung Antonio
Pollaiuolo's kopiert, so sind nur so vage Schlüsse
möglich, dass sie besser nicht gezogen werden.
II.
Vergleicht man die Abbildungen 3 und 4 mit-
einander und sieht man vorderhand von den über-
langen Flügeln und dem Geschirr des Greifen auf
der letzteren ab, so wird man, glaube ich, die auf-
fallende Übereinstimmung der beiden Fabeltiere nicht
in Abrede stellen können: derselbe Kopf, dieselben
Bewegungsmotive aller vier Beine, dieselben Vorder-
füsse, dieselbe Windung des Schweifes, dieselben
Haarbüschel, besonders am Ansatz und in der Mitte
des Schwanzes. Es ist wohl kaum denkbar, dass
beide Zeichnungen unabhängig von einander, oder
ohne auf ein gemeinschaftliches Vorbild zurückzu-
gehen, entstanden sind. Eine solche Anleihe aber
wäre einem so selbständigen und eigenartigen Künstler
wie Botticelli nur dann zuzumuten, wenn er sie bei
der Kunst der Alten aufgenommen hätte; denn auch
er liebte es ja gleich anderen Zeitgenossen, ein ganzes
antikes Denkmal oder irgend ein Detail eines solchen
als besonderen Schmuck auf seinen Bildern anzu-
bringen. Nun ist es jedoch, wenigstens soviel ich
weiss, der Kunst der Alten fremd, den Greifen mit
Vorderbeinen zu bilden, welche in Adlerfänge enden.
Jene kann daher bloss die Anregung zu Botticelli's
Greifen gegeben haben; ein antikes Vorbild, das der
Künstler tale quäle übernommen hätte, ist so gut wie
ausgeschlossen. Ferner spricht der ganze Stil zu
Gunsten der Ursprünglichkeit der Botticelli-Zeich-
nung; man vergleiche nur das Haupt des Greifen mit
den Adlerköpfen, die sich auf den Dante-Illustra-
tionen finden, seine Vorderfüsse mit den Raubvogel-
krallen, wie sie Botticelli gerne den Teufeln giebt, und
achte auf die Zeichenweise der Haarbüschel, welche
jener der Feuerflocken durchaus analog ist! Erwägt
man schliesslich abermals, wie viele Zeichnungen
seines Studienheftes Pinturicchio auch sonst noch
zeitgenössischen Künstlern entlehnt hat, so wird
meiner Meinung nach auch der letzte Zweifel an der
Originalität von Botticelli's Greifen schwinden. Nimmt
man nun aber Pinturicchio als den Kopisten an, so
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig und Berlin SW., Dessauerstr. 13
Neue Folge. XIII. Jahrgang. 1901/1902. Nr. 6. 21. November.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfasst 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik gratis. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Verlaes-
handlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Berlin SW., Dessauerstr. 13. Inserate, ä 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen ausser der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
ZWEI NOTEN ZUM VENETIANISCHEN
SKIZZENBUCH
Von Arpad Weixloärtner
I.
Ein Blick auf die umstehenden Abbildungen 1 und
2 lehrt, dass sowohl auf der Zeichnung des venetia-
nischen Skizzenbuchs1), als auch auf dem florentini-
schen Niello fast unverändert dasselbe dargestellt ist.
Beide weichen nur darin von einander ab, dass
das rechte Knie des Mannes hier den oberen und
dort den unteren Teil des linken Hinterbeins des
Löwen verdeckt. Erinnert man sich der anderen
Kopien im Skizzenbuch, so ist man von vornherein
geneigt, das Niello als das Original anzusehen,
welches sich Pinturicchio — ihn halte ich nach wie
vor für den Autor des Studienheftes in Venedig —
wahrscheinlich behufs weiterer Verwendung abzeich-
nete. Diese Vermutung wird durch den Dudelsack-
pfeifer, der auf dem Blatte des Skizzenbuchs, unbe-
kümmert um das Schreckliche, das sich zu seinen
Füssen ereignet, weiterspielt, und durch den kläffen-
den Köter, der allem Anschein nach nur darum das
Raubtier nicht anpackt, weil er sonst die Umrisse
der Hauptgruppe zerstörte, noch bestärkt, denn Spiel-
mann und Hund sind wohl als Zuthaten eines
skrupellosen Kopisten, nicht aber als ursprüngliche
Bestandteile der Komposition begreiflich. Gleichwohl
ist aber die Möglichkeit offen zu lassen, dass sowohl
der Niello, als auch die Federzeichnung auf ein
Werk Antonio Pollaiuolo's, dessen Kreise die kleine
Stichelarbeit ja unzweifelhaft angehört, als gemein-
sames Vorbild zurückgehen. Dass das Skizzenbuch
auch andere Kopien nach jenem Florentiner enthält,
ist ja längst bekannt. Leider ist der dargethane Zu-
sammenhang zwischen dem Niello und der Zeich-
nung für eine genauere Datierung dieser sowie jenes2)
ohne Belang. Denn war der Niello, der selbst-
1) Die romantische Geschichte, welche Crowe und
Cavalcaselle (Raphael. Übersetzt von C. Aldenhoven.
Leipzig 1883. I, 78 f.) an dieses Blatt knüpfen, ist bekannt.
2) Kristeller (»Niellodrucke und der Kupferstich des
15. Jahrhunderts«, Jahrb. d. Kgl. preuss. Kunstsammlungen.
Berlin 1894. XV, 94 f.) rechnet es zu den frühesten Blät-
tern, setzt es aber nicht genauer an. Es dürfte etwa
zwischen 1460 und 1480 entstanden sein.
verständlich bald nach seinem Entstehen in ganz
Italien zu finden gewesen sein wird, die Vorlage, so
sind keinerlei, wurde eine Zeichnung Antonio
Pollaiuolo's kopiert, so sind nur so vage Schlüsse
möglich, dass sie besser nicht gezogen werden.
II.
Vergleicht man die Abbildungen 3 und 4 mit-
einander und sieht man vorderhand von den über-
langen Flügeln und dem Geschirr des Greifen auf
der letzteren ab, so wird man, glaube ich, die auf-
fallende Übereinstimmung der beiden Fabeltiere nicht
in Abrede stellen können: derselbe Kopf, dieselben
Bewegungsmotive aller vier Beine, dieselben Vorder-
füsse, dieselbe Windung des Schweifes, dieselben
Haarbüschel, besonders am Ansatz und in der Mitte
des Schwanzes. Es ist wohl kaum denkbar, dass
beide Zeichnungen unabhängig von einander, oder
ohne auf ein gemeinschaftliches Vorbild zurückzu-
gehen, entstanden sind. Eine solche Anleihe aber
wäre einem so selbständigen und eigenartigen Künstler
wie Botticelli nur dann zuzumuten, wenn er sie bei
der Kunst der Alten aufgenommen hätte; denn auch
er liebte es ja gleich anderen Zeitgenossen, ein ganzes
antikes Denkmal oder irgend ein Detail eines solchen
als besonderen Schmuck auf seinen Bildern anzu-
bringen. Nun ist es jedoch, wenigstens soviel ich
weiss, der Kunst der Alten fremd, den Greifen mit
Vorderbeinen zu bilden, welche in Adlerfänge enden.
Jene kann daher bloss die Anregung zu Botticelli's
Greifen gegeben haben; ein antikes Vorbild, das der
Künstler tale quäle übernommen hätte, ist so gut wie
ausgeschlossen. Ferner spricht der ganze Stil zu
Gunsten der Ursprünglichkeit der Botticelli-Zeich-
nung; man vergleiche nur das Haupt des Greifen mit
den Adlerköpfen, die sich auf den Dante-Illustra-
tionen finden, seine Vorderfüsse mit den Raubvogel-
krallen, wie sie Botticelli gerne den Teufeln giebt, und
achte auf die Zeichenweise der Haarbüschel, welche
jener der Feuerflocken durchaus analog ist! Erwägt
man schliesslich abermals, wie viele Zeichnungen
seines Studienheftes Pinturicchio auch sonst noch
zeitgenössischen Künstlern entlehnt hat, so wird
meiner Meinung nach auch der letzte Zweifel an der
Originalität von Botticelli's Greifen schwinden. Nimmt
man nun aber Pinturicchio als den Kopisten an, so