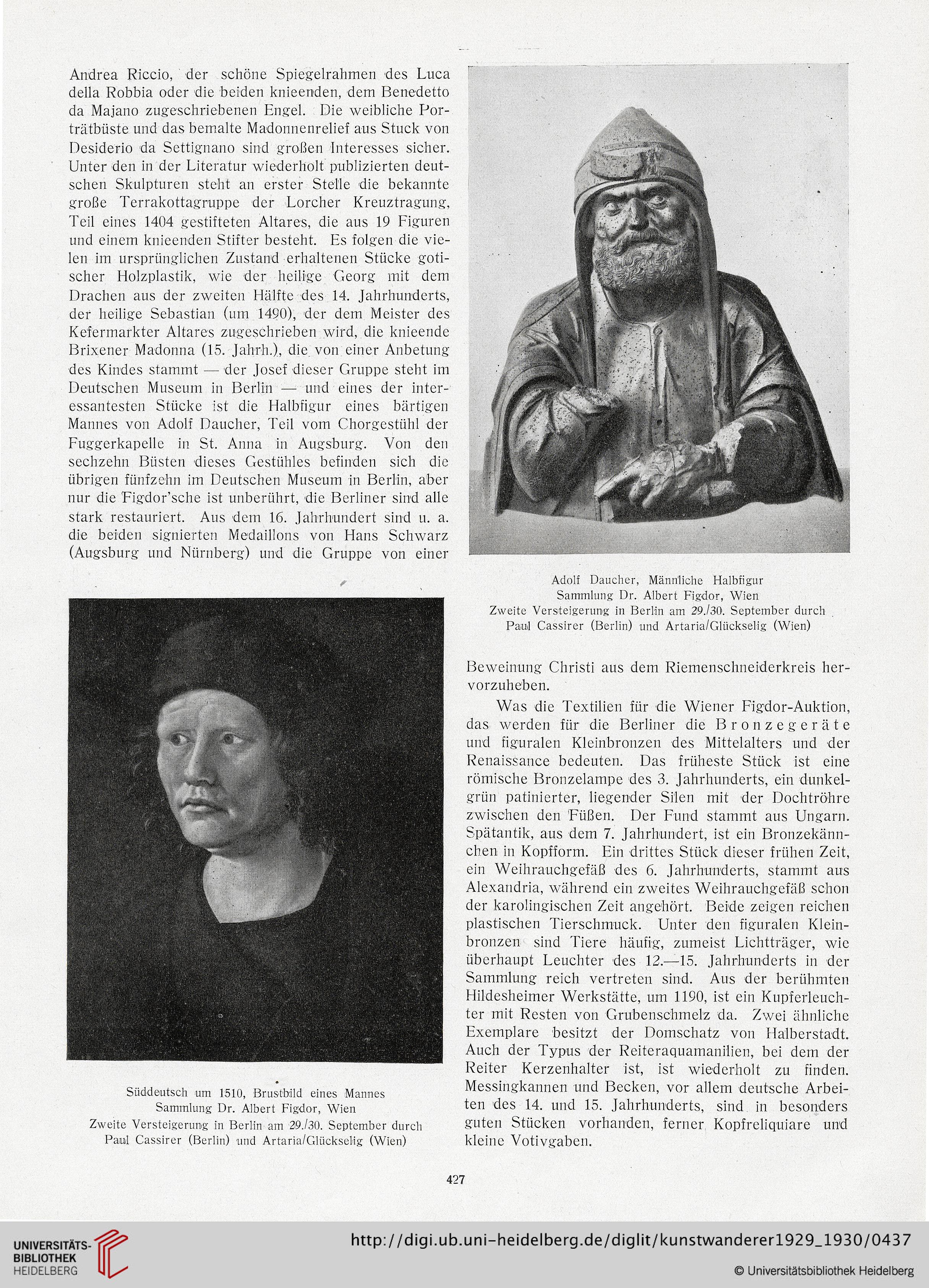Andrea Riccio, der schöne Spiegelrahmen des Luca
della Robbia oder die beiden knieenden, dem Benedetto
da Majano zugeschriebenen Engel. Die weibliche Por-
trätbüste und das bemalte Madonnenrelief aus Stuck von
Desiderio da Settignano sind großen Interesses sicher.
Unter den in der Literatur wiederholt publizierten deut-
schen Skulpturen steht an erster Stelle die bekannte
große Terrakottagruppe der Lorcher Kreuztragung,
Teil eines 1404 gestifteten Altares, die aus 19 Figuren
und einem knieenden Stifter besteht. Es folgen die vie-
len im ursprünglichen Zustand erhaltenen Stücke goti-
scher Holzplastik, wie der heilige Georg mit dem
Drachen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts,
der heilige Sebastian (um 1490), der dem Meister des
Kefermarkter Altares zugeschrieben wird, die knieende
Brixener Madonna (15. Jahrh,), die von einer Anbetung
des Kindes stammt — der Josef dieser Gruppe steht im
Deutschen Museum in Berlin —- und eines der inter-
essantesten Stücke ist die Halbfigur eines bärtigen
Mannes von Adolf Daucher, Teil vom Chorgestühl der
Fuggerkapelle in St. Anna in Augsburg. Von den
sechzehn Büsten dieses Gestühles befinden sich die
übrigen fünfzehn im Deutschen Museum in Berlin, aber
nur die Figdor’sche ist unberührt, die Berliner sind alle
stark restauriert. Aus dem 16. Jahrhundert sind u. a.
die beiden signierten Medaillons von Hans Schwarz
(Augsburg und Nürnberg) und die Gruppe von einer
Süddeutsch um 1510, Brustbild eines Mannes
Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien
Zweite Versteigerung in Berlin am 29./3Ö; September durch
Paul Cassirer (Berlin) und Artaria/Glückselig (Wien)
Adolf Daucher, Männliche Halbfigur
Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien
Zweite Versteigerung in Berlin am 29.130. September durch
Paul Cassirer (Berlin) und Artaria/Glückselig (Wien)
Beweinung Christi aus dem Riemenschneiderkreis her-
vorzuheben.
Was die Textilien für die Wiener Figdor-Auktion,
das werden für die Berliner die Bronzegeräte
und figuralen Kleinbronzen des Mittelalters und der
Renaissance bedeuten. Das früheste Stück ist eine
römische Bronzelampe des 3. Jahrhunderts, ein dunkel-
grün patinierter, liegender Silen mit der Dochtröhre
zwischen den Füßen. Der Fund stammt aus Ungarn.
Spätantik, aus dem 7. Jahrhundert, ist ein Bronzekänn-
chen in Kopfform. Ein drittes Stück dieser frühen Zeit,
ein Weihrauchgefäß des 6. Jahrhunderts, stammt aus
Alexandria, während ein zweites Weihrauchgefäß schon
der karolingischen Zeit angehört. Beide zeigen reichen
plastischen Tierschmuck. Unter den figuralen Klein-
bronzen sind Tiere häufig, zumeist Lichtträger, wie
überhaupt Leuchter des 12.—15. Jahrhunderts in der
Sammlung reich vertreten sind. Aus der berühmten
Hildesheimer Werkstätte, um 1190, ist ein Kupferleuch-
ter mit Resten von Grubenschmelz da. Zwei ähnliche
Exemplare besitzt der Domschatz von Halberstadt.
Auch der Typus der Reiteraquamanilien, bei dem der
Reiter Kerzenhalter ist, ist wiederholt zu finden.
Messingkannen und Becken, vor allem deutsche Arbei-
ten des 14. und 15. Jahrhunderts, sind in besonders
guten Stücken vorhanden, ferner Kopfreliquiare und
kleine Votivgaben.
427
della Robbia oder die beiden knieenden, dem Benedetto
da Majano zugeschriebenen Engel. Die weibliche Por-
trätbüste und das bemalte Madonnenrelief aus Stuck von
Desiderio da Settignano sind großen Interesses sicher.
Unter den in der Literatur wiederholt publizierten deut-
schen Skulpturen steht an erster Stelle die bekannte
große Terrakottagruppe der Lorcher Kreuztragung,
Teil eines 1404 gestifteten Altares, die aus 19 Figuren
und einem knieenden Stifter besteht. Es folgen die vie-
len im ursprünglichen Zustand erhaltenen Stücke goti-
scher Holzplastik, wie der heilige Georg mit dem
Drachen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts,
der heilige Sebastian (um 1490), der dem Meister des
Kefermarkter Altares zugeschrieben wird, die knieende
Brixener Madonna (15. Jahrh,), die von einer Anbetung
des Kindes stammt — der Josef dieser Gruppe steht im
Deutschen Museum in Berlin —- und eines der inter-
essantesten Stücke ist die Halbfigur eines bärtigen
Mannes von Adolf Daucher, Teil vom Chorgestühl der
Fuggerkapelle in St. Anna in Augsburg. Von den
sechzehn Büsten dieses Gestühles befinden sich die
übrigen fünfzehn im Deutschen Museum in Berlin, aber
nur die Figdor’sche ist unberührt, die Berliner sind alle
stark restauriert. Aus dem 16. Jahrhundert sind u. a.
die beiden signierten Medaillons von Hans Schwarz
(Augsburg und Nürnberg) und die Gruppe von einer
Süddeutsch um 1510, Brustbild eines Mannes
Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien
Zweite Versteigerung in Berlin am 29./3Ö; September durch
Paul Cassirer (Berlin) und Artaria/Glückselig (Wien)
Adolf Daucher, Männliche Halbfigur
Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien
Zweite Versteigerung in Berlin am 29.130. September durch
Paul Cassirer (Berlin) und Artaria/Glückselig (Wien)
Beweinung Christi aus dem Riemenschneiderkreis her-
vorzuheben.
Was die Textilien für die Wiener Figdor-Auktion,
das werden für die Berliner die Bronzegeräte
und figuralen Kleinbronzen des Mittelalters und der
Renaissance bedeuten. Das früheste Stück ist eine
römische Bronzelampe des 3. Jahrhunderts, ein dunkel-
grün patinierter, liegender Silen mit der Dochtröhre
zwischen den Füßen. Der Fund stammt aus Ungarn.
Spätantik, aus dem 7. Jahrhundert, ist ein Bronzekänn-
chen in Kopfform. Ein drittes Stück dieser frühen Zeit,
ein Weihrauchgefäß des 6. Jahrhunderts, stammt aus
Alexandria, während ein zweites Weihrauchgefäß schon
der karolingischen Zeit angehört. Beide zeigen reichen
plastischen Tierschmuck. Unter den figuralen Klein-
bronzen sind Tiere häufig, zumeist Lichtträger, wie
überhaupt Leuchter des 12.—15. Jahrhunderts in der
Sammlung reich vertreten sind. Aus der berühmten
Hildesheimer Werkstätte, um 1190, ist ein Kupferleuch-
ter mit Resten von Grubenschmelz da. Zwei ähnliche
Exemplare besitzt der Domschatz von Halberstadt.
Auch der Typus der Reiteraquamanilien, bei dem der
Reiter Kerzenhalter ist, ist wiederholt zu finden.
Messingkannen und Becken, vor allem deutsche Arbei-
ten des 14. und 15. Jahrhunderts, sind in besonders
guten Stücken vorhanden, ferner Kopfreliquiare und
kleine Votivgaben.
427