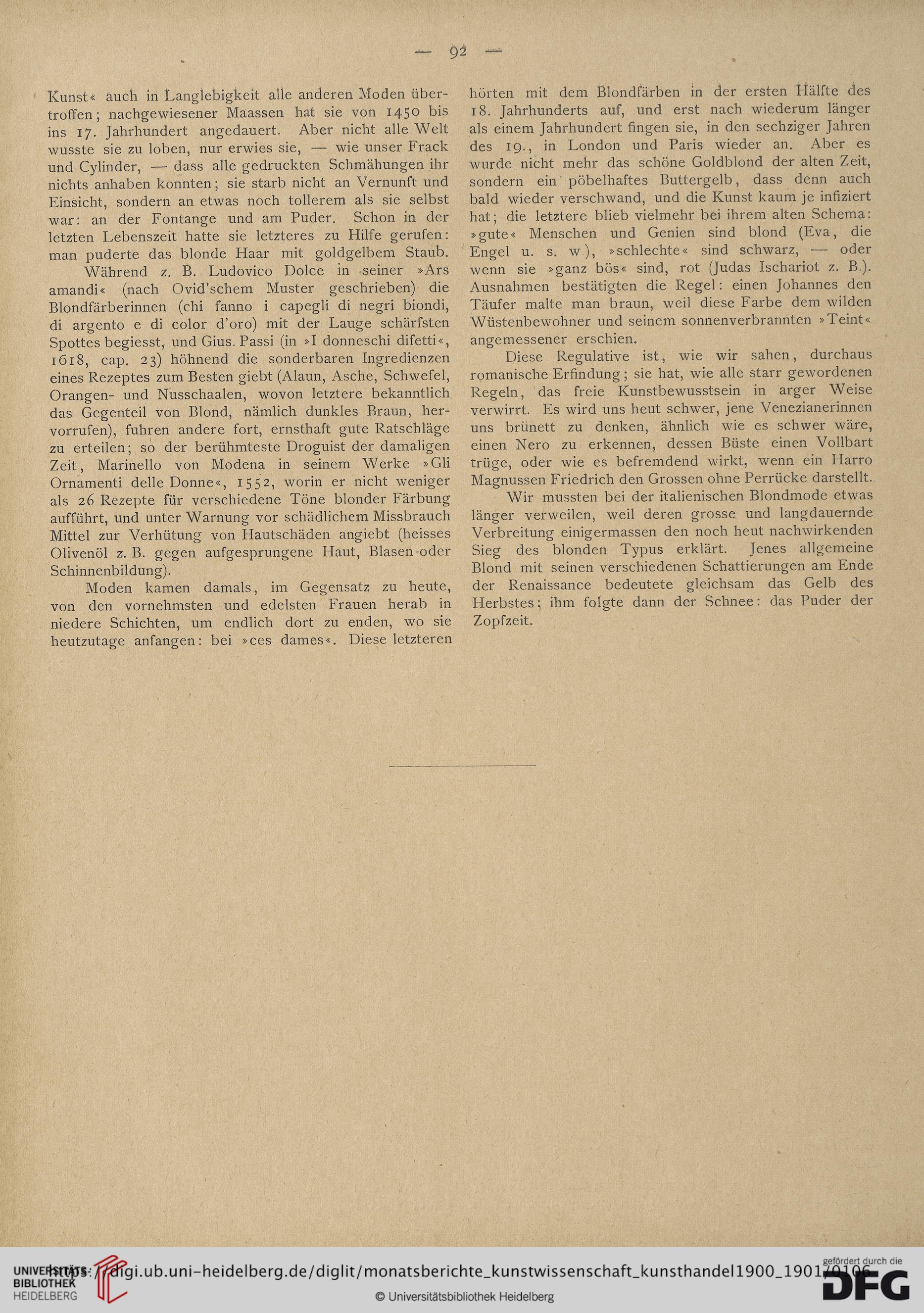Kunst« auch in Langlebigkeit alle anderen Moden über-
troffen; nachgewiesener Maassen hat sie von 1450 bis
ins 17. Jahrhundert angedauert. Aber nicht alle Welt
wusste sie zu loben, nur erwies sie, — wie unser Frack
und Cylinder, — dass alle gedruckten Schmähungen ihr
nichts anhaben konnten; sie starb nicht an Vernunft und
Einsicht, sondern an etwas noch tollerem als sie selbst
war: an der Fontange und am Puder. Schon in der
letzten Lebenszeit hatte sie letzteres zu Hilfe gerufen:
man puderte das blonde Haar mit goldgelbem Staub.
Während z. B. Ludovico Dolce in seiner »Ars
amandi« (nach Ovid’schem Muster geschrieben) die
Blondfärberinnen (chi fanno i capegli di negri biondi,
di argento e di color d’oro) mit der Lauge schärfsten
Spottes begiesst, und Gius. Passi (in »I donneschi difetti«,
1618, cap. 23) höhnend die sonderbaren Ingredienzen
eines Rezeptes zum Besten giebt (Alaun, Asche, Schwefel,
Orangen- und Nusschaalen, wovon letztere bekanntlich
das Gegenteil von Blond, nämlich dunkles Braun, her-
vorrufen), fuhren andere fort, ernsthaft gute Ratschläge
zu erteilen; so der berühmteste Droguist der damaligen
Zeit, Marinello von Modena in seinem Werke »Gli
Ornamenti delle Donne«, 1552, worin er nicht weniger
als 26 Rezepte für verschiedene Töne blonder Färbung
aufführt, und unter Warnung vor schädlichem Missbrauch
Mittel zur Verhütung von Hautschäden angiebt (heisses
Olivenöl z. B. gegen aufgesprungene Haut, Blasen oder
Schinnenbildung).
Moden kamen damals, im Gegensatz zu heute,
von den vornehmsten und edelsten Frauen herab in
niedere Schichten, um endlich dort zu enden, wo sie
heutzutage anfangen: bei »ces dames«. Diese letzteren
hörten mit dem Blondfärben in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts auf, und erst nach wiederum länger
als einem Jahrhundert fingen sie, in den sechziger Jahren
des 19., in London und Paris wieder an. Aber es
wurde nicht mehr das schöne Goldblond der alten Zeit,
sondern ein pöbelhaftes Buttergelb, dass denn auch
bald wieder verschwand, und die Kunst kaum je infiziert
hat; die letztere blieb vielmehr bei ihrem alten Schema:
»gute« Menschen und Genien sind blond (Eva, die
Engel u. s. w), »schlechte« sind schwarz, — oder
wenn sie »ganz bös« sind, rot (Judas Ischariot z. B.).
Ausnahmen bestätigten die Regel: einen Johannes den
Täufer malte man braun, weil diese Farbe dem wilden
Wüstenbewohner und seinem sonnenverbrannten »Teint«
angemessener erschien.
Diese Regulative ist, wie wir sahen, durchaus
romanische Erfindung; sie hat, wie alle starr gewordenen
Regeln, das freie Kunstbewusstsein in arger Weise
verwirrt. Es wird uns heut schwer, jene Venezianerinnen
uns brünett zu denken, ähnlich wie es schwer wäre,
einen Nero zu erkennen, dessen Büste einen Vollbart
trüge, oder wie es befremdend wirkt, wenn ein Harro
Magnussen Friedrich den Grossen ohne Perrücke darstellt.
Wir mussten bei der italienischen Blondmode etwas
länger verweilen, weil deren grosse und langdauernde
Verbreitung einigermassen den noch heut nachwirkenden
Sieg des blonden Typus erklärt. Jenes allgemeine
Blond mit seinen verschiedenen Schattierungen am Ende
der Renaissance bedeutete gleichsam das Gelb des
Herbstes; ihm folgte dann der Schnee: das Puder der
Zopfzeit.
troffen; nachgewiesener Maassen hat sie von 1450 bis
ins 17. Jahrhundert angedauert. Aber nicht alle Welt
wusste sie zu loben, nur erwies sie, — wie unser Frack
und Cylinder, — dass alle gedruckten Schmähungen ihr
nichts anhaben konnten; sie starb nicht an Vernunft und
Einsicht, sondern an etwas noch tollerem als sie selbst
war: an der Fontange und am Puder. Schon in der
letzten Lebenszeit hatte sie letzteres zu Hilfe gerufen:
man puderte das blonde Haar mit goldgelbem Staub.
Während z. B. Ludovico Dolce in seiner »Ars
amandi« (nach Ovid’schem Muster geschrieben) die
Blondfärberinnen (chi fanno i capegli di negri biondi,
di argento e di color d’oro) mit der Lauge schärfsten
Spottes begiesst, und Gius. Passi (in »I donneschi difetti«,
1618, cap. 23) höhnend die sonderbaren Ingredienzen
eines Rezeptes zum Besten giebt (Alaun, Asche, Schwefel,
Orangen- und Nusschaalen, wovon letztere bekanntlich
das Gegenteil von Blond, nämlich dunkles Braun, her-
vorrufen), fuhren andere fort, ernsthaft gute Ratschläge
zu erteilen; so der berühmteste Droguist der damaligen
Zeit, Marinello von Modena in seinem Werke »Gli
Ornamenti delle Donne«, 1552, worin er nicht weniger
als 26 Rezepte für verschiedene Töne blonder Färbung
aufführt, und unter Warnung vor schädlichem Missbrauch
Mittel zur Verhütung von Hautschäden angiebt (heisses
Olivenöl z. B. gegen aufgesprungene Haut, Blasen oder
Schinnenbildung).
Moden kamen damals, im Gegensatz zu heute,
von den vornehmsten und edelsten Frauen herab in
niedere Schichten, um endlich dort zu enden, wo sie
heutzutage anfangen: bei »ces dames«. Diese letzteren
hörten mit dem Blondfärben in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts auf, und erst nach wiederum länger
als einem Jahrhundert fingen sie, in den sechziger Jahren
des 19., in London und Paris wieder an. Aber es
wurde nicht mehr das schöne Goldblond der alten Zeit,
sondern ein pöbelhaftes Buttergelb, dass denn auch
bald wieder verschwand, und die Kunst kaum je infiziert
hat; die letztere blieb vielmehr bei ihrem alten Schema:
»gute« Menschen und Genien sind blond (Eva, die
Engel u. s. w), »schlechte« sind schwarz, — oder
wenn sie »ganz bös« sind, rot (Judas Ischariot z. B.).
Ausnahmen bestätigten die Regel: einen Johannes den
Täufer malte man braun, weil diese Farbe dem wilden
Wüstenbewohner und seinem sonnenverbrannten »Teint«
angemessener erschien.
Diese Regulative ist, wie wir sahen, durchaus
romanische Erfindung; sie hat, wie alle starr gewordenen
Regeln, das freie Kunstbewusstsein in arger Weise
verwirrt. Es wird uns heut schwer, jene Venezianerinnen
uns brünett zu denken, ähnlich wie es schwer wäre,
einen Nero zu erkennen, dessen Büste einen Vollbart
trüge, oder wie es befremdend wirkt, wenn ein Harro
Magnussen Friedrich den Grossen ohne Perrücke darstellt.
Wir mussten bei der italienischen Blondmode etwas
länger verweilen, weil deren grosse und langdauernde
Verbreitung einigermassen den noch heut nachwirkenden
Sieg des blonden Typus erklärt. Jenes allgemeine
Blond mit seinen verschiedenen Schattierungen am Ende
der Renaissance bedeutete gleichsam das Gelb des
Herbstes; ihm folgte dann der Schnee: das Puder der
Zopfzeit.