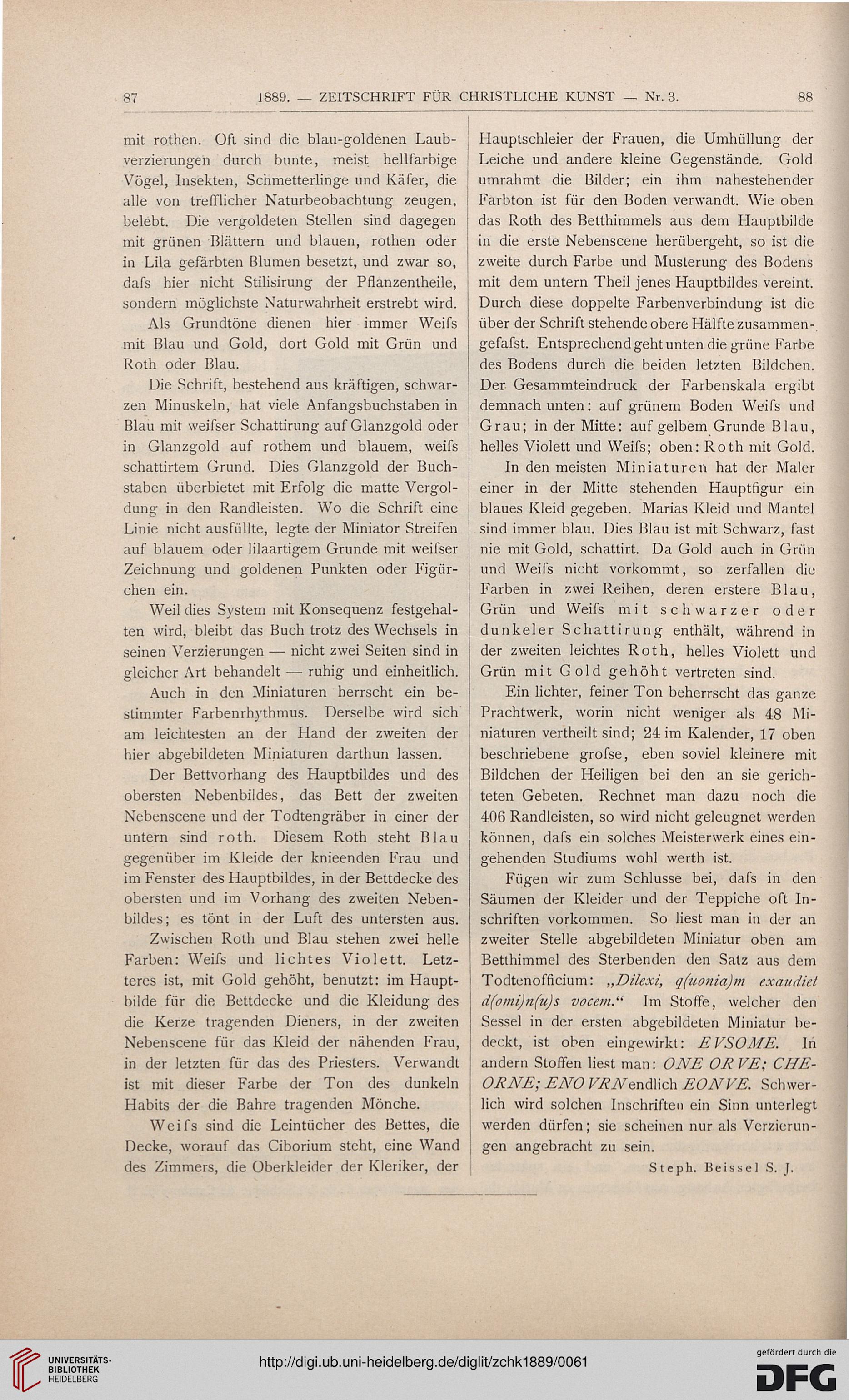87
J889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
88
mit rothen. Oft sind die blau-goldenen Laub-
verzierungen durch bunte, meist hellfarbige
Vögel, Insekten, Schmetterlinge und Käfer, die
alle von trefflicher Naturbeobachtung zeugen,
belebt. Die vergoldeten Stellen sind dagegen
mit grünen Blättern und blauen, rothen oder
in Lila gefärbten Blumen besetzt, und zwar so,
dafs hier nicht Stilisirung der Pflanzentheile,
sondern möglichste Naturwahrheit erstrebt wird.
Als Grundtöne dienen hier immer Weifs
mit Blau und Gold, dort Gold mit Grün und
Roth oder Blau.
Die Schrift, bestehend aus kräftigen, schwar-
zen Minuskeln, hat viele Anfangsbuchstaben in
Blau mit weifser Schattirung auf Glanzgold oder
in Glanzgold auf rothem und blauem, weifs
schattirtem Grund. Dies Glanzgold der Buch-
staben überbietet mit Erfolg die matte Vergol-
dung in den Randleisten. Wo die Schrift eine
Linie nicht ausfüllte, legte der Miniator Streifen
auf blauem oder lilaartigem Grunde mit weifser
Zeichnung und goldenen Punkten oder Figür-
chen ein.
Weil dies System mit Konsequenz festgehal-
ten wird, bleibt das Buch trotz des Wechsels in
seinen Verzierungen — nicht zwei Seiten sind in
gleicher Art behandelt — ruhig und einheitlich.
Auch in den Miniaturen herrscht ein be-
stimmter Farben rhythmus. Derselbe wird sich
am leichtesten an der Hand der zweiten der
hier abgebildeten Miniaturen darthun lassen.
Der Bettvorhang des Hauptbildes und des
obersten Nebenbildes, das Bett der zweiten
Nebenscene und der Todtengräber in einer der
untern sind roth. Diesem Roth steht Blau
gegenüber im Kleide der knieenden Frau und
im Fenster des Hauptbildes, in der Bettdecke des
obersten und im Vorhang des zweiten Neben-
bildes; es tönt in der Luft des untersten aus.
Zwischen Roth und Blau stehen zwei helle
Farben: Weifs und lichtes Violett. Letz-
teres ist, mit Gold gehöht, benutzt: im Haupt-
bilde für die Bettdecke und die Kleidung des
die Kerze tragenden Dieners, in der zweiten
Nebenscene für das Kleid der nähenden Frau,
in der letzten für das des Priesters. Verwandt
ist mit dieser Farbe der Ton des dunkeln
Habits der die Bahre tragenden Mönche.
Weifs sind die Leintücher des Bettes, die
Decke, worauf das Ciborium steht, eine Wand
des Zimmers, die Oberkleider der Kleriker, der
Hauptschleier der Frauen, die Umhüllung der
Leiche und andere kleine Gegenstände. Gold
umrahmt die Bilder; ein ihm nahestehender
Farbton ist für den Boden verwandt. Wie oben
das Roth des Betthimmels aus dem Hauptbilde
in die erste Nebenscene herübergeht, so ist die
zweite durch Farbe und Musterung des Bodens
mit dem untern Theil jenes Hauptbildes vereint.
Durch diese doppelte Farbenverbindung ist die
über der Schrift stehende obere Hälfte zusammen-,
gefafst. Entsprechend geht unten die grüne Farbe
des Bodens durch die beiden letzten Bildchen.
Der Gesammteindruck der Farbenskala ergibt
demnach unten: auf grünem Boden Weifs und
Grau; in der Mitte: auf gelbem Grunde Blau,
helles Violett und Weifs; oben: Roth mit Gold.
In den meisten Miniaturen hat der Maler
einer in der Mitte stehenden Hauptfigur ein
blaues Kleid gegeben. Marias Kleid und Mantel
sind immer blau. Dies Blau ist mit Schwarz, fast
nie mit Gold, schattirt. Da Gold auch in Grün
und Weifs nicht vorkommt, so zerfallen die
Farben in zwei Reihen, deren erstere Blau,
Grün und Weifs mit schwarzer oder
dunkeler Schattirung enthält, während in
der zweiten leichtes Roth, helles Violett und
Grün mit Gold gehöht vertreten sind.
Ein lichter, feiner Ton beherrscht das ganze
Prachtwerk, worin nicht weniger als 48 Mi-
niaturen vertheilt sind; 24 im Kalender, 17 oben
beschriebene grofse, eben soviel kleinere mit
Bildchen der Heiligen bei den an sie gerich-
teten Gebeten. Rechnet man dazu noch die
406 Randleisten, so wird nicht geleugnet werden
können, dafs ein solches Meisterwerk eines ein-
gehenden Studiums wohl werth ist.
Fügen wir zum Schlüsse bei, dafs in den
Säumen der Kleider und der Teppiche oft In-
schriften vorkommen. So liest man in der an
zweiter Stelle abgebildeten Miniatur oben am
Betthimmel des Sterbenden den Satz aus dem
Todtenofficium: „Dilexi, q(uonia)m exaudicl
d(omi)n(u)s vocem." Im Stoffe, welcher den
Sessel in der ersten abgebildeten Miniatur be-
deckt, ist oben eingewirkt: EVSOME. In
andern Stoffen liest man: ONE OR VE; CHE-
ORNE; ENO ra^Vendlich EONVE. Schwer-
lich wird solchen Inschriften ein Sinn unterlegt
werden dürfen; sie scheinen nur als Verzierun-
gen angebracht zu sein.
S t eph. Beisse I S. |.
J889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
88
mit rothen. Oft sind die blau-goldenen Laub-
verzierungen durch bunte, meist hellfarbige
Vögel, Insekten, Schmetterlinge und Käfer, die
alle von trefflicher Naturbeobachtung zeugen,
belebt. Die vergoldeten Stellen sind dagegen
mit grünen Blättern und blauen, rothen oder
in Lila gefärbten Blumen besetzt, und zwar so,
dafs hier nicht Stilisirung der Pflanzentheile,
sondern möglichste Naturwahrheit erstrebt wird.
Als Grundtöne dienen hier immer Weifs
mit Blau und Gold, dort Gold mit Grün und
Roth oder Blau.
Die Schrift, bestehend aus kräftigen, schwar-
zen Minuskeln, hat viele Anfangsbuchstaben in
Blau mit weifser Schattirung auf Glanzgold oder
in Glanzgold auf rothem und blauem, weifs
schattirtem Grund. Dies Glanzgold der Buch-
staben überbietet mit Erfolg die matte Vergol-
dung in den Randleisten. Wo die Schrift eine
Linie nicht ausfüllte, legte der Miniator Streifen
auf blauem oder lilaartigem Grunde mit weifser
Zeichnung und goldenen Punkten oder Figür-
chen ein.
Weil dies System mit Konsequenz festgehal-
ten wird, bleibt das Buch trotz des Wechsels in
seinen Verzierungen — nicht zwei Seiten sind in
gleicher Art behandelt — ruhig und einheitlich.
Auch in den Miniaturen herrscht ein be-
stimmter Farben rhythmus. Derselbe wird sich
am leichtesten an der Hand der zweiten der
hier abgebildeten Miniaturen darthun lassen.
Der Bettvorhang des Hauptbildes und des
obersten Nebenbildes, das Bett der zweiten
Nebenscene und der Todtengräber in einer der
untern sind roth. Diesem Roth steht Blau
gegenüber im Kleide der knieenden Frau und
im Fenster des Hauptbildes, in der Bettdecke des
obersten und im Vorhang des zweiten Neben-
bildes; es tönt in der Luft des untersten aus.
Zwischen Roth und Blau stehen zwei helle
Farben: Weifs und lichtes Violett. Letz-
teres ist, mit Gold gehöht, benutzt: im Haupt-
bilde für die Bettdecke und die Kleidung des
die Kerze tragenden Dieners, in der zweiten
Nebenscene für das Kleid der nähenden Frau,
in der letzten für das des Priesters. Verwandt
ist mit dieser Farbe der Ton des dunkeln
Habits der die Bahre tragenden Mönche.
Weifs sind die Leintücher des Bettes, die
Decke, worauf das Ciborium steht, eine Wand
des Zimmers, die Oberkleider der Kleriker, der
Hauptschleier der Frauen, die Umhüllung der
Leiche und andere kleine Gegenstände. Gold
umrahmt die Bilder; ein ihm nahestehender
Farbton ist für den Boden verwandt. Wie oben
das Roth des Betthimmels aus dem Hauptbilde
in die erste Nebenscene herübergeht, so ist die
zweite durch Farbe und Musterung des Bodens
mit dem untern Theil jenes Hauptbildes vereint.
Durch diese doppelte Farbenverbindung ist die
über der Schrift stehende obere Hälfte zusammen-,
gefafst. Entsprechend geht unten die grüne Farbe
des Bodens durch die beiden letzten Bildchen.
Der Gesammteindruck der Farbenskala ergibt
demnach unten: auf grünem Boden Weifs und
Grau; in der Mitte: auf gelbem Grunde Blau,
helles Violett und Weifs; oben: Roth mit Gold.
In den meisten Miniaturen hat der Maler
einer in der Mitte stehenden Hauptfigur ein
blaues Kleid gegeben. Marias Kleid und Mantel
sind immer blau. Dies Blau ist mit Schwarz, fast
nie mit Gold, schattirt. Da Gold auch in Grün
und Weifs nicht vorkommt, so zerfallen die
Farben in zwei Reihen, deren erstere Blau,
Grün und Weifs mit schwarzer oder
dunkeler Schattirung enthält, während in
der zweiten leichtes Roth, helles Violett und
Grün mit Gold gehöht vertreten sind.
Ein lichter, feiner Ton beherrscht das ganze
Prachtwerk, worin nicht weniger als 48 Mi-
niaturen vertheilt sind; 24 im Kalender, 17 oben
beschriebene grofse, eben soviel kleinere mit
Bildchen der Heiligen bei den an sie gerich-
teten Gebeten. Rechnet man dazu noch die
406 Randleisten, so wird nicht geleugnet werden
können, dafs ein solches Meisterwerk eines ein-
gehenden Studiums wohl werth ist.
Fügen wir zum Schlüsse bei, dafs in den
Säumen der Kleider und der Teppiche oft In-
schriften vorkommen. So liest man in der an
zweiter Stelle abgebildeten Miniatur oben am
Betthimmel des Sterbenden den Satz aus dem
Todtenofficium: „Dilexi, q(uonia)m exaudicl
d(omi)n(u)s vocem." Im Stoffe, welcher den
Sessel in der ersten abgebildeten Miniatur be-
deckt, ist oben eingewirkt: EVSOME. In
andern Stoffen liest man: ONE OR VE; CHE-
ORNE; ENO ra^Vendlich EONVE. Schwer-
lich wird solchen Inschriften ein Sinn unterlegt
werden dürfen; sie scheinen nur als Verzierun-
gen angebracht zu sein.
S t eph. Beisse I S. |.