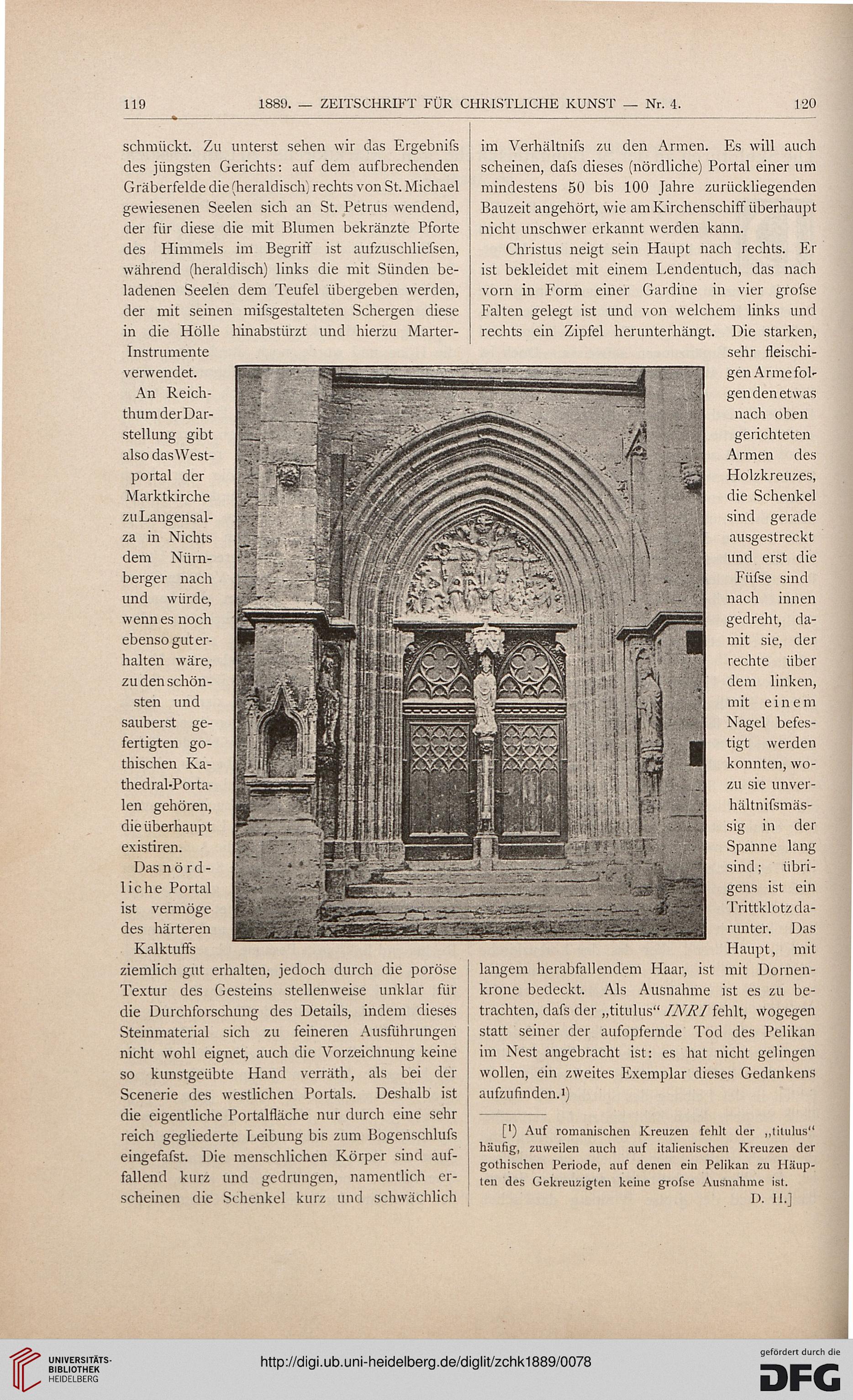119
1889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
120
schmückt. Zu Unterst sehen wir das Ergebnifs
des jüngsten Gerichts: auf dem aufbrechenden
Gräberfelde die (heraldisch) rechts von St. Michael
gewiesenen Seelen sich an St. Petrus wendend,
der für diese die mit Blumen bekränzte Pforte
des Himmels im Begriff ist aufzuschliefsen,
während (heraldisch) links die mit Sünden be-
ladenen Seelen dem Teufel übergeben werden,
der mit seinen mifsgestalteten Schergen diese
in die Hölle hinabstürzt und hierzu Marter-
Instrumente
verwendet.
An Reich-
thumderDar-
stellung gibt
also das West-
portal der
Marktkirche
zu Langensal-
za in Nichts
dem Nürn-
berger nach
und würde,
wenn es noch
ebenso gut er-
halten wäre,
zu den schön-
sten und
säuberst ge-
fertigten go-
thischen Ka-
thedral-Porta-
len gehören,
die überhaupt
existiren.
Das nörd-
liche Portal
ist vermöge
des härteren
Kalktuffs
ziemlich gut erhalten, jedoch durch die poröse
Textur des Gesteins stellenweise unklar für
die Durchforschung des Details, indem dieses
Steinmaterial sich zu feineren Ausführungen
nicht wohl eignet, auch die Vorzeichnung keine
so kunstgeübte Hand verräth, als bei der
Scenerie des westlichen Portals. Deshalb ist
die eigentliche Portalfläche nur durch eine sehr
reich gegliederte Leibung bis zum Bogenschlufs
eingefafst. Die menschlichen Körper sind auf-
fallend kurz und gedrungen, namentlich er-
scheinen die Schenkel kurz und schwächlich
im Verhältnifs zu den Armen. Es will auch
scheinen, dafs dieses (nördliche) Portal einer um
mindestens 50 bis 100 Jahre zurückliegenden
Bauzeit angehört, wie am Kirchenschiff überhaupt
nicht unschwer erkannt werden kann.
Christus neigt sein Haupt nach rechts. Er
ist bekleidet mit einem Lendentuch, das nach
vorn in Form einer Gardine in vier grofse
Falten gelegt ist und von welchem links und
rechts ein Zipfel herunterhängt. Die starken,
sehr fleischi-
gen Arme fol'
gen den etwas
nach oben
gerichteten
Armen des
Holzkreuzes,
die Schenkel
sind gerade
ausgestreckt
und erst die
Füfse sind
nach innen
gedreht, da-
mit sie, der
rechte über
dem linken,
mit einem
Nagel befes-
tigt werden
konnten, wo-
zu sie unver-
hältnifsmäs-
sig in der
Spanne lang
sind; übri-
gens ist ein
Trittklotz da-
runter. Das
Haupt, mit
langem herabfallendem Haar, ist mit Dornen-
krone bedeckt. Als Ausnahme ist es zu be-
trachten, dafs der „titulus" INRI fehlt, wogegen
statt seiner der aufopfernde Tod des Pelikan
im Nest angebracht ist: es hat nicht gelingen
wollen, ein zweites Exemplar dieses Gedankens
aufzufinden.1)
[') Auf romanischen Kreuzen fehlt der „titulus"
häufig, zuweilen auch auf italienischen Kreuzen der
gothischen Periode, auf denen ein Pelikan zu Häup-
ten des Gekreuzigten keine grofse Ausnahme ist.
D. 11.]
1889.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
120
schmückt. Zu Unterst sehen wir das Ergebnifs
des jüngsten Gerichts: auf dem aufbrechenden
Gräberfelde die (heraldisch) rechts von St. Michael
gewiesenen Seelen sich an St. Petrus wendend,
der für diese die mit Blumen bekränzte Pforte
des Himmels im Begriff ist aufzuschliefsen,
während (heraldisch) links die mit Sünden be-
ladenen Seelen dem Teufel übergeben werden,
der mit seinen mifsgestalteten Schergen diese
in die Hölle hinabstürzt und hierzu Marter-
Instrumente
verwendet.
An Reich-
thumderDar-
stellung gibt
also das West-
portal der
Marktkirche
zu Langensal-
za in Nichts
dem Nürn-
berger nach
und würde,
wenn es noch
ebenso gut er-
halten wäre,
zu den schön-
sten und
säuberst ge-
fertigten go-
thischen Ka-
thedral-Porta-
len gehören,
die überhaupt
existiren.
Das nörd-
liche Portal
ist vermöge
des härteren
Kalktuffs
ziemlich gut erhalten, jedoch durch die poröse
Textur des Gesteins stellenweise unklar für
die Durchforschung des Details, indem dieses
Steinmaterial sich zu feineren Ausführungen
nicht wohl eignet, auch die Vorzeichnung keine
so kunstgeübte Hand verräth, als bei der
Scenerie des westlichen Portals. Deshalb ist
die eigentliche Portalfläche nur durch eine sehr
reich gegliederte Leibung bis zum Bogenschlufs
eingefafst. Die menschlichen Körper sind auf-
fallend kurz und gedrungen, namentlich er-
scheinen die Schenkel kurz und schwächlich
im Verhältnifs zu den Armen. Es will auch
scheinen, dafs dieses (nördliche) Portal einer um
mindestens 50 bis 100 Jahre zurückliegenden
Bauzeit angehört, wie am Kirchenschiff überhaupt
nicht unschwer erkannt werden kann.
Christus neigt sein Haupt nach rechts. Er
ist bekleidet mit einem Lendentuch, das nach
vorn in Form einer Gardine in vier grofse
Falten gelegt ist und von welchem links und
rechts ein Zipfel herunterhängt. Die starken,
sehr fleischi-
gen Arme fol'
gen den etwas
nach oben
gerichteten
Armen des
Holzkreuzes,
die Schenkel
sind gerade
ausgestreckt
und erst die
Füfse sind
nach innen
gedreht, da-
mit sie, der
rechte über
dem linken,
mit einem
Nagel befes-
tigt werden
konnten, wo-
zu sie unver-
hältnifsmäs-
sig in der
Spanne lang
sind; übri-
gens ist ein
Trittklotz da-
runter. Das
Haupt, mit
langem herabfallendem Haar, ist mit Dornen-
krone bedeckt. Als Ausnahme ist es zu be-
trachten, dafs der „titulus" INRI fehlt, wogegen
statt seiner der aufopfernde Tod des Pelikan
im Nest angebracht ist: es hat nicht gelingen
wollen, ein zweites Exemplar dieses Gedankens
aufzufinden.1)
[') Auf romanischen Kreuzen fehlt der „titulus"
häufig, zuweilen auch auf italienischen Kreuzen der
gothischen Periode, auf denen ein Pelikan zu Häup-
ten des Gekreuzigten keine grofse Ausnahme ist.
D. 11.]