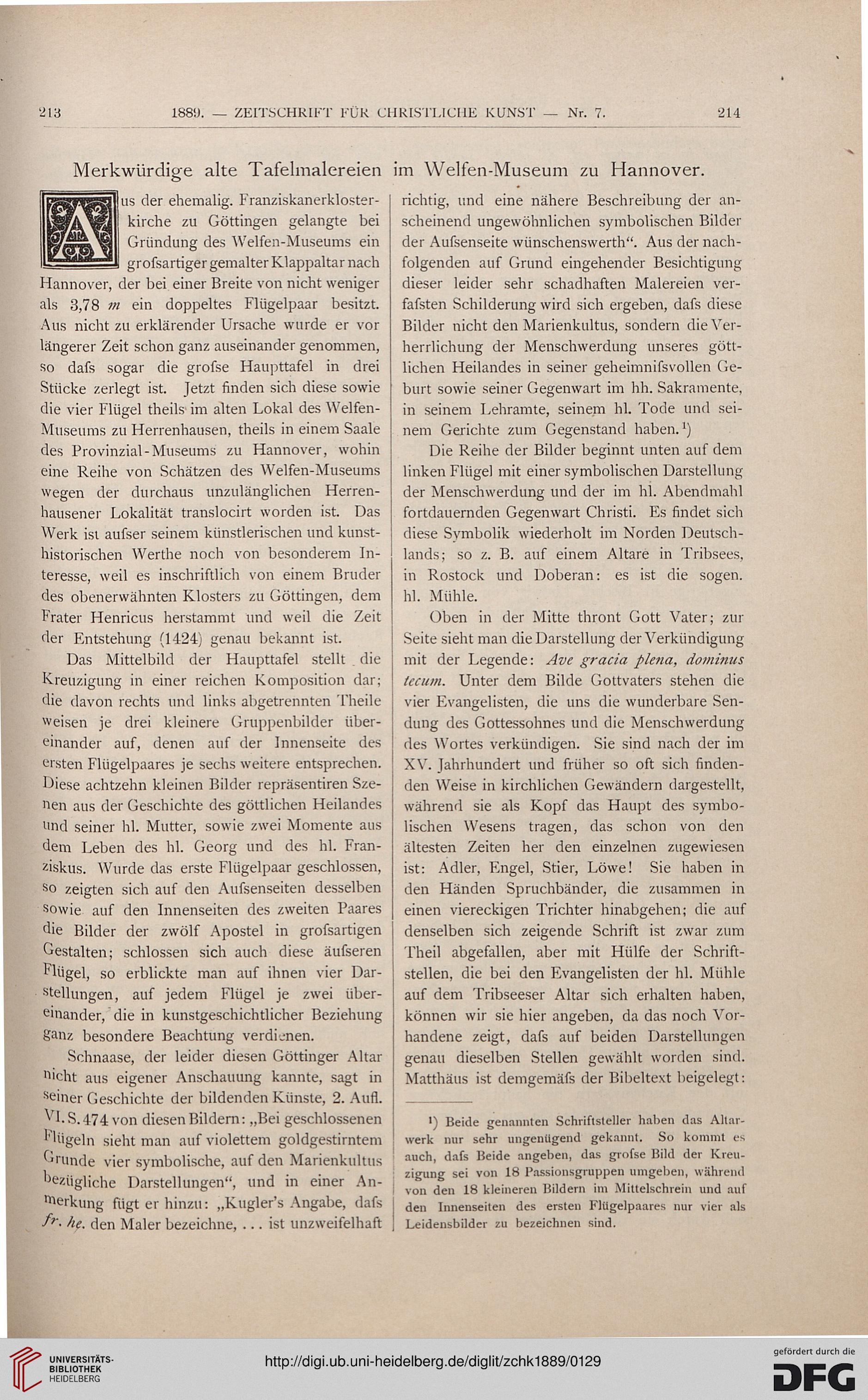213
1881). — ZEITSCHRIFT FÜR CHRIS TUCHE KUNST — Nr. 7.
214
Merkwürdige alte Tafelmalereien
us der ehemalig. P'ranziskanerkloster-
kirche zu Göttingen gelangte bei
Gründung des Weifen-Museums ein
grofsartiger gemalter Klappaltar nach
Hannover, der bei einer Breite von nicht weniger
als 3,78 m ein doppeltes Flügelpaar besitzt.
Aus nicht zu erklärender Ursache wurde er vor
längerer Zeit schon ganz auseinander genommen,
so dafs sogar die grofse Haupttafel in drei
Stücke zerlegt ist. Jetzt finden sich diese sowie
die vier Flügel theils im alten Lokal des Weifen-
Museums zu Herrenhausen, theils in einem Saale
des Provinzial-Museums zu Hannover, wohin
eine Reihe von Schätzen des Weifen-Museums
wegen der durchaus unzulänglichen Herren-
hausener Lokalität translocirt worden ist. Das
Werk ist aufser seinem künstlerischen und kunst-
historischen Werthe noch von besonderem In-
teresse, weil es inschriftlich von einem Bruder
des obenerwähnten Klosters zu Göttingen, dem
Frater Henricus herstammt und weil die Zeit
der Entstehung (1424) genau bekannt ist.
Das Mittelbild der Haupttafel stellt die
Kreuzigung in einer reichen Komposition dar;
die davon rechts und links abgetrennten Theile
weisen je drei kleinere Gruppenbilder über-
einander auf, denen auf der Innenseite des
ersten Flügelpaares je sechs weitere entsprechen.
Diese achtzehn kleinen Bilder repräsentiren Sze-
nen aus der Geschichte des göttlichen Heilandes
Und seiner hl. Mutter, sowie zwei Momente aus
dem Leben des hl. Georg und des hl. Fran-
ziskus. Wurde das erste Flügelpaar geschlossen,
so zeigten sich auf den Aufsenseiten desselben
sowie auf den Innenseiten des zweiten Paares
die Bilder der zwölf Apostel in grofsartigen
Gestalten; schlössen sich auch diese aufseien
l'lügel, so erblickte man auf ihnen vier Dar-
stellungen, auf jedem Flügel je zwei über-
einander, die in kunstgeschichtlicher Beziehung
ganz besondere Beachtung verdienen.
Schnaase, der leider diesen Göttinger Altar
n'cht aus eigener Anschauung kannte, sagt in
seiner Geschichte der bildenden Künste, 2. Aufl.
VI. S. 474 von diesen Bildern: „Bei geschlossenen
''lügein sieht man auf violettem goldgestirntem
Gründe vier symbolische, auf den Marienkultus
bezügliche Darstellungen", und in einer An-
merkung fügt er hinzu: „Kugler's Angabe, dafs
fr- he. den Maler bezeichne, ... ist unzweifelhaft
im Weifen-Museum zu Hannover.
richtig, und eine nähere Beschreibung der an-
scheinend ungewöhnlichen symbolischen Bilder
der Aufsenseite wünschenswerth". Aus der nach-
folgenden auf Grund eingehender Besichtigung
dieser leider sehr schadhaften Malereien ver-
fafsten Schilderung wird sich ergeben, dafs diese
Bilder nicht den Marienkultus, sondern die Ver-
herrlichung der Menschwerdung unseres gött-
lichen Heilandes in seiner geheimnifsvollen Ge-
burt sowie seiner Gegenwart im hh. Sakramente,
in seinem Lehramte, seinem hl. Tode und sei-
nem Gerichte zum Gegenstand haben.1)
Die Reihe der Bilder beginnt unten auf dem
linken Flügel mit einer symbolischen Darstellung
der Menschwerdung und der im hl. Abendmahl
fortdauernden Gegenwart Christi. Es findet sich
diese Symbolik wiederholt im Norden Deutsch-
lands; so z. B. auf einem Altare in Tribsees,
in Rostock und Doberan: es ist die sogen,
hl. Mühle.
Oben in der Mitte thront Gott Vater; zur
Seite sieht man die Darstellung der Verkündigung
mit der Legende: Ave gracia plena, dominus
tecum. Unter dem Bilde Gottvaters stehen die
vier Evangelisten, die uns die wunderbare Sen-
dung des Gottessohnes und die Menschwerdung
des Wortes verkündigen. Sie sind nach der im
XV. Jahrhundert und früher so oft sich finden-
den Weise in kirchlichen Gewändern dargestellt,
während sie als Kopf das Haupt des symbo-
lischen Wesens tragen, das schon von den
ältesten Zeiten her den einzelnen zugewiesen
ist: Adler, Engel, Stier, Löwe! Sie haben in
den Händen Spruchbänder, die zusammen in
einen viereckigen Trichter hinabgehen; die auf
denselben sich zeigende Schrift ist zwar zum
Theil abgefallen, aber mit Hülfe der Schrift-
stellen, die bei den Evangelisten der hl. Mühle
auf dem Tribseeser Altar sich erhalten haben,
können wir sie hier angeben, da das noch Vor-
handene zeigt, dafs auf beiden Darstellungen
genau dieselben Stellen gewählt worden sind.
Matthäus ist demgemäfs der Bibeltext beigelegt:
') Beide genannten Schriftsteller haben das Allar-
werk nur sehr ungenügend gekannt. So kommt es
auch, dafs Beide angeben, das grofse Bild der Kreu-
zigung sei von 18 Passionsgruppen umgeben, während
von den 18 kleineren Bildern im Mittelschrein und auf
den Innenseiten des ersten Flügelpaares nur vier als
Leidensbilder zu bezeichnen sind.
1881). — ZEITSCHRIFT FÜR CHRIS TUCHE KUNST — Nr. 7.
214
Merkwürdige alte Tafelmalereien
us der ehemalig. P'ranziskanerkloster-
kirche zu Göttingen gelangte bei
Gründung des Weifen-Museums ein
grofsartiger gemalter Klappaltar nach
Hannover, der bei einer Breite von nicht weniger
als 3,78 m ein doppeltes Flügelpaar besitzt.
Aus nicht zu erklärender Ursache wurde er vor
längerer Zeit schon ganz auseinander genommen,
so dafs sogar die grofse Haupttafel in drei
Stücke zerlegt ist. Jetzt finden sich diese sowie
die vier Flügel theils im alten Lokal des Weifen-
Museums zu Herrenhausen, theils in einem Saale
des Provinzial-Museums zu Hannover, wohin
eine Reihe von Schätzen des Weifen-Museums
wegen der durchaus unzulänglichen Herren-
hausener Lokalität translocirt worden ist. Das
Werk ist aufser seinem künstlerischen und kunst-
historischen Werthe noch von besonderem In-
teresse, weil es inschriftlich von einem Bruder
des obenerwähnten Klosters zu Göttingen, dem
Frater Henricus herstammt und weil die Zeit
der Entstehung (1424) genau bekannt ist.
Das Mittelbild der Haupttafel stellt die
Kreuzigung in einer reichen Komposition dar;
die davon rechts und links abgetrennten Theile
weisen je drei kleinere Gruppenbilder über-
einander auf, denen auf der Innenseite des
ersten Flügelpaares je sechs weitere entsprechen.
Diese achtzehn kleinen Bilder repräsentiren Sze-
nen aus der Geschichte des göttlichen Heilandes
Und seiner hl. Mutter, sowie zwei Momente aus
dem Leben des hl. Georg und des hl. Fran-
ziskus. Wurde das erste Flügelpaar geschlossen,
so zeigten sich auf den Aufsenseiten desselben
sowie auf den Innenseiten des zweiten Paares
die Bilder der zwölf Apostel in grofsartigen
Gestalten; schlössen sich auch diese aufseien
l'lügel, so erblickte man auf ihnen vier Dar-
stellungen, auf jedem Flügel je zwei über-
einander, die in kunstgeschichtlicher Beziehung
ganz besondere Beachtung verdienen.
Schnaase, der leider diesen Göttinger Altar
n'cht aus eigener Anschauung kannte, sagt in
seiner Geschichte der bildenden Künste, 2. Aufl.
VI. S. 474 von diesen Bildern: „Bei geschlossenen
''lügein sieht man auf violettem goldgestirntem
Gründe vier symbolische, auf den Marienkultus
bezügliche Darstellungen", und in einer An-
merkung fügt er hinzu: „Kugler's Angabe, dafs
fr- he. den Maler bezeichne, ... ist unzweifelhaft
im Weifen-Museum zu Hannover.
richtig, und eine nähere Beschreibung der an-
scheinend ungewöhnlichen symbolischen Bilder
der Aufsenseite wünschenswerth". Aus der nach-
folgenden auf Grund eingehender Besichtigung
dieser leider sehr schadhaften Malereien ver-
fafsten Schilderung wird sich ergeben, dafs diese
Bilder nicht den Marienkultus, sondern die Ver-
herrlichung der Menschwerdung unseres gött-
lichen Heilandes in seiner geheimnifsvollen Ge-
burt sowie seiner Gegenwart im hh. Sakramente,
in seinem Lehramte, seinem hl. Tode und sei-
nem Gerichte zum Gegenstand haben.1)
Die Reihe der Bilder beginnt unten auf dem
linken Flügel mit einer symbolischen Darstellung
der Menschwerdung und der im hl. Abendmahl
fortdauernden Gegenwart Christi. Es findet sich
diese Symbolik wiederholt im Norden Deutsch-
lands; so z. B. auf einem Altare in Tribsees,
in Rostock und Doberan: es ist die sogen,
hl. Mühle.
Oben in der Mitte thront Gott Vater; zur
Seite sieht man die Darstellung der Verkündigung
mit der Legende: Ave gracia plena, dominus
tecum. Unter dem Bilde Gottvaters stehen die
vier Evangelisten, die uns die wunderbare Sen-
dung des Gottessohnes und die Menschwerdung
des Wortes verkündigen. Sie sind nach der im
XV. Jahrhundert und früher so oft sich finden-
den Weise in kirchlichen Gewändern dargestellt,
während sie als Kopf das Haupt des symbo-
lischen Wesens tragen, das schon von den
ältesten Zeiten her den einzelnen zugewiesen
ist: Adler, Engel, Stier, Löwe! Sie haben in
den Händen Spruchbänder, die zusammen in
einen viereckigen Trichter hinabgehen; die auf
denselben sich zeigende Schrift ist zwar zum
Theil abgefallen, aber mit Hülfe der Schrift-
stellen, die bei den Evangelisten der hl. Mühle
auf dem Tribseeser Altar sich erhalten haben,
können wir sie hier angeben, da das noch Vor-
handene zeigt, dafs auf beiden Darstellungen
genau dieselben Stellen gewählt worden sind.
Matthäus ist demgemäfs der Bibeltext beigelegt:
') Beide genannten Schriftsteller haben das Allar-
werk nur sehr ungenügend gekannt. So kommt es
auch, dafs Beide angeben, das grofse Bild der Kreu-
zigung sei von 18 Passionsgruppen umgeben, während
von den 18 kleineren Bildern im Mittelschrein und auf
den Innenseiten des ersten Flügelpaares nur vier als
Leidensbilder zu bezeichnen sind.