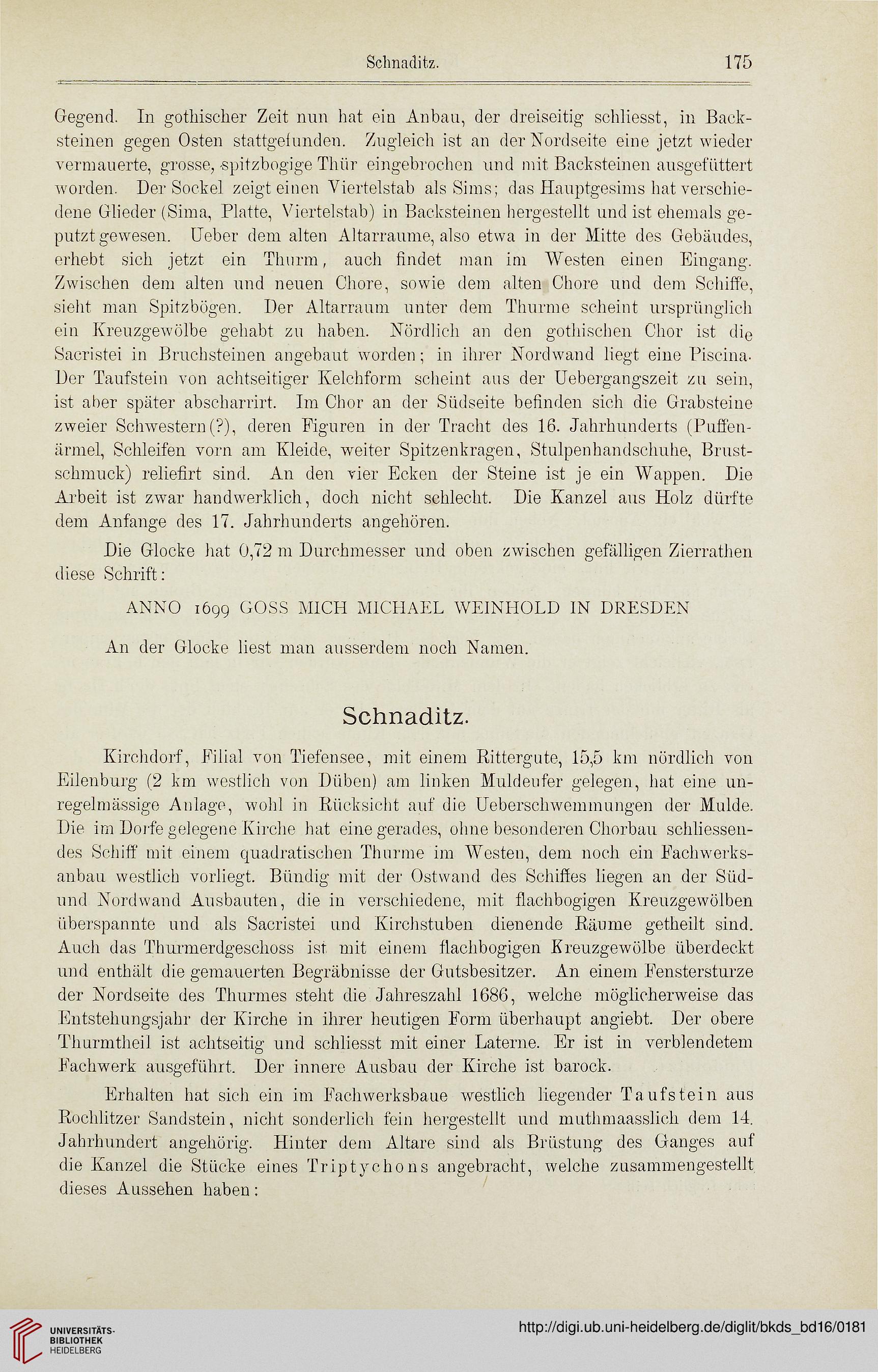Schnaditz.
175
Gegend. In gothischer Zeit nun hat ein Anbau, der dreiseitig schtiesst, in Back-
steinen gegen Osten stattgeiunden. Zugleich ist an der Nordseite eine jetzt wieder
vermauerte, grosse,-spitzbogige Thür cingebrochcn und mit Backsteinen ausgefüttert
worden. Der Sockel zeigt einen Viertelstab als Sims; das Hauptgesims hat verschie-
dene Glieder (Sima, Platte, Viertelstab) in Backsteinen tiergestellt und ist ehemals ge-
putzt gewesen. Geber dem alten Altarraume, also etwa in der Mitte des Gebäudes,
erhebt sich jetzt ein Thurm, auch findet man im Westen einen Eingang.
Zwischen dem alten und neuen Chore, sowie dem alten Chore und dem Schiffe,
sietit man Spitzbögen. Der Altarraum unter dem Thurme scheint ursprünglich
ein Kreuzgewölbe gehabt zu haben. Nördlich an den gothischen Chor ist die
Sacristei in Bruchsteinen angebaut worden; in ihrer Nordwand liegt eine Piscina-
Der Taufstein von achtseitiger Kelchform scheint aus der Uebergangszeit zu sein,
ist aber später abscharrirt. Im Chor an der Südseite befinden sich die Grabsteine
zweier Schwestern(?), deren Figuren in der Tracht des 16. Jahrhunderts (Puffcn-
ärmel, Schleifen vorn am Kleide, weiter Spitzenkragen, Stulpenhandschuhe, Brust-
schmuck) reliefirt sind. An den vier Ecken der Steine ist je ein Wappen. Die
Arbeit ist zwar handwerklich, doch nicht schlecht. Die Kanzel aus Holz dürfte
dem Anfänge des 17. Jahrhunderts angehören.
Die Glocke hat 0,72 m Durchmesser und oben zwischen gefälligen Zierrathen
diese Schrift:
ANNO 1699 GOSS MICH MICHAEL WEINHOLD IN DRESDEN
An der Glocke liest man ausserdem noch Namen.
Schnaditz.
Kirchdorf, Filial von Tiefensee, mit einem Rittergute, 15,5 km nördlich von
Eilenburg (2 km westlich von Düben) am linken Muldeofer gelegen, hat eine un-
regelmässige Anlage, wohl in Rücksicht auf die Ueberschwemmungen der Mulde.
Die im Dorfe gelegene Kirche hat eine gerades, ohne besonderen Chorbau schliessen-
des Schiff mit einem quadratischen Therme im Westen, dem noch ein Fachwerks-
anbau westlich vorliegt. Bündig mit der Ostwatul des Schifies liegen an der Süd-
und Nordwand Ausbauten, die in verschiedene, mit flachbogigen Kreuzgewölben
überspannte und als Sacristei und Kirchstuben dienende Räume getheilt sind.
Auch das Thurmerdgeschoss ist mit einem flachbogigen Kreuzgewölbe überdeckt
und enthält die gemauerten Begräbnisse der Gutsbesitzer. An einem Fenstersturze
der Nordseite des Thurmes steht die Jahreszahl 1686, welche möglicherweise das
Entstehungsjahr der Kirche in ihrer heutigen Form überhaupt angiebt. Der obere
Thurmtlieil ist achtseitig und schliesst mit einer Laterne. Er ist in verblendetem
Fachwerk ausgeführt. Der innere Ausbau der Kirche ist barock.
Erhalten hat sich ein im Fachwerksbaue westlich liegender Taufstein aus
Rochlitzer Sandstein, nicht sonderlich fein hergesteilt und rnuthmaasslich dem 14.
Jahrhundert angehörig. Hinter dem Altäre sind als Brüstung des Ganges auf
die Kanzel die Stücke eines Triptychons angebracht, welche zusammengestellt
dieses Aussehen haben:
175
Gegend. In gothischer Zeit nun hat ein Anbau, der dreiseitig schtiesst, in Back-
steinen gegen Osten stattgeiunden. Zugleich ist an der Nordseite eine jetzt wieder
vermauerte, grosse,-spitzbogige Thür cingebrochcn und mit Backsteinen ausgefüttert
worden. Der Sockel zeigt einen Viertelstab als Sims; das Hauptgesims hat verschie-
dene Glieder (Sima, Platte, Viertelstab) in Backsteinen tiergestellt und ist ehemals ge-
putzt gewesen. Geber dem alten Altarraume, also etwa in der Mitte des Gebäudes,
erhebt sich jetzt ein Thurm, auch findet man im Westen einen Eingang.
Zwischen dem alten und neuen Chore, sowie dem alten Chore und dem Schiffe,
sietit man Spitzbögen. Der Altarraum unter dem Thurme scheint ursprünglich
ein Kreuzgewölbe gehabt zu haben. Nördlich an den gothischen Chor ist die
Sacristei in Bruchsteinen angebaut worden; in ihrer Nordwand liegt eine Piscina-
Der Taufstein von achtseitiger Kelchform scheint aus der Uebergangszeit zu sein,
ist aber später abscharrirt. Im Chor an der Südseite befinden sich die Grabsteine
zweier Schwestern(?), deren Figuren in der Tracht des 16. Jahrhunderts (Puffcn-
ärmel, Schleifen vorn am Kleide, weiter Spitzenkragen, Stulpenhandschuhe, Brust-
schmuck) reliefirt sind. An den vier Ecken der Steine ist je ein Wappen. Die
Arbeit ist zwar handwerklich, doch nicht schlecht. Die Kanzel aus Holz dürfte
dem Anfänge des 17. Jahrhunderts angehören.
Die Glocke hat 0,72 m Durchmesser und oben zwischen gefälligen Zierrathen
diese Schrift:
ANNO 1699 GOSS MICH MICHAEL WEINHOLD IN DRESDEN
An der Glocke liest man ausserdem noch Namen.
Schnaditz.
Kirchdorf, Filial von Tiefensee, mit einem Rittergute, 15,5 km nördlich von
Eilenburg (2 km westlich von Düben) am linken Muldeofer gelegen, hat eine un-
regelmässige Anlage, wohl in Rücksicht auf die Ueberschwemmungen der Mulde.
Die im Dorfe gelegene Kirche hat eine gerades, ohne besonderen Chorbau schliessen-
des Schiff mit einem quadratischen Therme im Westen, dem noch ein Fachwerks-
anbau westlich vorliegt. Bündig mit der Ostwatul des Schifies liegen an der Süd-
und Nordwand Ausbauten, die in verschiedene, mit flachbogigen Kreuzgewölben
überspannte und als Sacristei und Kirchstuben dienende Räume getheilt sind.
Auch das Thurmerdgeschoss ist mit einem flachbogigen Kreuzgewölbe überdeckt
und enthält die gemauerten Begräbnisse der Gutsbesitzer. An einem Fenstersturze
der Nordseite des Thurmes steht die Jahreszahl 1686, welche möglicherweise das
Entstehungsjahr der Kirche in ihrer heutigen Form überhaupt angiebt. Der obere
Thurmtlieil ist achtseitig und schliesst mit einer Laterne. Er ist in verblendetem
Fachwerk ausgeführt. Der innere Ausbau der Kirche ist barock.
Erhalten hat sich ein im Fachwerksbaue westlich liegender Taufstein aus
Rochlitzer Sandstein, nicht sonderlich fein hergesteilt und rnuthmaasslich dem 14.
Jahrhundert angehörig. Hinter dem Altäre sind als Brüstung des Ganges auf
die Kanzel die Stücke eines Triptychons angebracht, welche zusammengestellt
dieses Aussehen haben: