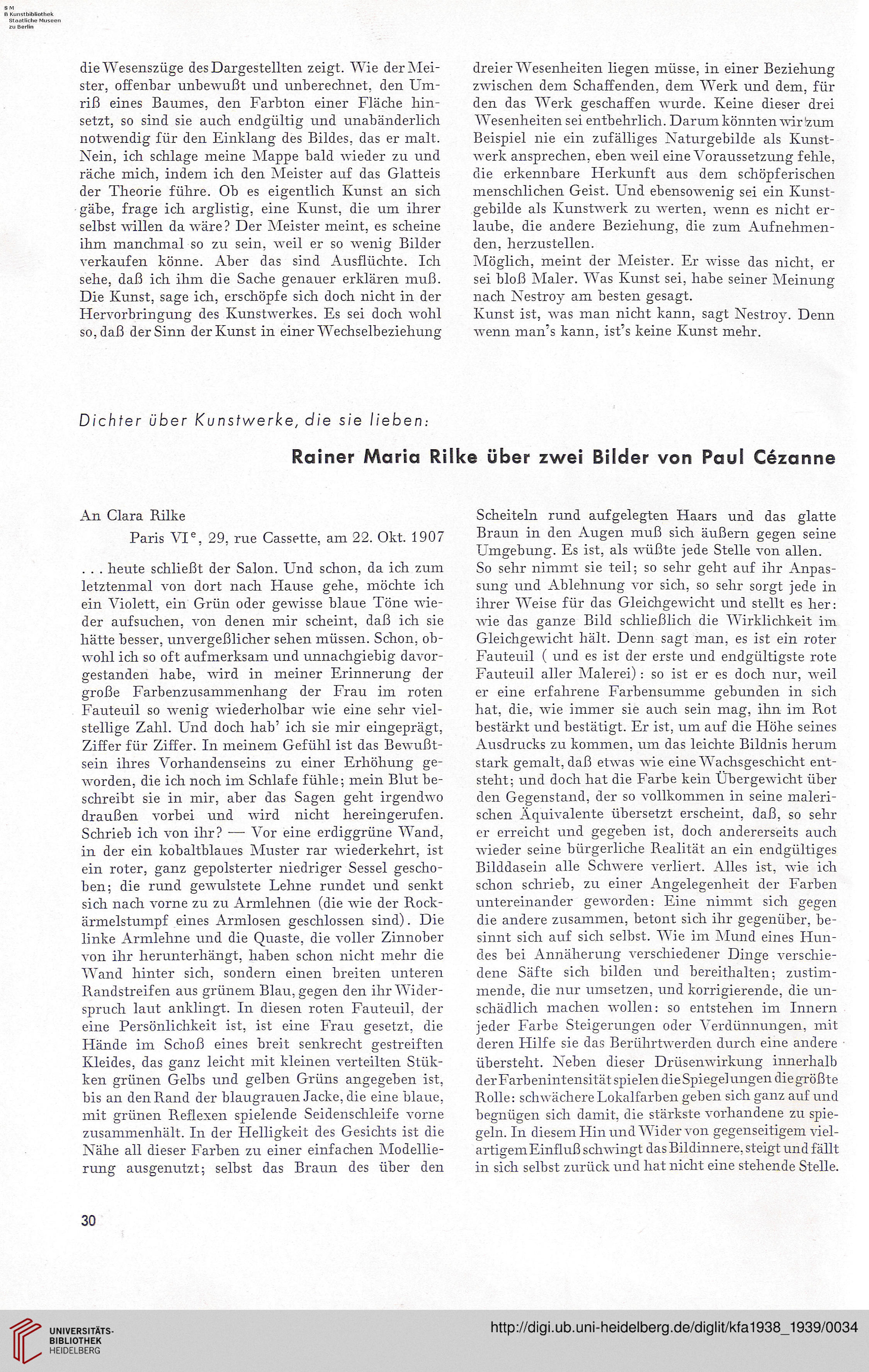die Wesenszüge des Dargestellten zeigt. Wie der Mei-
ster, offenbar unbewußt und unberechnet, den Um-
riß eines Baumes, den Farbton einer Fläche hin-
setzt, so sind sie auch endgültig und unabänderlich
notwendig für den Einklang des Bildes, das er malt.
Nein, ich schlage meine Mappe bald wieder zu und
räche mich, indem ich den Meister auf das Glatteis
der Theorie führe. Ob es eigentlich Kunst an sich
gäbe, frage ich arglistig, eine Kunst, die um ihrer
selbst willen da wäre? Der Meister meint, es scheine
ihm manchmal so zu sein, weil er so wenig Bilder
verkaufen könne. Aber das sind Ausflüchte. Ich
sehe, daß ich ihm die Sache genauer erklären muß.
Die Kunst, sage ich, erschöpfe sich doch nicht in der
Hervorbringung des Kunstwerkes. Es sei doch wohl
so, daß der Sinn der Kunst in einer Wechselbeziehung
Dichter über Ku nstwerke, die sie lieben
Rainer Maria
An Clara Rilke
Paris YIe, 29, nie Cassette, am 22. Okt. 1907
. . . heute schließt der Salon. Und schon, da ich zum
letztenmal von dort nach Hause gehe, möchte ich
ein Violett, ein Grün oder gewisse blaue Töne wie-
der aufsuchen, von denen mir scheint, daß ich sie
hätte besser, unvergeßlicher sehen müssen. Schon, ob-
wohl ich so oft aufmerksam und unnachgiebig davor-
gestanden habe, wird in meiner Erinnerung der
große Farbenzusammenhang der Frau im roten
Fauteuil so wenig wiederholbar wie eine sehr viel-
stellige Zahl. Und doch hab' ich sie mir eingeprägt,
Ziffer für Ziffer. In meinem Gefühl ist das Bewußt-
sein ihres Vorhandenseins zu einer Erhöhung ge-
worden, die ich noch im Schlafe fühle; mein Blut be-
schreibt sie in mir, aber das Sagen geht irgendwo
draußen vorbei und wird nicht hereingerufen.
Schrieb ich von ihr? — Vor eine erdiggrüne Wand,
in der ein kobaltblaues Muster rar wiederkehrt, ist
ein roter, ganz gepolsterter niedriger Sessel gescho-
ben; die rund gewulstete Lehne rundet und senkt
sich nach vorne zu zu Armlehnen (die wie der Rock-
ärmelstumpf eines Armlosen geschlossen sind). Die
linke Armlehne und die Quaste, die voller Zinnober
von ihr herunterhängt, haben schon nicht mehr die
Wand hinter sich, sondern einen breiten unteren
Randstreifen aus grünem Blau, gegen den ihr Wider-
spruch laut anklingt. In diesen roten Fauteuil, der
eine Persönlichkeit ist, ist eine Frau gesetzt, die
Hände im Schoß eines breit senkrecht gestreiften
Kleides, das ganz leicht mit kleinen verteilten Stük-
ken grünen Gelbs und gelben Grüns angegeben ist,
bis an den Rand der blaugrauen Jacke, die eine blaue,
mit grünen Reflexen spielende Seidenschleife vorne
zusammenhält. In der Helligkeit des Gesichts ist die
Nähe all dieser Farben zu einer einfachen Modellie-
rung ausgenutzt; selbst das Braun des über den
dreier Wesenheiten liegen müsse, in einer Beziehung
zwischen dem Schaffenden, dem Werk und dem, für
den das Werk geschaffen wurde. Keine dieser drei
Wesenheiten sei entbehrlich. Darum könnten wir 'zum
Beispiel nie ein zufälliges Xaturgebilde als Kunst-
werk ansprechen, eben weil eine Voraussetzung fehle,
die erkennbare Herkunft aus dem schöpferischen
menschlichen Geist. Und ebensowenig sei ein Kunst-
gebilde als Kunstwerk zu werten, wenn es nicht er-
laube, die andere Beziehung, die zum Aufnehmen-
den, herzustellen.
Möglich, meint der "Meister. Er wisse das nicht, er
sei bloß Maler. Was Kunst sei. habe seiner Meinung
nach Nestroy am besten gesagt.
Kunst ist, was man nicht kann, sagt Nestroy. Denn
wenn man's kann, ist's keine Kunst mehr.
über zwei Bilder von Paul Cezanne
Scheiteln rund aufgelegten Haars und das glatte
Braun in den Augen muß sich äußern gegen seine
Umgebung. Es ist, als wüßte jede Stelle von allen.
So sehr nimmt sie teil; so sehr geht auf ihr Anpas-
sung und Ablehnung vor sich, so sehr sorgt jede in
ihrer Weise für das Gleichgewicht und stellt es her:
wie das ganze Bild schließlich die Wirklichkeit im
Gleichgewicht hält. Denn sagt man, es ist ein roter
Fauteuil ( und es ist der erste und endgültigste rote
Fauteuil aller Malerei): so ist er es doch nur, weil
er eine erfahrene Farbensumme gebunden in sich
hat, die, wie immer sie auch sein mag, ihn im Rot
bestärkt und bestätigt. Er ist, um auf die Höhe seines
Ausdrucks zu kommen, um das leichte Bildnis herum
stark gemalt, daß etwas wie eine Wachsgeschicht ent-
steht; und doch hat die Farbe kein Ubergewicht über
den Gegenstand, der so vollkommen in seine maleri-
schen Äquivalente übersetzt erscheint, daß, so sehr
er erreicht und gegeben ist, doch andererseits auch
wieder seine bürgerliche Realität an ein endgültiges
Bilddasein alle Schwere verliert. Alles ist, wie ich
schon schrieb, zu einer Angelegenheit der Farben
untereinander geworden: Eine nimmt sich gegen
die andere zusammen, betont sich ihr gegenüber, be-
sinnt sich auf sich selbst. Wie im Mund eines Hun-
des bei Annäherung verschiedener Dinge verschie-
dene Säfte sich bilden und bereithalten; zustim-
mende, die nur umsetzen, und korrigierende, die un-
schädlich machen wollen: so entstehen im Innern
jeder Farbe Steigerungen oder Verdünnungen, mit
deren Hilfe sie das Berührtwerden durch eine andere
übersteht. Neben dieser Drüsenwirkung innerhalb
der Farbenintensität spielen die Spiegel ungen die größte
Rolle: schwächere Lokalfarben geben sich ganz auf und
begnügen sich damit, die stärkste vorhandene zu spie-
geln. In diesem Hin und Wider von gegenseitigem viel-
artigem Einfluß schwingt das Bildinnere, steigt und fällt
in sich selbst zurück und hat nicht eine stehende Stelle.
Rilke
30
ster, offenbar unbewußt und unberechnet, den Um-
riß eines Baumes, den Farbton einer Fläche hin-
setzt, so sind sie auch endgültig und unabänderlich
notwendig für den Einklang des Bildes, das er malt.
Nein, ich schlage meine Mappe bald wieder zu und
räche mich, indem ich den Meister auf das Glatteis
der Theorie führe. Ob es eigentlich Kunst an sich
gäbe, frage ich arglistig, eine Kunst, die um ihrer
selbst willen da wäre? Der Meister meint, es scheine
ihm manchmal so zu sein, weil er so wenig Bilder
verkaufen könne. Aber das sind Ausflüchte. Ich
sehe, daß ich ihm die Sache genauer erklären muß.
Die Kunst, sage ich, erschöpfe sich doch nicht in der
Hervorbringung des Kunstwerkes. Es sei doch wohl
so, daß der Sinn der Kunst in einer Wechselbeziehung
Dichter über Ku nstwerke, die sie lieben
Rainer Maria
An Clara Rilke
Paris YIe, 29, nie Cassette, am 22. Okt. 1907
. . . heute schließt der Salon. Und schon, da ich zum
letztenmal von dort nach Hause gehe, möchte ich
ein Violett, ein Grün oder gewisse blaue Töne wie-
der aufsuchen, von denen mir scheint, daß ich sie
hätte besser, unvergeßlicher sehen müssen. Schon, ob-
wohl ich so oft aufmerksam und unnachgiebig davor-
gestanden habe, wird in meiner Erinnerung der
große Farbenzusammenhang der Frau im roten
Fauteuil so wenig wiederholbar wie eine sehr viel-
stellige Zahl. Und doch hab' ich sie mir eingeprägt,
Ziffer für Ziffer. In meinem Gefühl ist das Bewußt-
sein ihres Vorhandenseins zu einer Erhöhung ge-
worden, die ich noch im Schlafe fühle; mein Blut be-
schreibt sie in mir, aber das Sagen geht irgendwo
draußen vorbei und wird nicht hereingerufen.
Schrieb ich von ihr? — Vor eine erdiggrüne Wand,
in der ein kobaltblaues Muster rar wiederkehrt, ist
ein roter, ganz gepolsterter niedriger Sessel gescho-
ben; die rund gewulstete Lehne rundet und senkt
sich nach vorne zu zu Armlehnen (die wie der Rock-
ärmelstumpf eines Armlosen geschlossen sind). Die
linke Armlehne und die Quaste, die voller Zinnober
von ihr herunterhängt, haben schon nicht mehr die
Wand hinter sich, sondern einen breiten unteren
Randstreifen aus grünem Blau, gegen den ihr Wider-
spruch laut anklingt. In diesen roten Fauteuil, der
eine Persönlichkeit ist, ist eine Frau gesetzt, die
Hände im Schoß eines breit senkrecht gestreiften
Kleides, das ganz leicht mit kleinen verteilten Stük-
ken grünen Gelbs und gelben Grüns angegeben ist,
bis an den Rand der blaugrauen Jacke, die eine blaue,
mit grünen Reflexen spielende Seidenschleife vorne
zusammenhält. In der Helligkeit des Gesichts ist die
Nähe all dieser Farben zu einer einfachen Modellie-
rung ausgenutzt; selbst das Braun des über den
dreier Wesenheiten liegen müsse, in einer Beziehung
zwischen dem Schaffenden, dem Werk und dem, für
den das Werk geschaffen wurde. Keine dieser drei
Wesenheiten sei entbehrlich. Darum könnten wir 'zum
Beispiel nie ein zufälliges Xaturgebilde als Kunst-
werk ansprechen, eben weil eine Voraussetzung fehle,
die erkennbare Herkunft aus dem schöpferischen
menschlichen Geist. Und ebensowenig sei ein Kunst-
gebilde als Kunstwerk zu werten, wenn es nicht er-
laube, die andere Beziehung, die zum Aufnehmen-
den, herzustellen.
Möglich, meint der "Meister. Er wisse das nicht, er
sei bloß Maler. Was Kunst sei. habe seiner Meinung
nach Nestroy am besten gesagt.
Kunst ist, was man nicht kann, sagt Nestroy. Denn
wenn man's kann, ist's keine Kunst mehr.
über zwei Bilder von Paul Cezanne
Scheiteln rund aufgelegten Haars und das glatte
Braun in den Augen muß sich äußern gegen seine
Umgebung. Es ist, als wüßte jede Stelle von allen.
So sehr nimmt sie teil; so sehr geht auf ihr Anpas-
sung und Ablehnung vor sich, so sehr sorgt jede in
ihrer Weise für das Gleichgewicht und stellt es her:
wie das ganze Bild schließlich die Wirklichkeit im
Gleichgewicht hält. Denn sagt man, es ist ein roter
Fauteuil ( und es ist der erste und endgültigste rote
Fauteuil aller Malerei): so ist er es doch nur, weil
er eine erfahrene Farbensumme gebunden in sich
hat, die, wie immer sie auch sein mag, ihn im Rot
bestärkt und bestätigt. Er ist, um auf die Höhe seines
Ausdrucks zu kommen, um das leichte Bildnis herum
stark gemalt, daß etwas wie eine Wachsgeschicht ent-
steht; und doch hat die Farbe kein Ubergewicht über
den Gegenstand, der so vollkommen in seine maleri-
schen Äquivalente übersetzt erscheint, daß, so sehr
er erreicht und gegeben ist, doch andererseits auch
wieder seine bürgerliche Realität an ein endgültiges
Bilddasein alle Schwere verliert. Alles ist, wie ich
schon schrieb, zu einer Angelegenheit der Farben
untereinander geworden: Eine nimmt sich gegen
die andere zusammen, betont sich ihr gegenüber, be-
sinnt sich auf sich selbst. Wie im Mund eines Hun-
des bei Annäherung verschiedener Dinge verschie-
dene Säfte sich bilden und bereithalten; zustim-
mende, die nur umsetzen, und korrigierende, die un-
schädlich machen wollen: so entstehen im Innern
jeder Farbe Steigerungen oder Verdünnungen, mit
deren Hilfe sie das Berührtwerden durch eine andere
übersteht. Neben dieser Drüsenwirkung innerhalb
der Farbenintensität spielen die Spiegel ungen die größte
Rolle: schwächere Lokalfarben geben sich ganz auf und
begnügen sich damit, die stärkste vorhandene zu spie-
geln. In diesem Hin und Wider von gegenseitigem viel-
artigem Einfluß schwingt das Bildinnere, steigt und fällt
in sich selbst zurück und hat nicht eine stehende Stelle.
Rilke
30