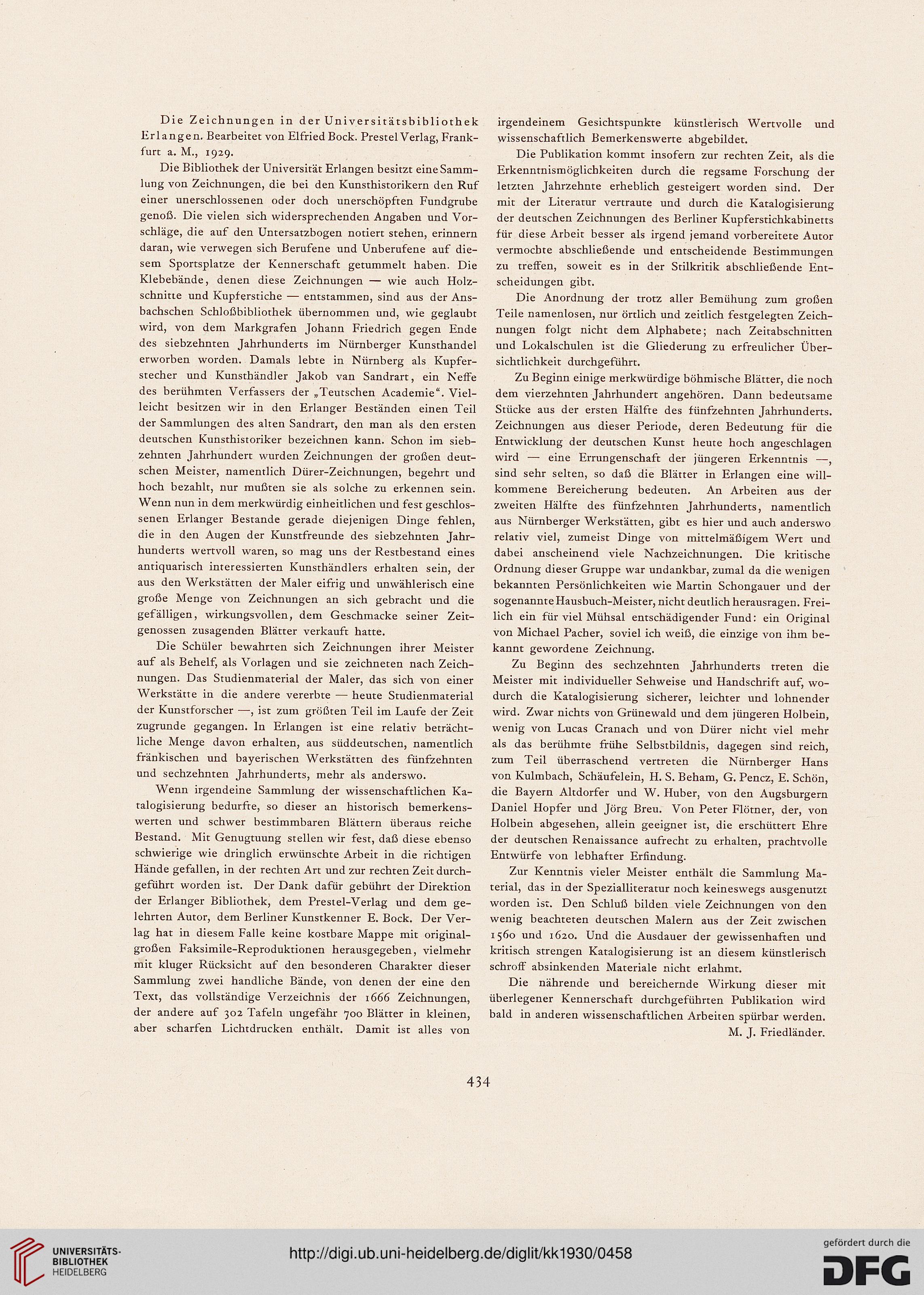Die Zeichnungen in der Universitätsbibliothek
lirlangen. Bearbeitet von Elfried Bock. Prestel Verlag, Frank-
furt a. M., 1929.
Die Bibliothek der Universität Erlangen besitzt eine Samm-
lung von Zeichnungen, die bei den Kunsthistorikern den Ruf
einer unerschlossenen oder doch unerschöpften Fundgrube
genoß. Die vielen sich widersprechenden Angaben und Vor-
schläge, die auf den Untersatzbogen notiert stehen, erinnern
daran, wie verwegen sich Berufene und Unberufene auf die-
sem Sportsplatze der Kennerschaft getummelt haben. Die
Klebebände, denen diese Zeichnungen — wie auch Holz-
schnitte und Kupferstiche — entstammen, sind aus der Ans-
bachschen Schloßbibliothek übernommen und, wie geglaubt
wird, von dem Markgrafen Johann Friedrich gegen Ende
des siebzehnten Jahrhunderts im Nürnberger Kunsthandel
erworben worden. Damals lebte in Nürnberg als Kupfer-
stecher und Kunsthändler Jakob van Sandrart, ein Neffe
des berühmten Verfassers der „Teutschen Academie". Viel-
leicht besitzen wir in den Erlanger Beständen einen Teil
der Sammlungen des alten Sandrart, den man als den ersten
deutschen Kunsthistoriker bezeichnen kann. Schon im sieb-
zehnten Jahrhundert wurden Zeichnungen der großen deut-
schen Meister, namentlich Dürer-Zeichnungen, begehrt und
hoch bezahlt, nur mußten sie als solche zu erkennen sein.
Wenn nun in dem merkwürdig einheitlichen und fest geschlos-
senen Erlanger Bestände gerade diejenigen Dinge fehlen,
die in den Augen der Kunstfreunde des siebzehnten Jahr-
hunderts wertvoll waren, so mag uns der Restbestand eines
antiquarisch interessierten Kunsthändlers erhalten sein, der
aus den Werkstätten der Maler eifrig und unwählerisch eine
große Menge von Zeichnungen an sich gebracht und die
gefälligen, wirkungsvollen, dem Geschmacke seiner Zeit-
genossen zusagenden Blätter verkauft hatte.
Die Schüler bewahrten sich Zeichnungen ihrer Meister
auf als Behelf, als Vorlagen und sie zeichneten nach Zeich-
nungen. Das Studienmaterial der Maler, das sich von einer
Werkstätte in die andere vererbte — heute Studienmaterial
der Kunstforscher —, ist zum größten Teil im Laufe der Zeit
zugrunde gegangen. In Erlangen ist eine relativ beträcht-
liche Menge davon erhalten, aus süddeutschen, namentlich
fränkischen und bayerischen Werkstätten des fünfzehnten
und sechzehnten Jahrhunderts, mehr als anderswo.
Wenn irgendeine Sammlung der wissenschaftlichen Ka-
talogisierung bedurfte, so dieser an historisch bemerkens-
werten und schwer bestimmbaren Blättern überaus reiche
Bestand. Mit Genugtuung stellen wir fest, daß diese ebenso
schwierige wie dringlich erwünschte Arbeit in die richtigen
Hände gefallen, in der rechten Art und zur rechten Zeit durch-
geführt worden ist. Der Dank dafür gebührt der Direktion
der Erlanger Bibliothek, dem Prestel-Verlag und dem ge-
lehrten Autor, dem Berliner Kunstkenner E. Bock. Der Ver-
lag hat in diesem Falle keine kostbare Mappe mit original-
großen Faksimile-Reproduktionen herausgegeben, vielmehr
mit kluger Rücksicht auf den besonderen Charakter dieser
Sammlung zwei handliche Bände, von denen der eine den
Text, das vollständige Verzeichnis der 1666 Zeichnungen,
der andere auf 302 Tafeln ungefähr 700 Blätter in kleinen,
aber scharfen Lichtdrucken enthält. Damit ist alles von
irgendeinem Gesichtspunkte künstlerisch Wertvolle und
wissenschaftlich Bemerkenswerte abgebildet.
Die Publikation kommt insofern zur rechten Zeit, als die
Erkenntnismöglichkeiten durch die regsame Forschung der
letzten Jahrzehnte erheblich gesteigert worden sind. Der
mit der Literatur vertraute und durch die Katalogisierung
der deutschen Zeichnungen des Berliner Kupferstichkabinetts
für diese Arbeit besser als irgend jemand vorbereitete Autor
vermochte abschließende und entscheidende Bestimmungen
zu treffen, soweit es in der Stilkritik abschließende Ent-
scheidungen gibt.
Die Anordnung der trotz aller Bemühung zum großen
Teile namenlosen, nur örtlich und zeitlich festgelegten Zeich-
nungen folgt nicht dem Alphabete; nach Zeitabschnitten
und Lokalschulen ist die Gliederung zu erfreulicher Über-
sichtlichkeit durchgeführt.
Zu Beginn einige merkwürdige böhmische Blätter, die noch
dem vierzehnten Jahrhundert angehören. Dann bedeutsame
Stücke aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts.
Zeichnungen aus dieser Periode, deren Bedeutung für die
Entwicklung der deutschen Kunst heute hoch angeschlagen
wird — eine Errungenschaft der jüngeren Erkenntnis —,
sind sehr selten, so daß die Blätter in Erlangen eine will-
kommene Bereicherung bedeuten. An Arbeiten aus der
zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, namentlich
aus Nürnberger Werkstätten, gibt es hier und auch anderswo
relativ viel, zumeist Dinge von mittelmäßigem Wert und
dabei anscheinend viele Nachzeichnungen. Die kritische
Ordnung dieser Gruppe war undankbar, zumal da die wenigen
bekannten Persönlichkeiten wie Martin Schongauer und der
sogenannte Hausbuch-Meister, nicht deutlich herausragen. Frei-
lich ein für viel Mühsal entschädigender Fund: ein Original
von Michael Pacher, soviel ich weiß, die einzige von ihm be-
kannt gewordene Zeichnung.
Zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts treten die
Meister mit individueller Sehweise und Handschrift auf, wo-
durch die Katalogisierung sicherer, leichter und lohnender
wird. Zwar nichts von Grünewald und dem jüngeren Holbein,
wenig von Lucas Cranach und von Dürer nicht viel mehr
als das berühmte frühe Selbstbildnis, dagegen sind reich,
zum Teil überraschend vertreten die Nürnberger Hans
von Kulmbach, Schäufelein, H. S. Beham, G. Pencz, E. Schön,
die Bayern Altdorfer und W. Huber, von den Augsburgern
Daniel Hopfer und Jörg Breu. Von Peter Flötner, der, von
Holbein abgesehen, allein geeignet ist, die erschüttert Ehre
der deutschen Renaissance aufrecht zu erhalten, prachtvolle
Entwürfe von lebhafter Erfindung.
Zur Kenntnis vieler Meister enthält die Sammlung Ma-
terial, das in der Spezialliteratur noch keineswegs ausgenutzt
worden ist. Den Schluß bilden viele Zeichnungen von den
wenig beachteten deutschen Malern aus der Zeit zwischen
1560 und 1620. Und die Ausdauer der gewissenhaften und
kritisch strengen Katalogisierung ist an diesem künstlerisch
schroff absinkenden Materiale nicht erlahmt.
Die nährende und bereichernde Wirkung dieser mit
überlegener Kennerschaft durchgeführten Publikation wird
bald in anderen wissenschaftlichen Arbeiten spürbar werden.
M. J. Friedländer.
434
lirlangen. Bearbeitet von Elfried Bock. Prestel Verlag, Frank-
furt a. M., 1929.
Die Bibliothek der Universität Erlangen besitzt eine Samm-
lung von Zeichnungen, die bei den Kunsthistorikern den Ruf
einer unerschlossenen oder doch unerschöpften Fundgrube
genoß. Die vielen sich widersprechenden Angaben und Vor-
schläge, die auf den Untersatzbogen notiert stehen, erinnern
daran, wie verwegen sich Berufene und Unberufene auf die-
sem Sportsplatze der Kennerschaft getummelt haben. Die
Klebebände, denen diese Zeichnungen — wie auch Holz-
schnitte und Kupferstiche — entstammen, sind aus der Ans-
bachschen Schloßbibliothek übernommen und, wie geglaubt
wird, von dem Markgrafen Johann Friedrich gegen Ende
des siebzehnten Jahrhunderts im Nürnberger Kunsthandel
erworben worden. Damals lebte in Nürnberg als Kupfer-
stecher und Kunsthändler Jakob van Sandrart, ein Neffe
des berühmten Verfassers der „Teutschen Academie". Viel-
leicht besitzen wir in den Erlanger Beständen einen Teil
der Sammlungen des alten Sandrart, den man als den ersten
deutschen Kunsthistoriker bezeichnen kann. Schon im sieb-
zehnten Jahrhundert wurden Zeichnungen der großen deut-
schen Meister, namentlich Dürer-Zeichnungen, begehrt und
hoch bezahlt, nur mußten sie als solche zu erkennen sein.
Wenn nun in dem merkwürdig einheitlichen und fest geschlos-
senen Erlanger Bestände gerade diejenigen Dinge fehlen,
die in den Augen der Kunstfreunde des siebzehnten Jahr-
hunderts wertvoll waren, so mag uns der Restbestand eines
antiquarisch interessierten Kunsthändlers erhalten sein, der
aus den Werkstätten der Maler eifrig und unwählerisch eine
große Menge von Zeichnungen an sich gebracht und die
gefälligen, wirkungsvollen, dem Geschmacke seiner Zeit-
genossen zusagenden Blätter verkauft hatte.
Die Schüler bewahrten sich Zeichnungen ihrer Meister
auf als Behelf, als Vorlagen und sie zeichneten nach Zeich-
nungen. Das Studienmaterial der Maler, das sich von einer
Werkstätte in die andere vererbte — heute Studienmaterial
der Kunstforscher —, ist zum größten Teil im Laufe der Zeit
zugrunde gegangen. In Erlangen ist eine relativ beträcht-
liche Menge davon erhalten, aus süddeutschen, namentlich
fränkischen und bayerischen Werkstätten des fünfzehnten
und sechzehnten Jahrhunderts, mehr als anderswo.
Wenn irgendeine Sammlung der wissenschaftlichen Ka-
talogisierung bedurfte, so dieser an historisch bemerkens-
werten und schwer bestimmbaren Blättern überaus reiche
Bestand. Mit Genugtuung stellen wir fest, daß diese ebenso
schwierige wie dringlich erwünschte Arbeit in die richtigen
Hände gefallen, in der rechten Art und zur rechten Zeit durch-
geführt worden ist. Der Dank dafür gebührt der Direktion
der Erlanger Bibliothek, dem Prestel-Verlag und dem ge-
lehrten Autor, dem Berliner Kunstkenner E. Bock. Der Ver-
lag hat in diesem Falle keine kostbare Mappe mit original-
großen Faksimile-Reproduktionen herausgegeben, vielmehr
mit kluger Rücksicht auf den besonderen Charakter dieser
Sammlung zwei handliche Bände, von denen der eine den
Text, das vollständige Verzeichnis der 1666 Zeichnungen,
der andere auf 302 Tafeln ungefähr 700 Blätter in kleinen,
aber scharfen Lichtdrucken enthält. Damit ist alles von
irgendeinem Gesichtspunkte künstlerisch Wertvolle und
wissenschaftlich Bemerkenswerte abgebildet.
Die Publikation kommt insofern zur rechten Zeit, als die
Erkenntnismöglichkeiten durch die regsame Forschung der
letzten Jahrzehnte erheblich gesteigert worden sind. Der
mit der Literatur vertraute und durch die Katalogisierung
der deutschen Zeichnungen des Berliner Kupferstichkabinetts
für diese Arbeit besser als irgend jemand vorbereitete Autor
vermochte abschließende und entscheidende Bestimmungen
zu treffen, soweit es in der Stilkritik abschließende Ent-
scheidungen gibt.
Die Anordnung der trotz aller Bemühung zum großen
Teile namenlosen, nur örtlich und zeitlich festgelegten Zeich-
nungen folgt nicht dem Alphabete; nach Zeitabschnitten
und Lokalschulen ist die Gliederung zu erfreulicher Über-
sichtlichkeit durchgeführt.
Zu Beginn einige merkwürdige böhmische Blätter, die noch
dem vierzehnten Jahrhundert angehören. Dann bedeutsame
Stücke aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts.
Zeichnungen aus dieser Periode, deren Bedeutung für die
Entwicklung der deutschen Kunst heute hoch angeschlagen
wird — eine Errungenschaft der jüngeren Erkenntnis —,
sind sehr selten, so daß die Blätter in Erlangen eine will-
kommene Bereicherung bedeuten. An Arbeiten aus der
zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, namentlich
aus Nürnberger Werkstätten, gibt es hier und auch anderswo
relativ viel, zumeist Dinge von mittelmäßigem Wert und
dabei anscheinend viele Nachzeichnungen. Die kritische
Ordnung dieser Gruppe war undankbar, zumal da die wenigen
bekannten Persönlichkeiten wie Martin Schongauer und der
sogenannte Hausbuch-Meister, nicht deutlich herausragen. Frei-
lich ein für viel Mühsal entschädigender Fund: ein Original
von Michael Pacher, soviel ich weiß, die einzige von ihm be-
kannt gewordene Zeichnung.
Zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts treten die
Meister mit individueller Sehweise und Handschrift auf, wo-
durch die Katalogisierung sicherer, leichter und lohnender
wird. Zwar nichts von Grünewald und dem jüngeren Holbein,
wenig von Lucas Cranach und von Dürer nicht viel mehr
als das berühmte frühe Selbstbildnis, dagegen sind reich,
zum Teil überraschend vertreten die Nürnberger Hans
von Kulmbach, Schäufelein, H. S. Beham, G. Pencz, E. Schön,
die Bayern Altdorfer und W. Huber, von den Augsburgern
Daniel Hopfer und Jörg Breu. Von Peter Flötner, der, von
Holbein abgesehen, allein geeignet ist, die erschüttert Ehre
der deutschen Renaissance aufrecht zu erhalten, prachtvolle
Entwürfe von lebhafter Erfindung.
Zur Kenntnis vieler Meister enthält die Sammlung Ma-
terial, das in der Spezialliteratur noch keineswegs ausgenutzt
worden ist. Den Schluß bilden viele Zeichnungen von den
wenig beachteten deutschen Malern aus der Zeit zwischen
1560 und 1620. Und die Ausdauer der gewissenhaften und
kritisch strengen Katalogisierung ist an diesem künstlerisch
schroff absinkenden Materiale nicht erlahmt.
Die nährende und bereichernde Wirkung dieser mit
überlegener Kennerschaft durchgeführten Publikation wird
bald in anderen wissenschaftlichen Arbeiten spürbar werden.
M. J. Friedländer.
434