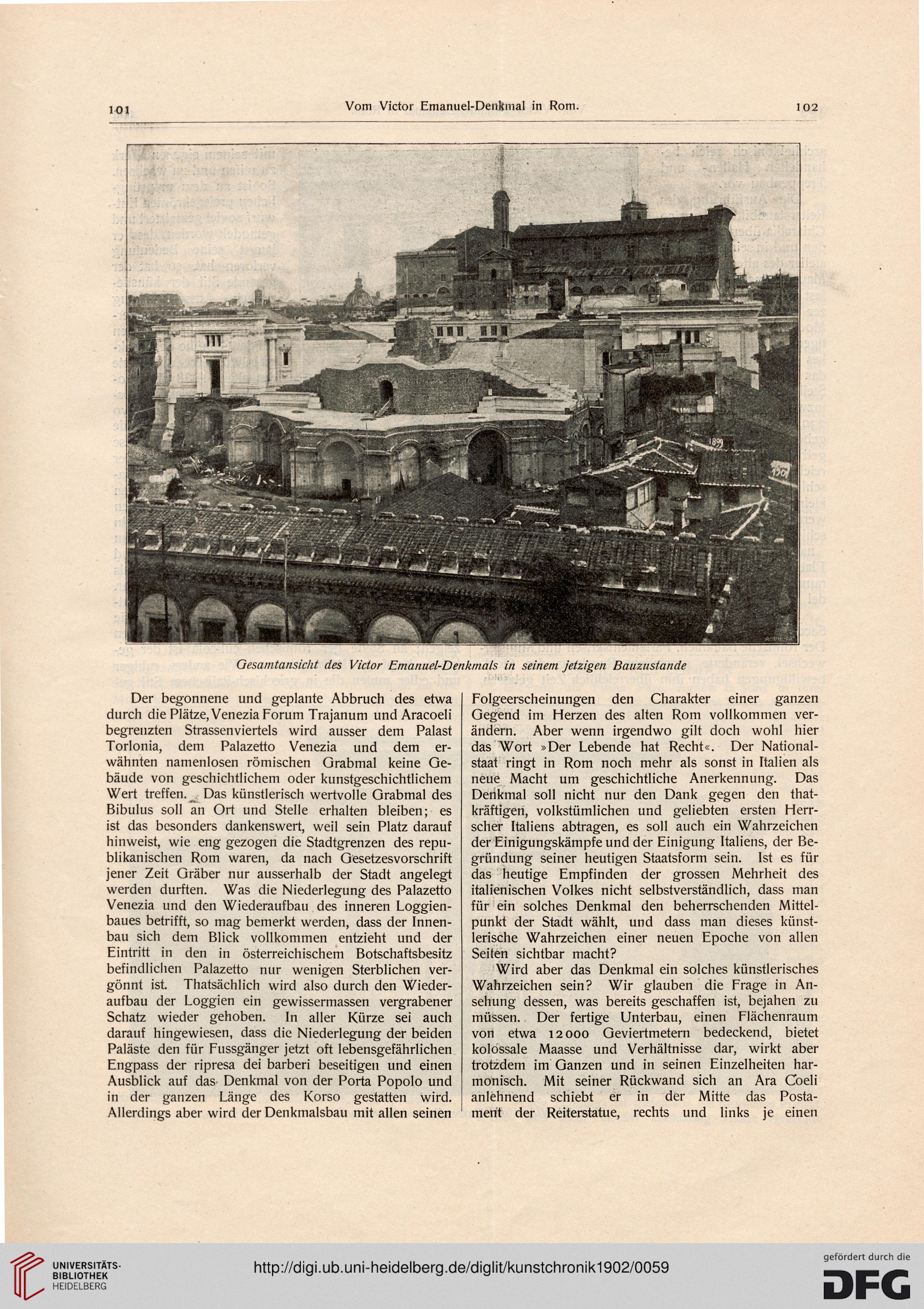101
Vom Victor Emanuel-Denkmal in Rom.
1 02
Gesamtansicht des Victor Emanuel-Denkmals in seinem jetzigen Bauzustande
Der begonnene und geplante Abbruch des etwa
durch die Plätze, Venezia Forum Trajanum und Aracoeli
begrenzten Strassenviertels wird ausser dem Palast
Torlonia, dem Palazetto Venezia und dem er-
wähnten namenlosen römischen Grabmal keine Ge-
bäude von geschichtlichem oder kunstgeschichtlichem
Wert treffen. _ Das künstlerisch wertvolle Grabmal des
Bibulus soll an Ort und Stelle erhalten bleiben; es
ist das besonders dankenswert, weil sein Platz darauf
hinweist, wie eng gezogen die Stadtgrenzen des repu-
blikanischen Rom waren, da nach Gesetzesvorschrift
jener Zeit Gräber nur ausserhalb der Stadt angelegt
werden durften. Was die Niederlegung des Palazetto
Venezia und den Wiederaufbau des inneren Loggien-
baues betrifft, so mag bemerkt werden, dass der Innen-
bau sich dem Blick vollkommen entzieht und der
Eintritt in den in österreichischem Botschaftsbesitz
befindlichen Palazetto nur wenigen Sterblichen ver-
gönnt ist. Thatsächlich wird also durch den Wieder-
aufbau der Loggien ein gewissermassen vergrabener
Schatz wieder gehoben. In aller Kürze sei auch
darauf hingewiesen, dass die Niederlegung der beiden
Paläste den für Fussgänger jetzt oft lebensgefährlichen
Engpass der ripresa dei barberi beseitigen und einen
Ausblick auf das Denkmal von der Porta Popolo und
in der ganzen Länge des Korso gestatten wird.
Allerdings aber wird der Denkmalsbau mit allen seinen
Folgeerscheinungen den Charakter einer ganzen
Gegend im Herzen des alten Rom vollkommen ver-
ändern. Aber wenn irgendwo gilt doch wohl hier
das Wort »Der Lebende hat Recht«. Der National-
staat ringt in Rom noch mehr als sonst in Italien als
neue Macht um geschichtliche Anerkennung. Das
Denkmal soll nicht nur den Dank gegen den that-
kräftigen, volkstümlichen und geliebten ersten Herr-
scher Italiens abtragen, es soll auch ein Wahrzeichen
der Einigungskämpfe und der Einigung Italiens, der Be-
gründung seiner heutigen Staatsform sein. Ist es für
das heutige Empfinden der grossen Mehrheit des
italienischen Volkes nicht selbstverständlich, dass man
für ein solches Denkmal den beherrschenden Mittel-
punkt der Stadt wählt, und dass man dieses künst-
lerische Wahrzeichen einer neuen Epoche von allen
Seiten sichtbar macht?
Wird aber das Denkmal ein solches künstlerisches
Wahrzeichen sein? Wir glauben die Frage in An-
sehung dessen, was bereits geschaffen ist, bejahen zu
müssen. Der fertige Unterbau, einen Flächenraum
von etwa 12000 Geviertmetern bedeckend, bietet
kolossale Maasse und Verhältnisse dar, wirkt aber
trotzdem im Ganzen und in seinen Einzelheiten har-
monisch. Mit seiner Rückwand sich an Ära Coeli
anlehnend schiebt er in der Mitte das Posta-
ment der Reiterstatue, rechts und links je einen
Vom Victor Emanuel-Denkmal in Rom.
1 02
Gesamtansicht des Victor Emanuel-Denkmals in seinem jetzigen Bauzustande
Der begonnene und geplante Abbruch des etwa
durch die Plätze, Venezia Forum Trajanum und Aracoeli
begrenzten Strassenviertels wird ausser dem Palast
Torlonia, dem Palazetto Venezia und dem er-
wähnten namenlosen römischen Grabmal keine Ge-
bäude von geschichtlichem oder kunstgeschichtlichem
Wert treffen. _ Das künstlerisch wertvolle Grabmal des
Bibulus soll an Ort und Stelle erhalten bleiben; es
ist das besonders dankenswert, weil sein Platz darauf
hinweist, wie eng gezogen die Stadtgrenzen des repu-
blikanischen Rom waren, da nach Gesetzesvorschrift
jener Zeit Gräber nur ausserhalb der Stadt angelegt
werden durften. Was die Niederlegung des Palazetto
Venezia und den Wiederaufbau des inneren Loggien-
baues betrifft, so mag bemerkt werden, dass der Innen-
bau sich dem Blick vollkommen entzieht und der
Eintritt in den in österreichischem Botschaftsbesitz
befindlichen Palazetto nur wenigen Sterblichen ver-
gönnt ist. Thatsächlich wird also durch den Wieder-
aufbau der Loggien ein gewissermassen vergrabener
Schatz wieder gehoben. In aller Kürze sei auch
darauf hingewiesen, dass die Niederlegung der beiden
Paläste den für Fussgänger jetzt oft lebensgefährlichen
Engpass der ripresa dei barberi beseitigen und einen
Ausblick auf das Denkmal von der Porta Popolo und
in der ganzen Länge des Korso gestatten wird.
Allerdings aber wird der Denkmalsbau mit allen seinen
Folgeerscheinungen den Charakter einer ganzen
Gegend im Herzen des alten Rom vollkommen ver-
ändern. Aber wenn irgendwo gilt doch wohl hier
das Wort »Der Lebende hat Recht«. Der National-
staat ringt in Rom noch mehr als sonst in Italien als
neue Macht um geschichtliche Anerkennung. Das
Denkmal soll nicht nur den Dank gegen den that-
kräftigen, volkstümlichen und geliebten ersten Herr-
scher Italiens abtragen, es soll auch ein Wahrzeichen
der Einigungskämpfe und der Einigung Italiens, der Be-
gründung seiner heutigen Staatsform sein. Ist es für
das heutige Empfinden der grossen Mehrheit des
italienischen Volkes nicht selbstverständlich, dass man
für ein solches Denkmal den beherrschenden Mittel-
punkt der Stadt wählt, und dass man dieses künst-
lerische Wahrzeichen einer neuen Epoche von allen
Seiten sichtbar macht?
Wird aber das Denkmal ein solches künstlerisches
Wahrzeichen sein? Wir glauben die Frage in An-
sehung dessen, was bereits geschaffen ist, bejahen zu
müssen. Der fertige Unterbau, einen Flächenraum
von etwa 12000 Geviertmetern bedeckend, bietet
kolossale Maasse und Verhältnisse dar, wirkt aber
trotzdem im Ganzen und in seinen Einzelheiten har-
monisch. Mit seiner Rückwand sich an Ära Coeli
anlehnend schiebt er in der Mitte das Posta-
ment der Reiterstatue, rechts und links je einen