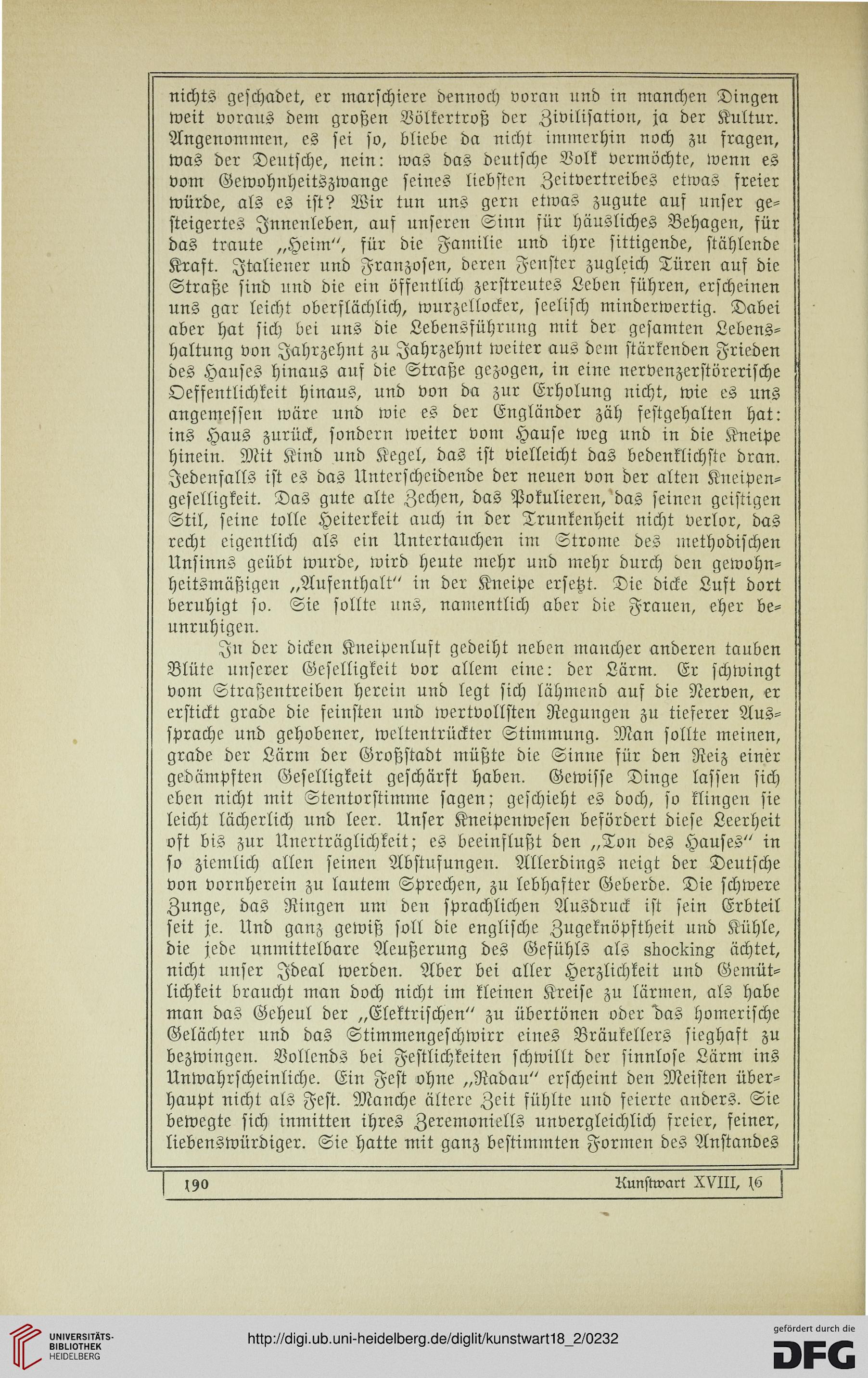nichts geschadet, er marschiere dennoch voran und in manchen Dingen
weit voraus dem großen Bölkertroß der Zivilisation, ja der Kultur.
Angenommen, es sei so, bliebe da nicht immerhin noch zu fragen,
was der Deutsche, nein: was das deutsche Volk vermöchte, wenn es
vom Gewohnheitszwange seines liebsten Zeitvertreibes etwas freier
würde, als es ist? Wir tun uns gern etwas zugute auf unfer ge--
steigertes Jnnenleben, auf unseren Sinn für häusliches Behagen, für
das traute „Heim", für die Familie und ihre sittigende, stählende
Kraft. Jtaliener nnd Franzosen, deren Fenster zugleich Türen auf die
Straße sind und die ein öffentlich zerstreutes Leben führen, erscheinen
uns gar leicht oberflächlich, wurzellocker, seelisch minderwertig. Dabei
aber hat fich bei uns die Lebensführung mit der gesamten Lebens-
haltung von Johrzehnt zu Jahrzehnt weiter aus dem stärkenden Frieden
des Hauses hinaus auf die Straße gez-ogen, in eine nervenzerstörerische
Oeffentlichkeit hinaus, und von da zur Erholung nicht, wie es uns
angemefsen wäre und wie es der Engländer zäh festgehalten hat:
ins Haus zurück, sondern weiter vom Hause weg und in die Kneipe
hinein. Mit Kind und Kegel, das ist vielleicht das bedenklichste dran.
Jedenfalls ist es das Unterscheidende der neuen von der alten Kneipen-
geselligkeit. Das gute alte Zechen, das Pokulieren, das seinen geistigen
Stil, seine tolle Heiterkeit auch in der Trunkenheit nicht verlor, das
recht eigentlich als ein Untertauchen im Strome des methodischen
Unsinns geübt wurde, wird heute mehr und mehr durch den gewohn-
heitsmäßigen „Aufenthalt" in der Kneipe ersetzt. Die dicke Luft dort
beruhigt so. Sie sollte uns, namentlich aber die Frauen, eher be-
unruhigen.
Jn der dicken Kneipenluft gedeiht neben mancher anderen tauben
Blüte unserer Geselligkeit vor allem eine: der Lärm. Er schwingt
vom Straßentreiben hercin und legt sich lähmend auf die Nerven, er
erstickt grade die feinsten und wertvollsten Regungen zu tieferer Aus-
sprache und gehobener, weltentrückter Stimmung. Man follte meinen,
grade der Lärm der Großstadt müßte die Sinne für den Reiz einer
gedümpften Geselligkeit geschärft haben. Gewisse Dinge lassen sich
eben nicht mit Stentorstimme sagen; geschieht es doch, so klingen sie
leicht lächerlich und leer. Unser Kneipenwesen befördert diese Leerheit
oft bis zur Unerträglichkeit; es beeinflußt den „Ton des Hauses" in
so ziemlich allen seinen Abstufungen. Allerdings neigt der Deutsche
von vornherein zu lautem Sprechen, zu lebhafter Geberde. Die schwere
Zunge, das Ringen um den sprachlichen Ausdruck ist sein Erbteil
seit je. Und ganz gewiß soll die englische Zugeknöpftheit und Kühle,
die jede unmittelbare Aeußerung des Gefühls als 8do6Üm§ ächtet,
nicht unfer Jdeal werden. Aber bei aller Herzlichkeit und Gemüt-
lichkeit braucht man doch nicht im kleinen Kreise zu lärmen, als habe
man das Geheul der „Elektrischen" zu übertönen oder 'das homerische
Gelächter und das Stimmengeschwirr eines Bräukellers sieghaft zu
bezwingen. Vollends bei Festlichkeiten schwillt der sinnlose Lärm ins
Unwahrscheinliche. Ein Fest ohne „Radau" erscheint den Meisten über-
haupt nicht als Fest. Manche ältere Zeit fühlte und feierte anders. Sie
bewegte fich inmitten ihres Zeremoniells unvergleichlich freier, feiner,
liebenswürdiger. Sie hatte mit ganz bestimmten Formen des Anstandes
^90 Runstwart XVIII, 16 ^
weit voraus dem großen Bölkertroß der Zivilisation, ja der Kultur.
Angenommen, es sei so, bliebe da nicht immerhin noch zu fragen,
was der Deutsche, nein: was das deutsche Volk vermöchte, wenn es
vom Gewohnheitszwange seines liebsten Zeitvertreibes etwas freier
würde, als es ist? Wir tun uns gern etwas zugute auf unfer ge--
steigertes Jnnenleben, auf unseren Sinn für häusliches Behagen, für
das traute „Heim", für die Familie und ihre sittigende, stählende
Kraft. Jtaliener nnd Franzosen, deren Fenster zugleich Türen auf die
Straße sind und die ein öffentlich zerstreutes Leben führen, erscheinen
uns gar leicht oberflächlich, wurzellocker, seelisch minderwertig. Dabei
aber hat fich bei uns die Lebensführung mit der gesamten Lebens-
haltung von Johrzehnt zu Jahrzehnt weiter aus dem stärkenden Frieden
des Hauses hinaus auf die Straße gez-ogen, in eine nervenzerstörerische
Oeffentlichkeit hinaus, und von da zur Erholung nicht, wie es uns
angemefsen wäre und wie es der Engländer zäh festgehalten hat:
ins Haus zurück, sondern weiter vom Hause weg und in die Kneipe
hinein. Mit Kind und Kegel, das ist vielleicht das bedenklichste dran.
Jedenfalls ist es das Unterscheidende der neuen von der alten Kneipen-
geselligkeit. Das gute alte Zechen, das Pokulieren, das seinen geistigen
Stil, seine tolle Heiterkeit auch in der Trunkenheit nicht verlor, das
recht eigentlich als ein Untertauchen im Strome des methodischen
Unsinns geübt wurde, wird heute mehr und mehr durch den gewohn-
heitsmäßigen „Aufenthalt" in der Kneipe ersetzt. Die dicke Luft dort
beruhigt so. Sie sollte uns, namentlich aber die Frauen, eher be-
unruhigen.
Jn der dicken Kneipenluft gedeiht neben mancher anderen tauben
Blüte unserer Geselligkeit vor allem eine: der Lärm. Er schwingt
vom Straßentreiben hercin und legt sich lähmend auf die Nerven, er
erstickt grade die feinsten und wertvollsten Regungen zu tieferer Aus-
sprache und gehobener, weltentrückter Stimmung. Man follte meinen,
grade der Lärm der Großstadt müßte die Sinne für den Reiz einer
gedümpften Geselligkeit geschärft haben. Gewisse Dinge lassen sich
eben nicht mit Stentorstimme sagen; geschieht es doch, so klingen sie
leicht lächerlich und leer. Unser Kneipenwesen befördert diese Leerheit
oft bis zur Unerträglichkeit; es beeinflußt den „Ton des Hauses" in
so ziemlich allen seinen Abstufungen. Allerdings neigt der Deutsche
von vornherein zu lautem Sprechen, zu lebhafter Geberde. Die schwere
Zunge, das Ringen um den sprachlichen Ausdruck ist sein Erbteil
seit je. Und ganz gewiß soll die englische Zugeknöpftheit und Kühle,
die jede unmittelbare Aeußerung des Gefühls als 8do6Üm§ ächtet,
nicht unfer Jdeal werden. Aber bei aller Herzlichkeit und Gemüt-
lichkeit braucht man doch nicht im kleinen Kreise zu lärmen, als habe
man das Geheul der „Elektrischen" zu übertönen oder 'das homerische
Gelächter und das Stimmengeschwirr eines Bräukellers sieghaft zu
bezwingen. Vollends bei Festlichkeiten schwillt der sinnlose Lärm ins
Unwahrscheinliche. Ein Fest ohne „Radau" erscheint den Meisten über-
haupt nicht als Fest. Manche ältere Zeit fühlte und feierte anders. Sie
bewegte fich inmitten ihres Zeremoniells unvergleichlich freier, feiner,
liebenswürdiger. Sie hatte mit ganz bestimmten Formen des Anstandes
^90 Runstwart XVIII, 16 ^