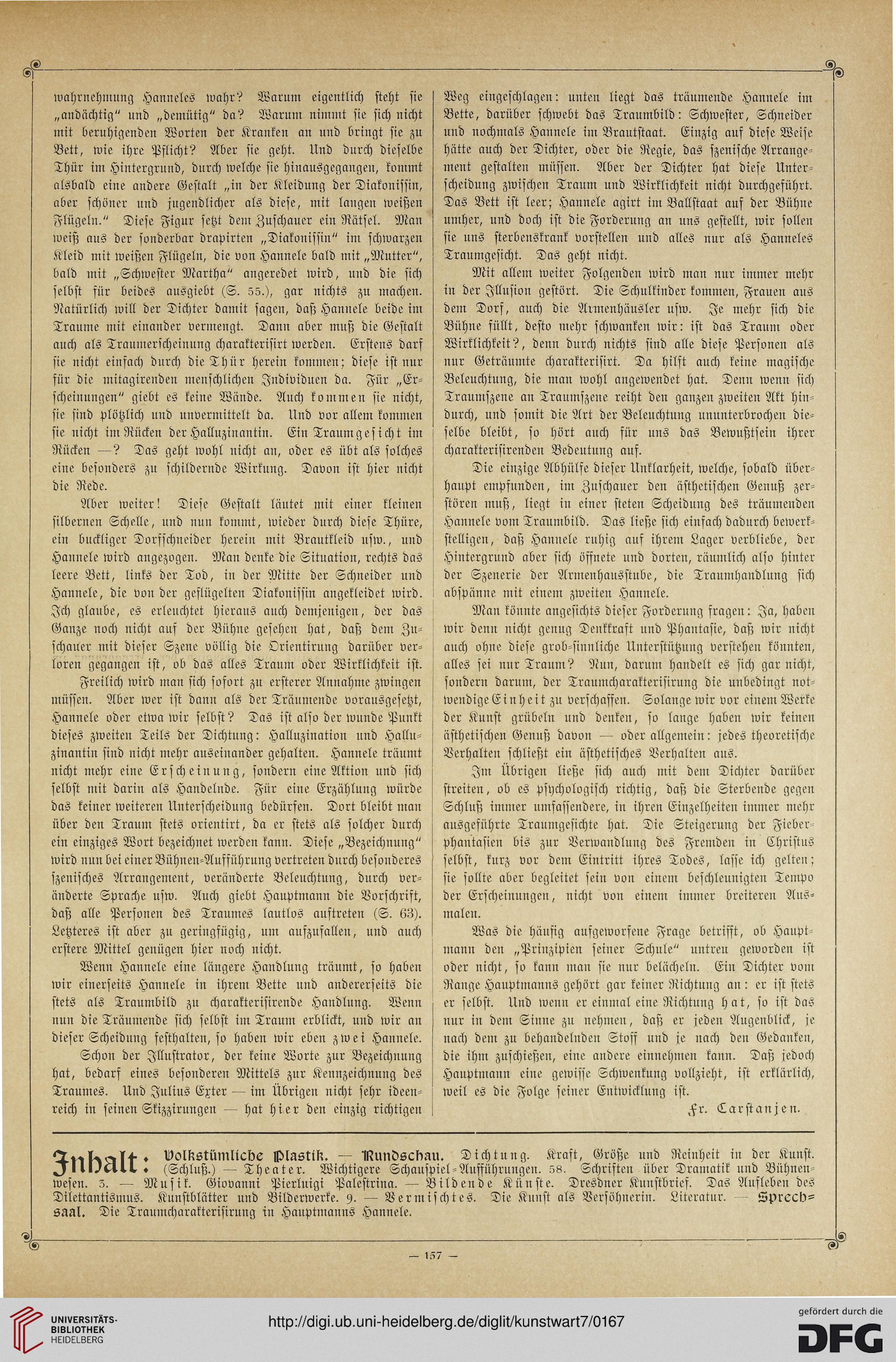^-
wahrnehmung Hanneles wahr? Warum eigentlich steht sie
„andachtig" und „demütig" da? Warum nimmt sie sich nicht
mit beruhigenden Worten der Kranken an und bringt sie zu
Bett, wie ihre Pflicht? Aber sie geht. Und durch dieselbe
Thür im Hintergrund, durch welche sie hinausgegangen, kommt
alsbald eine andere Gestalt „in der Kleidung der Diakonissin,
aber schvner und jugendlicher als diese, mit laugen weißen
Flügeln." Diese Figur setzt dem Zuschauer ein Rätsel. Man
weiß aus der sonderbar drapirten „Diakouissin" im schwarzen
Kleid mit weißen Flügeln, die von Hannele bald mit „Mutter",
bald mit „Schwester Martha" angeredet wird, und die sich
selbst sür beides ausgiebt (S. 55.), gar nichts zu machen.
Natürlich will der Dichter damit sagen, daß Hannele beide im
Traume mit einander vermengt. Danu aber muß die Gestalt
auch als Traumericheinung charakterisirt werden. Erstens darf
sie nicht einfach durch die Thür herein kommen; diese ist nur
für die mitagirenden menschlichen Jndividuen da. Für „Er-
scheinungen" giebt es keine Wände. Auch kommen sie nicht,
sie sind plötzlich und unvermittelt da. Und vor allem kommen
sie uicht im Rücken der Halluziuantin. Ein Traumgesicht im
Rücken —? Das geht wohl nicht au, oder es übt als solches
eine besonders zu schildernde Wirkung. Davon ist hier nicht
die Rede.
Aber weiter! Diese Gestalt läutet mit einer kleinen
silbernen Schelle, uud nuu kommt, wieder durch diese Thüre,
ein buckliger Dorfschneider herein mit Brautkleid usw., und
Hannele wird angezogen. Man denke die Situation, rechts das
leere Bett, links der Tod, iu der Mitte der Schneider und
Hannele, die von der geflügelten Diakonissin angekleidet wird.
Jch glaube, es erleuchtet hieraus auch demjenigen, der das
Ganze noch nicht auf der Bühne gesehen hat, daß dem Zu-
schauer mit dieser Szene völlig die Orientirung darüber ver-
loren gegangen ist, ob das alles Traum oder Wirklichkeit ist.
Freilich wird man sich sofort zu ersterer Annahme zwingen
müssen. Aber wer ist dann als der Träumende vorausgesetzt,
Hannele oder etwa wir selbst? Das ist also der wunde Punkt
dieses zweiten Teils der Dichtung: Halluzination und Hallu-
zinantin sind nicht mehr auseinander gehalten. Hannele träumt
nicht mehr eine Erscheinung, sondern eine Aktion und sich
selbst mit darin als Handelnde. Für eine Erzählung würde
das keiner weiteren Unterscheidung bedürfen. Dort bleibt man
über den Traum stets orientirt, da er stets als solcher durch
ein einziges Wort bezeichnet werden kann. Diese „Bezeichnung"
wird nun bei einer Bühnen-Aufführung vertreten durch besouderes
szenisches Arrangement, veränderte Beleuchtung, durch ver-
änderte Sprache usw. Auch giebt Hauptmann die Vorschrift,
daß alle Personen des Traumes lautlos auftreten (S. 63).
Letzteres ist aber zu geringfügig, um aufzufallen, und auch
erstere Mittel genügen hier noch nicht.
Wenn Hannele eine längere Handlung träumt, so haben
wir einerseits Hannele in ihrem Bette und andererseits die
stets als Traumbild zu charakterisirende Handlung. Wenn
nun die Träumende sich selbst im Traum erblickt, und wir an
dieser Scheidung festhalten, so haben wir eben zwei Hannele.
Schon der Jllustrator, der keine Worte zur Bezeichnung
hat, bedars eines besonderen Mittels zur Kennzeichnung des
Traumes. Und Julius Exter — im Übrigen nicht sehr ideen-
reich in seinen Skizzirungen — hat hier den einzig richtigen j
Weg eingeschlagen: unten liegt das trüumende Hannele im
Bette, darüber schwebt das Traumbild: Schwester, Schneider
uud nochmals Hannele im Brautstaat. Einzig aus diese Weise
hätte auch der Dichter, oder die Regie, das szenische Arrange-
ment gestalten müssen. Aber der Dichter hat diese Unter-
scheidung zwischen Traum und Wirklichkeit nicht durchgesührt.
Das Bett ist leer; Hannele agirt im Ballstaat auf der Bühne
umher, und doch ist die Forderung an uns gestellt, wir sollen
sie nns sterbenskrank vorstellen und alles nur als Hanneles
Traumgesicht. Dns geht nicht.
Mit allem weiter Folgendeu wird man nur immer mehr
in der Jllusion gestört. Die Schulkinder kommen, Frauen aus
dem Dorf, auch die Armenhäusler usw. Je mehr sich die
Bühue süllt, desto mehr schwankeu wir: ist das Traum oder
Wirklichkeit?, denn durch nichts sind alle diese Personen als
nur Geträumte charakterisirt. Da hilft auch keine magische
Beleuchtung, die man wohl angeweudet hat. Denn wenn sich
Traumszene an Traumszene reiht den ganzen zweiten Akt hin-
durch, und somit die Art der Beleuchtung ununterbrochen die-
selbe bleibt, so hört auch sür uns das Bewußtsein ihrer
charakterisirenden Bedeutung aus.
Die einzige Abhülfe dieser Unklarheit, welche, sobald über-
haupt empsunden, im Zuschauer den ästhetischen Genuß zer-
stören muß, liegt in einer steten Scheidung des traumenden
Hannele vom Traumbild. Das ließe sich einsach dadurch bewerk-
stelligen, daß Haunele ruhig aus ihrem Lager verbliebe, der
Hintergrund aber sich öffnete nud dorten, räumlich also hinter
der Szenerie der Armenhausstube, die Traumhandlung sich
abspänne mit einem zweiten Hannele.
Man könnte angesichts dieser Forderung fragen: Ja, haben
wir denn nicht genug Deukkraft und Phantasie, daß wir nicht
auch ohne diese grob-sinnliche Unterstützung verstehen könnten,
alles sei uur Traum? Nun, darum handelt es sich gar nicht,
sondern darum, der Traumcharakterisirung die unbedingt not-
wendigeEinheit zu verschaffen. Solange wir vor einem Werke
der Kunst grübeln und denken, so lange haben wir keinen
ästhetischen Genuß davon — oder allgemein: jedes theoretische
Verhalten schließt ein ästhetisches Verhalten aus.
Jm Übrigen ließe sich auch mit dem Dichter darüber
streiten, ob es psychologisch richtig, daß die Sterbende gegen
Schluß immer umfassendere, in ihren Einzelheiten immer mehr
ausgeführte Traumgesichte hat. Die Steigerung der Fieber-
phautasieu bis zur Verwandlung des Fremden in Christus
selbst, kurz vor dem Eintritt ihres Todes, lasse ich gelten;
sie sollte aber begleitet sein von einem beschleunigten Tempo
der Erscheinungen, nicht von einem immer breiteren Aus-
malen.
Was die häufig aufgeworfene Frage betrifft, ob Haupt-
mann den „Prinzipien seiner Schule" untreu geworden ist
oder nicht, so kann man sie nur belücheln. Ein Dichter vom
Range Hauptmanns gehört gar keiner Richtung au: er ist stets
er selbst. Und wenn er einmal eine Richtung hat, so ist das
nur in dem Sinne zu nehmen, daß er jeden Augenblick, je
nach dem zu behandelnden Stoff und je nach den Gedankeu,
die ihm zuschießen, eine andere einnehmen kann. Daß jedoch
Hauptmann eine gewisse Schweukung vollzieht, ist erklärlich,
weil es die Folge seiner Entwicklung ist.
Fr. Larstanjen.
» lilolkstümlicbe Vlastik. IKundscbau. Dichtung. Kraft, Größe und Reiuheit in der Kuust.
^lll^tl^. (Schluß.) — Theater. Wichtigere Schauspiel-Aufführungeu. 58. Schristen über Dramatik und Bühnen-
wesen. 3. — Musik. Giovanni Pierluigi Palestrina. — Bildende Künste. Dresdner Kunstbrief. Das Aufleben des
Dilettantismus. Kunstblätter und Bilderwerke. 9. — Vermischtes. Die Kunst als Versöhnerin. Literatur. - Sprccb--
saal. Die Traumcharakterisirung in Hanptmanns Hannele.
wahrnehmung Hanneles wahr? Warum eigentlich steht sie
„andachtig" und „demütig" da? Warum nimmt sie sich nicht
mit beruhigenden Worten der Kranken an und bringt sie zu
Bett, wie ihre Pflicht? Aber sie geht. Und durch dieselbe
Thür im Hintergrund, durch welche sie hinausgegangen, kommt
alsbald eine andere Gestalt „in der Kleidung der Diakonissin,
aber schvner und jugendlicher als diese, mit laugen weißen
Flügeln." Diese Figur setzt dem Zuschauer ein Rätsel. Man
weiß aus der sonderbar drapirten „Diakouissin" im schwarzen
Kleid mit weißen Flügeln, die von Hannele bald mit „Mutter",
bald mit „Schwester Martha" angeredet wird, und die sich
selbst sür beides ausgiebt (S. 55.), gar nichts zu machen.
Natürlich will der Dichter damit sagen, daß Hannele beide im
Traume mit einander vermengt. Danu aber muß die Gestalt
auch als Traumericheinung charakterisirt werden. Erstens darf
sie nicht einfach durch die Thür herein kommen; diese ist nur
für die mitagirenden menschlichen Jndividuen da. Für „Er-
scheinungen" giebt es keine Wände. Auch kommen sie nicht,
sie sind plötzlich und unvermittelt da. Und vor allem kommen
sie uicht im Rücken der Halluziuantin. Ein Traumgesicht im
Rücken —? Das geht wohl nicht au, oder es übt als solches
eine besonders zu schildernde Wirkung. Davon ist hier nicht
die Rede.
Aber weiter! Diese Gestalt läutet mit einer kleinen
silbernen Schelle, uud nuu kommt, wieder durch diese Thüre,
ein buckliger Dorfschneider herein mit Brautkleid usw., und
Hannele wird angezogen. Man denke die Situation, rechts das
leere Bett, links der Tod, iu der Mitte der Schneider und
Hannele, die von der geflügelten Diakonissin angekleidet wird.
Jch glaube, es erleuchtet hieraus auch demjenigen, der das
Ganze noch nicht auf der Bühne gesehen hat, daß dem Zu-
schauer mit dieser Szene völlig die Orientirung darüber ver-
loren gegangen ist, ob das alles Traum oder Wirklichkeit ist.
Freilich wird man sich sofort zu ersterer Annahme zwingen
müssen. Aber wer ist dann als der Träumende vorausgesetzt,
Hannele oder etwa wir selbst? Das ist also der wunde Punkt
dieses zweiten Teils der Dichtung: Halluzination und Hallu-
zinantin sind nicht mehr auseinander gehalten. Hannele träumt
nicht mehr eine Erscheinung, sondern eine Aktion und sich
selbst mit darin als Handelnde. Für eine Erzählung würde
das keiner weiteren Unterscheidung bedürfen. Dort bleibt man
über den Traum stets orientirt, da er stets als solcher durch
ein einziges Wort bezeichnet werden kann. Diese „Bezeichnung"
wird nun bei einer Bühnen-Aufführung vertreten durch besouderes
szenisches Arrangement, veränderte Beleuchtung, durch ver-
änderte Sprache usw. Auch giebt Hauptmann die Vorschrift,
daß alle Personen des Traumes lautlos auftreten (S. 63).
Letzteres ist aber zu geringfügig, um aufzufallen, und auch
erstere Mittel genügen hier noch nicht.
Wenn Hannele eine längere Handlung träumt, so haben
wir einerseits Hannele in ihrem Bette und andererseits die
stets als Traumbild zu charakterisirende Handlung. Wenn
nun die Träumende sich selbst im Traum erblickt, und wir an
dieser Scheidung festhalten, so haben wir eben zwei Hannele.
Schon der Jllustrator, der keine Worte zur Bezeichnung
hat, bedars eines besonderen Mittels zur Kennzeichnung des
Traumes. Und Julius Exter — im Übrigen nicht sehr ideen-
reich in seinen Skizzirungen — hat hier den einzig richtigen j
Weg eingeschlagen: unten liegt das trüumende Hannele im
Bette, darüber schwebt das Traumbild: Schwester, Schneider
uud nochmals Hannele im Brautstaat. Einzig aus diese Weise
hätte auch der Dichter, oder die Regie, das szenische Arrange-
ment gestalten müssen. Aber der Dichter hat diese Unter-
scheidung zwischen Traum und Wirklichkeit nicht durchgesührt.
Das Bett ist leer; Hannele agirt im Ballstaat auf der Bühne
umher, und doch ist die Forderung an uns gestellt, wir sollen
sie nns sterbenskrank vorstellen und alles nur als Hanneles
Traumgesicht. Dns geht nicht.
Mit allem weiter Folgendeu wird man nur immer mehr
in der Jllusion gestört. Die Schulkinder kommen, Frauen aus
dem Dorf, auch die Armenhäusler usw. Je mehr sich die
Bühue süllt, desto mehr schwankeu wir: ist das Traum oder
Wirklichkeit?, denn durch nichts sind alle diese Personen als
nur Geträumte charakterisirt. Da hilft auch keine magische
Beleuchtung, die man wohl angeweudet hat. Denn wenn sich
Traumszene an Traumszene reiht den ganzen zweiten Akt hin-
durch, und somit die Art der Beleuchtung ununterbrochen die-
selbe bleibt, so hört auch sür uns das Bewußtsein ihrer
charakterisirenden Bedeutung aus.
Die einzige Abhülfe dieser Unklarheit, welche, sobald über-
haupt empsunden, im Zuschauer den ästhetischen Genuß zer-
stören muß, liegt in einer steten Scheidung des traumenden
Hannele vom Traumbild. Das ließe sich einsach dadurch bewerk-
stelligen, daß Haunele ruhig aus ihrem Lager verbliebe, der
Hintergrund aber sich öffnete nud dorten, räumlich also hinter
der Szenerie der Armenhausstube, die Traumhandlung sich
abspänne mit einem zweiten Hannele.
Man könnte angesichts dieser Forderung fragen: Ja, haben
wir denn nicht genug Deukkraft und Phantasie, daß wir nicht
auch ohne diese grob-sinnliche Unterstützung verstehen könnten,
alles sei uur Traum? Nun, darum handelt es sich gar nicht,
sondern darum, der Traumcharakterisirung die unbedingt not-
wendigeEinheit zu verschaffen. Solange wir vor einem Werke
der Kunst grübeln und denken, so lange haben wir keinen
ästhetischen Genuß davon — oder allgemein: jedes theoretische
Verhalten schließt ein ästhetisches Verhalten aus.
Jm Übrigen ließe sich auch mit dem Dichter darüber
streiten, ob es psychologisch richtig, daß die Sterbende gegen
Schluß immer umfassendere, in ihren Einzelheiten immer mehr
ausgeführte Traumgesichte hat. Die Steigerung der Fieber-
phautasieu bis zur Verwandlung des Fremden in Christus
selbst, kurz vor dem Eintritt ihres Todes, lasse ich gelten;
sie sollte aber begleitet sein von einem beschleunigten Tempo
der Erscheinungen, nicht von einem immer breiteren Aus-
malen.
Was die häufig aufgeworfene Frage betrifft, ob Haupt-
mann den „Prinzipien seiner Schule" untreu geworden ist
oder nicht, so kann man sie nur belücheln. Ein Dichter vom
Range Hauptmanns gehört gar keiner Richtung au: er ist stets
er selbst. Und wenn er einmal eine Richtung hat, so ist das
nur in dem Sinne zu nehmen, daß er jeden Augenblick, je
nach dem zu behandelnden Stoff und je nach den Gedankeu,
die ihm zuschießen, eine andere einnehmen kann. Daß jedoch
Hauptmann eine gewisse Schweukung vollzieht, ist erklärlich,
weil es die Folge seiner Entwicklung ist.
Fr. Larstanjen.
» lilolkstümlicbe Vlastik. IKundscbau. Dichtung. Kraft, Größe und Reiuheit in der Kuust.
^lll^tl^. (Schluß.) — Theater. Wichtigere Schauspiel-Aufführungeu. 58. Schristen über Dramatik und Bühnen-
wesen. 3. — Musik. Giovanni Pierluigi Palestrina. — Bildende Künste. Dresdner Kunstbrief. Das Aufleben des
Dilettantismus. Kunstblätter und Bilderwerke. 9. — Vermischtes. Die Kunst als Versöhnerin. Literatur. - Sprccb--
saal. Die Traumcharakterisirung in Hanptmanns Hannele.