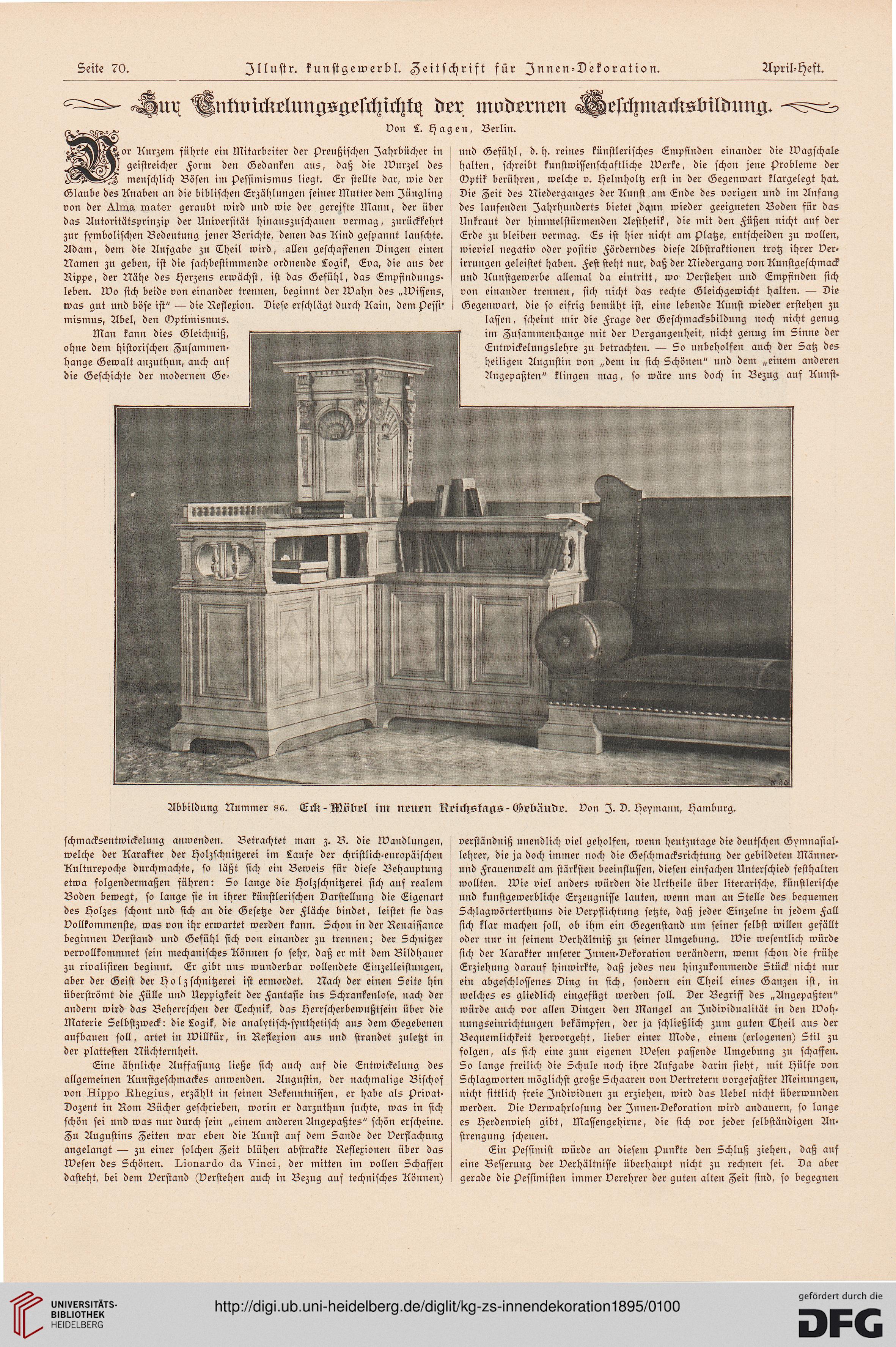Seite 70.
Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.
April-Heft.
Mtwickelungsgeschichty dev modernen
von L. Hagen, Berlin.
jor Kurzem führte ein Mitarbeiter der Preußischen Jahrbücher in
geistreicher Form den Gedanken aus, daß die Wurzel des
menschlich Bösen im Pessimismus liegt. Er stellte dar, wie der
Glaube des Knaben an die biblischen Erzählungen seiner Mutter dem Jüngling
von der ^.lirm vas-bsr geraubt wird und wie der gereifte Mann, der über
das Autoritätsprinzip der Universität hinauszuschauen vermag, zurückkehrt
zur symbolischen Bedeutung jener Berichte, denen das Rind gespannt lauschte.
Adam, dem die Aufgabe zu Theil wird, allen geschaffenen Dingen einen
Namen zu geben, ist die sachbestimmende ordnende Logik, Eva, die aus der
Rippe, der Nähe des Herzens erwächst, ist das Gefühl, das Lmxflndungs-
leben. Wo sich beide von einander trennen, beginnt der Wahn des „Wissens,
was gut und böse ist" — die Reflexion. Diese erschlägt durch Rain, dem Pessi'
mismus, Abel, den Gxtimismus.
Man kann dies Gleichniß,
ohne dem historischen Zusammen-
hange Gewalt anzuthun, auch auf
die Geschichte der modernen Ge-
und Gefühl, d. h. reines künstlerisches Empfinden einander die Wagschale
halten, schreibt kunstwissenschaftliche Werke, die schon jene Probleme der
Vxtik berühren, welche v. Helmholtz erst in der Gegenwart klargelegt hat.
Die Zeit des Niederganges der Runst am Ende des vorigen und im Anfang
des laufenden Jahrhunderts bietet chqnn wieder geeigneten Boden für das
Unkraut der himmelstürmenden Aesthetik, die mit den Füßen nicht auf der
Erde zu bleiben vermag. Es ist hier nicht am Platze, entscheiden zu wollen,
wieviel negativ oder positiv Förderndes diese Abstraktionen trotz ihrer Ver-
irrungen geleistet haben. Fest steht nur, daß der Niedergang von Runstgeschmack
und Runstgewerbe allemal da eintritt, wo verstehen und Empfinden sich
von einander trennen, sich nicht das rechte Gleichgewicht halten. — Die
Gegenwart, die so eifrig bemüht ist, eine lebende Runst wieder erstehen zu
lassen, scheint mir die Frage der Geschmacksbildung noch nicht genug
im Zusammenhänge mit der Vergangenheit, nicht genug im Sinne der
Entwickelungslehre zu betrachten. — So unbeholfen auch der Satz des
heiligen Augustin von „dem in sich Schönen" und dem „einem anderen
Angepaßten" klingen mag, so wäre uns doch in Bezug auf Kunst-
Abbildung Nummer 86. Eck-Möbel im neuen Reichstags - Gebäude, von I. D. Heymann, Hamburg.
schmacksentwickelung anwenden. Betrachtet man z. B. die Wandlungen,
welche der Rarakter der Holzschnitzerei im Laufe der christlich-europäischen
Rulturexoche durchmachte, so läßt sich ein Beweis für diese Behauptung
etwa folgendermaßen führen: So lange die Holzschnitzerei sich auf realem
Boden bewegt, so lange sie in ihrer künstlerischen Darstellung die Eigenart
des Holzes schont und sich an die Gesetze der Fläche bindet, leistet sie das
vollkommenste, was von ihr erwartet werden kann. Schon in der Renaissance
beginnen verstand und Gefühl sich von einander zu trennen; der Schnitzer
vervollkommnet sein mechanisches Rönnen so sehr, daß er mit dem Bildhauer
zu rivalisiren beginnt. Er gibt uns wunderbar vollendete Linzelleistungen,
aber der Geist der Holzschnitzerei ist ermordet. Nach der einen Seite hin
überströmt die Fülle und Uexpigkeit der Fantasie ins Schrankenlose, nach der
andern wird das Beherrschen der Technik, das Herrscherbewußtsein über die
Materie Selbstzweck: die Logik, die analytisch-synthetisch aus dem Gegebenen
aufbauen soll, artet in Willkür, in Reflexion aus und strandet zuletzt in
der plattesten Nüchternheit.
Eine ähnliche Auffassung ließe sich auch auf die Entwickelung des
allgemeinen Runstgeschmackes anwenden. Augustin, der nachmalige Bischof
von klippc, Rbsgius, erzählt in seinen Bekenntnissen, er habe als Privat-
Dozent in Rom Bücher geschrieben, worin er darzuthun suchte, was in sich
schön sei und was nur durch sein „einem anderen Angepaßtes" schön erscheine.
Zu Augustins Zeiten war eben die Runst ans dem Sande der Verflachung
angelangt — zu einer solchen Zeit blühen abstrakte Reflexionen über das
Wesen des Schönen. läonaräo äa Viuoi, der mitten im vollen Schaffen
dasteht, bei dem Verstand (verstehen auch in Bezug auf technisches Rönnen)
verständniß unendlich viel geholfen, wenn heutzutage die deutschen Gymnasial-
lehrer, die ja doch immer noch die Geschmacksrichtung der gebildeten Männer-
und Frauenwelt am stärksten beeinflussen, diesen einfachen Unterschied festhalten
wollten. Wie viel anders würden die Urtheile über literarische, künstlerische
und kunstgewerbliche Erzeugnisse lauten, wenn man an Stelle des bequemen
Schlagwörterthums die Verpflichtung setzte, daß jeder Einzelne in jedem Fall
sich klar machen soll, ob ihm ein Gegenstand um seiner selbst willen gefällt
oder nur in seinem verhältniß zu seiner Umgebung. Wie wesentlich würde
sich der Rarakter unserer Innen-Dekoration verändern, wenn schon die frühe
Erziehung darauf hinwirkte, daß jedes neu hinzukommende Stück nicht nur
ein abgeschlossenes Ding in sich, sondern ein Theil eines Ganzen ist, in
welches es gliedlich eingefügt werden soll. Der Begriff des „Angepaßten"
würde auch vor allen Dingen den Mangel an Individualität in den Woh-
nungseinrichtungen bekämpfen, der ja schließlich zum guten Theil aus der
Bequemlichkeit hervorgeht, lieber einer Mode, einem (erlogenen) Stil zu
folgen, als sich eine zun: eigenen Wesen passende Umgebung zu schaffen.
So lange freilich die Schule noch ihre Aufgabe darin sieht, mit Hülfe von
Schlagworten möglichst große Schaaren von Vertretern vorgefaßter Meinungen,
nicht sittlich freie Individuen zu erziehen, wird das Uebel nicht überwunden
werden. Die Verwahrlosung der Innen-Dekoration wird andauern, so lange
es Herdenvieh gibt, Massengehirne, die sich vor jeder selbständigen An-
strengung scheuen.
Ein Pessimist würde an diesem Punkte den Schluß ziehen, daß aus
eine Besserung der Verhältnisse überhaupt nicht zu rechnen sei. Da aber
gerade die Pessimisten immer Verehrer der guten alten Zeit sind, so begegnen
Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.
April-Heft.
Mtwickelungsgeschichty dev modernen
von L. Hagen, Berlin.
jor Kurzem führte ein Mitarbeiter der Preußischen Jahrbücher in
geistreicher Form den Gedanken aus, daß die Wurzel des
menschlich Bösen im Pessimismus liegt. Er stellte dar, wie der
Glaube des Knaben an die biblischen Erzählungen seiner Mutter dem Jüngling
von der ^.lirm vas-bsr geraubt wird und wie der gereifte Mann, der über
das Autoritätsprinzip der Universität hinauszuschauen vermag, zurückkehrt
zur symbolischen Bedeutung jener Berichte, denen das Rind gespannt lauschte.
Adam, dem die Aufgabe zu Theil wird, allen geschaffenen Dingen einen
Namen zu geben, ist die sachbestimmende ordnende Logik, Eva, die aus der
Rippe, der Nähe des Herzens erwächst, ist das Gefühl, das Lmxflndungs-
leben. Wo sich beide von einander trennen, beginnt der Wahn des „Wissens,
was gut und böse ist" — die Reflexion. Diese erschlägt durch Rain, dem Pessi'
mismus, Abel, den Gxtimismus.
Man kann dies Gleichniß,
ohne dem historischen Zusammen-
hange Gewalt anzuthun, auch auf
die Geschichte der modernen Ge-
und Gefühl, d. h. reines künstlerisches Empfinden einander die Wagschale
halten, schreibt kunstwissenschaftliche Werke, die schon jene Probleme der
Vxtik berühren, welche v. Helmholtz erst in der Gegenwart klargelegt hat.
Die Zeit des Niederganges der Runst am Ende des vorigen und im Anfang
des laufenden Jahrhunderts bietet chqnn wieder geeigneten Boden für das
Unkraut der himmelstürmenden Aesthetik, die mit den Füßen nicht auf der
Erde zu bleiben vermag. Es ist hier nicht am Platze, entscheiden zu wollen,
wieviel negativ oder positiv Förderndes diese Abstraktionen trotz ihrer Ver-
irrungen geleistet haben. Fest steht nur, daß der Niedergang von Runstgeschmack
und Runstgewerbe allemal da eintritt, wo verstehen und Empfinden sich
von einander trennen, sich nicht das rechte Gleichgewicht halten. — Die
Gegenwart, die so eifrig bemüht ist, eine lebende Runst wieder erstehen zu
lassen, scheint mir die Frage der Geschmacksbildung noch nicht genug
im Zusammenhänge mit der Vergangenheit, nicht genug im Sinne der
Entwickelungslehre zu betrachten. — So unbeholfen auch der Satz des
heiligen Augustin von „dem in sich Schönen" und dem „einem anderen
Angepaßten" klingen mag, so wäre uns doch in Bezug auf Kunst-
Abbildung Nummer 86. Eck-Möbel im neuen Reichstags - Gebäude, von I. D. Heymann, Hamburg.
schmacksentwickelung anwenden. Betrachtet man z. B. die Wandlungen,
welche der Rarakter der Holzschnitzerei im Laufe der christlich-europäischen
Rulturexoche durchmachte, so läßt sich ein Beweis für diese Behauptung
etwa folgendermaßen führen: So lange die Holzschnitzerei sich auf realem
Boden bewegt, so lange sie in ihrer künstlerischen Darstellung die Eigenart
des Holzes schont und sich an die Gesetze der Fläche bindet, leistet sie das
vollkommenste, was von ihr erwartet werden kann. Schon in der Renaissance
beginnen verstand und Gefühl sich von einander zu trennen; der Schnitzer
vervollkommnet sein mechanisches Rönnen so sehr, daß er mit dem Bildhauer
zu rivalisiren beginnt. Er gibt uns wunderbar vollendete Linzelleistungen,
aber der Geist der Holzschnitzerei ist ermordet. Nach der einen Seite hin
überströmt die Fülle und Uexpigkeit der Fantasie ins Schrankenlose, nach der
andern wird das Beherrschen der Technik, das Herrscherbewußtsein über die
Materie Selbstzweck: die Logik, die analytisch-synthetisch aus dem Gegebenen
aufbauen soll, artet in Willkür, in Reflexion aus und strandet zuletzt in
der plattesten Nüchternheit.
Eine ähnliche Auffassung ließe sich auch auf die Entwickelung des
allgemeinen Runstgeschmackes anwenden. Augustin, der nachmalige Bischof
von klippc, Rbsgius, erzählt in seinen Bekenntnissen, er habe als Privat-
Dozent in Rom Bücher geschrieben, worin er darzuthun suchte, was in sich
schön sei und was nur durch sein „einem anderen Angepaßtes" schön erscheine.
Zu Augustins Zeiten war eben die Runst ans dem Sande der Verflachung
angelangt — zu einer solchen Zeit blühen abstrakte Reflexionen über das
Wesen des Schönen. läonaräo äa Viuoi, der mitten im vollen Schaffen
dasteht, bei dem Verstand (verstehen auch in Bezug auf technisches Rönnen)
verständniß unendlich viel geholfen, wenn heutzutage die deutschen Gymnasial-
lehrer, die ja doch immer noch die Geschmacksrichtung der gebildeten Männer-
und Frauenwelt am stärksten beeinflussen, diesen einfachen Unterschied festhalten
wollten. Wie viel anders würden die Urtheile über literarische, künstlerische
und kunstgewerbliche Erzeugnisse lauten, wenn man an Stelle des bequemen
Schlagwörterthums die Verpflichtung setzte, daß jeder Einzelne in jedem Fall
sich klar machen soll, ob ihm ein Gegenstand um seiner selbst willen gefällt
oder nur in seinem verhältniß zu seiner Umgebung. Wie wesentlich würde
sich der Rarakter unserer Innen-Dekoration verändern, wenn schon die frühe
Erziehung darauf hinwirkte, daß jedes neu hinzukommende Stück nicht nur
ein abgeschlossenes Ding in sich, sondern ein Theil eines Ganzen ist, in
welches es gliedlich eingefügt werden soll. Der Begriff des „Angepaßten"
würde auch vor allen Dingen den Mangel an Individualität in den Woh-
nungseinrichtungen bekämpfen, der ja schließlich zum guten Theil aus der
Bequemlichkeit hervorgeht, lieber einer Mode, einem (erlogenen) Stil zu
folgen, als sich eine zun: eigenen Wesen passende Umgebung zu schaffen.
So lange freilich die Schule noch ihre Aufgabe darin sieht, mit Hülfe von
Schlagworten möglichst große Schaaren von Vertretern vorgefaßter Meinungen,
nicht sittlich freie Individuen zu erziehen, wird das Uebel nicht überwunden
werden. Die Verwahrlosung der Innen-Dekoration wird andauern, so lange
es Herdenvieh gibt, Massengehirne, die sich vor jeder selbständigen An-
strengung scheuen.
Ein Pessimist würde an diesem Punkte den Schluß ziehen, daß aus
eine Besserung der Verhältnisse überhaupt nicht zu rechnen sei. Da aber
gerade die Pessimisten immer Verehrer der guten alten Zeit sind, so begegnen