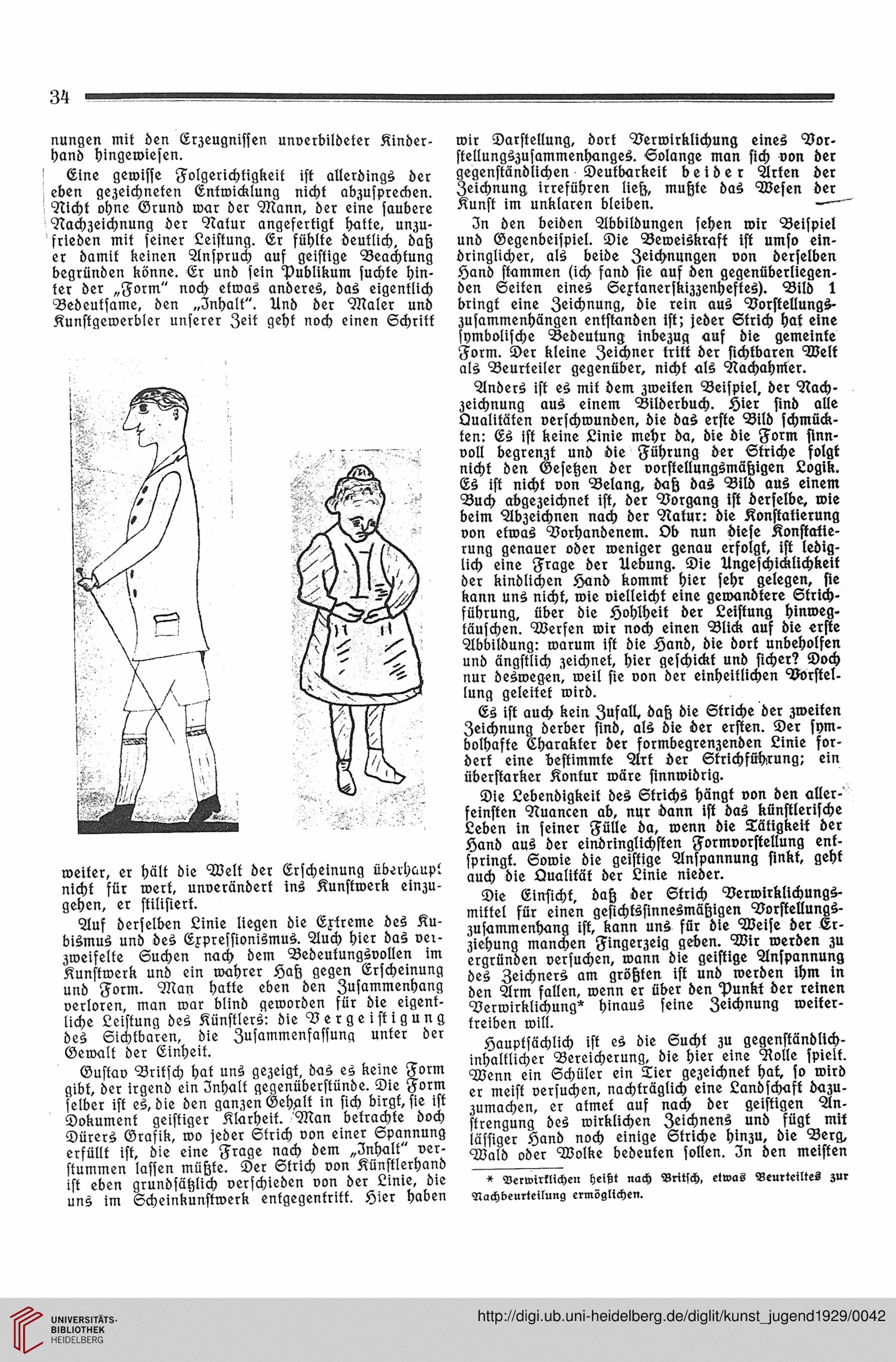34
nungen mit den Erzeugnissen unverbildeter Kinder-
hand hingewiesen.
! Eine gewisse Folgerichtigkeit ist allerdings der
eben gezeichneten Entwicklung nicht abzusprecken.
Nicht ohne Grund war der Mann, der eine saubere
Nachzeichnung der Natur angefertigk hatte, unzu-
frieden mit seiner Leistung. Er fühlke deutlich, daß
er damit keinen Anspruch auf geistige Beachtung
begründen könne. Er und sein Publikum suchte hin-
ker der „Form" noch ekwas anderes, das eigentlich
Bedeutsame, den „Znhalt". Und der Maler und
Kunstgewerbler unserer Zeit geht noch einen Schritk
weiter, er hält die Welt der Erscheinung überhaupt
nicht für wert, unverändert ins Kunskwerk einzu-
gehen, er stilisiert.
Auf derselben Linie liegen die Extreme des Ku-
bismus und des Expressionismus. Auch hier das ver-
zweifelte Suchen nach dem Bedeutungsvollen im
Kunstwerk und ein wahrer Hah gegen Erscheinung
und Form. Man hatke eben den Zusammenhang
verloren, man war blind geworden für die eigenk-
liche Leistung des Künstlers: üie B e r g e i st i g u n g
des Sichtbaren, die Zusammenfassung unter der
Gewalt der Einheit.
Gustav Britsch hat uns gezeigt, das es keine Form
gibt, der irgend ein Itnhalt gegenüberstünde. Die Form
selber ist es, die den ganzen Gehglt in sich birgk, sie ist
Dokument geistiger Klarheit. Man bekrachte doch
Dürers Grafik, wo jeder Strich von einer Spannung
erfüllt ist, die eine Frage nach dem „Inhalt" ver-
stummen lassen müßke. Der Skrich von Künstlerhand
ist eben grundsätzlich verschieden von der Linie, die
uns im Scheinkunstwerk entgegenkrikt. Hier haben
wir Darstellung, dort Berwirklichung eines Bor-
stellungszusammenhanges. Solange man sich von der
gegenständlichen Deukbarkeit beider Arten -er
Zeichnung irreführen lieh, mußke das Wesen der
Kunst im unklaren bleiben. -
ün den beiden Abbildungen sehen wir Beispiel
und Gegenbeispiel. Die Beweiskraft ist umso ein-
dringlicher, als beide Zeichnungen von derselben
Hand stammen (ich fand sie auf den gegenüberliegen-
den Seiten eines Sextanerskizzenheftes). Bild 1
bringk eine Zeichnung, die rein aus Borstellungs-
zusammenhängen entstanden ist; jeder Strich hat eine
symbolische Bedeutung inbezug auf die gemeinte
Form. Der kleine Zeichner kritt der sichkbaren Melt
als Beurteiler gegenüber, nichk als Nachahnter.
Anders ist es mit dem zweiten Beispiel, der Nach-
zeichnung aus einem Bilderbuch. Hier sind alle
Qualitäten verschwunden, die das erske Bild schmück-
ten: Es ist keine Linie mehr da, die üie Form sinn-
voll begrenzt und die Führung der Striche folgt
nichk den Gesetzen der vorstellungsmäßigen Logik.
Es ist nicht von Belang, daß das Bild aus einem
Buch abgezeichnek ist, der Borgang ist üerselbe, wie
beim Abzeichnen nach der Natur: die Konskatierung
von etwas Borhandenem. Ob nun -iese Konstatie-
rung genauer oder weniger genau erfolgt, ist ledig-
lich eine Frage der Aebung. Die Ungeschicklichkeit
der kindlichen Hand kommt hier sehr gelegen, sie
kann uns nicht, wie vielleicht eine gewandtere Strich-
führung, über die Hohlheit der Leistung hinweg-
käuschen. Werfen wir noch einen Blick auf die erste
Abbildung: warum ist die Hand, die dork unbeholfen
und ängstlich zeichnet, hier geschickt und flcher? Doch
nur deswegen, weil sie von der einheitlichen Borstel-
lung geleitek wird.
Es ist auch kein Zufall. daß die Striche der zweiken
Zeichnung derber sind, als die der ersten. Der sym-
bolhafte Charakter der formbegrenzenden Linie for-
derk eine bestimmte Art der Strichführung: ein
überskarker Konkur wäre sinnwidrig.
Die Lebendigkeit des Skrichs hängt von den aller-
feinsten Nuancen ab, nur dann ist -as künstlerische
Leben in seiner Fülle da, wenn die Tätigkeit der
Hand aus der eindringlichsten Formvorstellung enk-
springk. Sowie die geistige Anspannung sinkt, gehk
auch die Qualität der Linie nieder.
Die Einsichk, daß üer Strich Berwirklichungs-
mitkel für einen gesichksflnnesmäßigen Borstellungs-
zusammenhang isk, kann uns für die Weise der Er-
ziehung manchen Fingerzeig geben. Wir werden zu
ergründen versuchen, wann die geistige Anspannung
des Zeichners am grötzten ist und werden ihm in
den Arm fallen, wenn er über den Punkt der reinen
Berwirklichung* hinaus seine Zeichnung weiter-
treiben will.
Hauptsächlich ist es die Sucht zu gegenständlich-
inhalklicher Bereicherung, die hier eine Rolle spielt.
Menn ein Schüler ein Tier gezeichnek hat, so wird
er meist versuchen, nachträglich eine Landschaft dazu-
zumachen, er atmet auf nach der geistigen An-
strengung des wirklichen Zeichnens und fügt mit
lässiger Hand noch einige Striche hinzu, die Berg,
Wald oder Wolke bedeuten sollen. In den meisken
» Derwirklichen heißt nach Britsch, etwas Bcurteiltes zur
Nachbeurteilung ermöglichen.
nungen mit den Erzeugnissen unverbildeter Kinder-
hand hingewiesen.
! Eine gewisse Folgerichtigkeit ist allerdings der
eben gezeichneten Entwicklung nicht abzusprecken.
Nicht ohne Grund war der Mann, der eine saubere
Nachzeichnung der Natur angefertigk hatte, unzu-
frieden mit seiner Leistung. Er fühlke deutlich, daß
er damit keinen Anspruch auf geistige Beachtung
begründen könne. Er und sein Publikum suchte hin-
ker der „Form" noch ekwas anderes, das eigentlich
Bedeutsame, den „Znhalt". Und der Maler und
Kunstgewerbler unserer Zeit geht noch einen Schritk
weiter, er hält die Welt der Erscheinung überhaupt
nicht für wert, unverändert ins Kunskwerk einzu-
gehen, er stilisiert.
Auf derselben Linie liegen die Extreme des Ku-
bismus und des Expressionismus. Auch hier das ver-
zweifelte Suchen nach dem Bedeutungsvollen im
Kunstwerk und ein wahrer Hah gegen Erscheinung
und Form. Man hatke eben den Zusammenhang
verloren, man war blind geworden für die eigenk-
liche Leistung des Künstlers: üie B e r g e i st i g u n g
des Sichtbaren, die Zusammenfassung unter der
Gewalt der Einheit.
Gustav Britsch hat uns gezeigt, das es keine Form
gibt, der irgend ein Itnhalt gegenüberstünde. Die Form
selber ist es, die den ganzen Gehglt in sich birgk, sie ist
Dokument geistiger Klarheit. Man bekrachte doch
Dürers Grafik, wo jeder Strich von einer Spannung
erfüllt ist, die eine Frage nach dem „Inhalt" ver-
stummen lassen müßke. Der Skrich von Künstlerhand
ist eben grundsätzlich verschieden von der Linie, die
uns im Scheinkunstwerk entgegenkrikt. Hier haben
wir Darstellung, dort Berwirklichung eines Bor-
stellungszusammenhanges. Solange man sich von der
gegenständlichen Deukbarkeit beider Arten -er
Zeichnung irreführen lieh, mußke das Wesen der
Kunst im unklaren bleiben. -
ün den beiden Abbildungen sehen wir Beispiel
und Gegenbeispiel. Die Beweiskraft ist umso ein-
dringlicher, als beide Zeichnungen von derselben
Hand stammen (ich fand sie auf den gegenüberliegen-
den Seiten eines Sextanerskizzenheftes). Bild 1
bringk eine Zeichnung, die rein aus Borstellungs-
zusammenhängen entstanden ist; jeder Strich hat eine
symbolische Bedeutung inbezug auf die gemeinte
Form. Der kleine Zeichner kritt der sichkbaren Melt
als Beurteiler gegenüber, nichk als Nachahnter.
Anders ist es mit dem zweiten Beispiel, der Nach-
zeichnung aus einem Bilderbuch. Hier sind alle
Qualitäten verschwunden, die das erske Bild schmück-
ten: Es ist keine Linie mehr da, die üie Form sinn-
voll begrenzt und die Führung der Striche folgt
nichk den Gesetzen der vorstellungsmäßigen Logik.
Es ist nicht von Belang, daß das Bild aus einem
Buch abgezeichnek ist, der Borgang ist üerselbe, wie
beim Abzeichnen nach der Natur: die Konskatierung
von etwas Borhandenem. Ob nun -iese Konstatie-
rung genauer oder weniger genau erfolgt, ist ledig-
lich eine Frage der Aebung. Die Ungeschicklichkeit
der kindlichen Hand kommt hier sehr gelegen, sie
kann uns nicht, wie vielleicht eine gewandtere Strich-
führung, über die Hohlheit der Leistung hinweg-
käuschen. Werfen wir noch einen Blick auf die erste
Abbildung: warum ist die Hand, die dork unbeholfen
und ängstlich zeichnet, hier geschickt und flcher? Doch
nur deswegen, weil sie von der einheitlichen Borstel-
lung geleitek wird.
Es ist auch kein Zufall. daß die Striche der zweiken
Zeichnung derber sind, als die der ersten. Der sym-
bolhafte Charakter der formbegrenzenden Linie for-
derk eine bestimmte Art der Strichführung: ein
überskarker Konkur wäre sinnwidrig.
Die Lebendigkeit des Skrichs hängt von den aller-
feinsten Nuancen ab, nur dann ist -as künstlerische
Leben in seiner Fülle da, wenn die Tätigkeit der
Hand aus der eindringlichsten Formvorstellung enk-
springk. Sowie die geistige Anspannung sinkt, gehk
auch die Qualität der Linie nieder.
Die Einsichk, daß üer Strich Berwirklichungs-
mitkel für einen gesichksflnnesmäßigen Borstellungs-
zusammenhang isk, kann uns für die Weise der Er-
ziehung manchen Fingerzeig geben. Wir werden zu
ergründen versuchen, wann die geistige Anspannung
des Zeichners am grötzten ist und werden ihm in
den Arm fallen, wenn er über den Punkt der reinen
Berwirklichung* hinaus seine Zeichnung weiter-
treiben will.
Hauptsächlich ist es die Sucht zu gegenständlich-
inhalklicher Bereicherung, die hier eine Rolle spielt.
Menn ein Schüler ein Tier gezeichnek hat, so wird
er meist versuchen, nachträglich eine Landschaft dazu-
zumachen, er atmet auf nach der geistigen An-
strengung des wirklichen Zeichnens und fügt mit
lässiger Hand noch einige Striche hinzu, die Berg,
Wald oder Wolke bedeuten sollen. In den meisken
» Derwirklichen heißt nach Britsch, etwas Bcurteiltes zur
Nachbeurteilung ermöglichen.