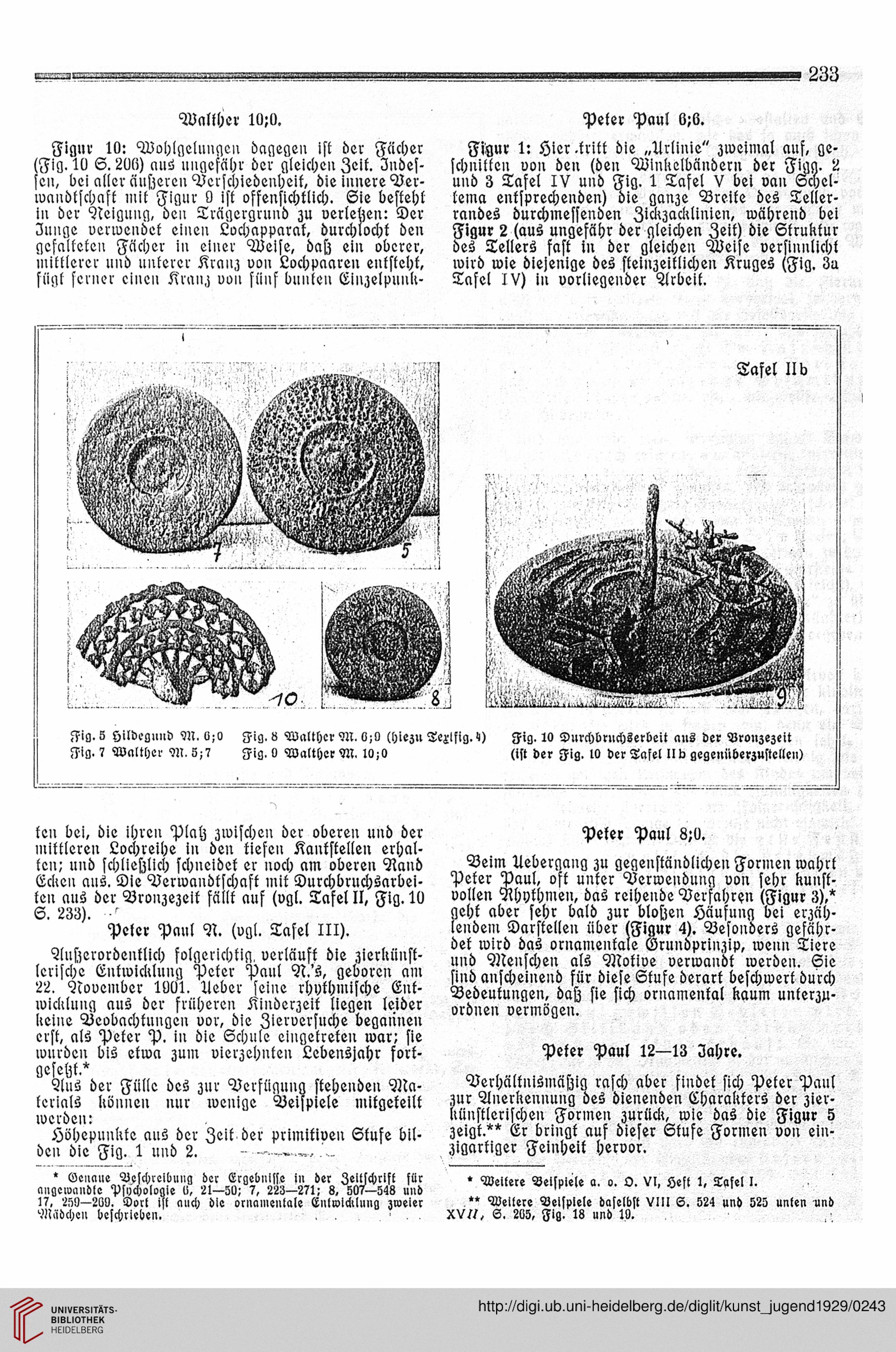Wnlther 1»;U.
Figur 10: Wohlgelimgen dcigegen ist der Fcicher
(Fig. 10 S. 200) nu-j nngefcihr der gleichen Zeit. stndes-
sen, liei aller iiiiszeren Verschiedenheit, die innere Ver-
wnndtschaft init Figur 0 ist offeiisichtlich. Sie besteht
in der Neigung, den Trcigergrund zu verlehen: Der
ituuge verwendet einen Lochcippcircit, durchlocht den
gesalteten Fächer in einer Welse, dast ein obcrer,
inittlerer und unkerer Krnnz von Lochpaaren enksteht,
fiigk ferner cinen Kranz von fiinf bunten Einzelpunlc-
Peker Paul ö;6.
Figur 1: Hier -kritt die „Arlinie" zweimal auf, ge-
schnitten von den fden Winkelbäiiderii der Figg. 2
und 3 Tafel IV und Fig. 1 Tafel V bei vcin Schel-
tema eiitsprechendeii) die ganze Breike des Teller-
randes durchmessenden Ziclizackliiiien, während bei
Figur 2 (aus ungefähr der aleichen Zeit) die Strukkur
des Tellers fast in der gleichen Meise versinnlicht
wird wie diejenige des steinzeiklichen Kruges (Fig. 3a
Tafel IV) in vorliegender Arbeik.
ten bei, die ihren Plah zwischen der oberen und der
miktleren Lochreihe in den tiefen Kantstellen erhal-
ten: und schliejzlich schneidet er noch am oberen Aand
Eclien aus. Die Berwandtschaft mit Durchbruchsarbei-
ten aus der Vronzezeit fäilt auf (vgl. Tafel II, Fig. 10
S. 233).
Peler Pnul N. (vgl. Tafel III).
Aujzerordenklich folgerichtig. verläuft die zierliiinst-
lerische Enkwlclilung Peker Paul N.'S, geboren am
22. November 1001. Ileber seine rhythmische Ent-
wiclilung aus der früheren Kinderzeit liegen leider
lieine Beobachtungen vor, die Zierversuche begannen
erst, als Peker P. in die Schule eingetreten war: sie
wurdeii bis ekwa zum vierzehnten Lebensjahr fort-
geseht.*
Aus der Fülle des zur Berfügung stehenden Ma-
kerials liLnnen nur wenige Beispiele mitgekellt
werden:
Löhepunlike aus der Zeit der primitiven Stufe bil-
den die Fig. 1 und 2. - . ...
Peter Paul 8;0.
Beim Uebergang zu gegenständlichen Formen wahrt
Peter Paul, oft unter Berwendung von sehr liunst-
vollen Ähykhmen, das reihende Berfahrrn (Figur 3)/
gehk aber sehr bald zur blojzen Häufung bei erzäh-
lendem Darstellen über (Figur 4). Vesonders gefähr-
det wird öas ornainenkale Grundprinzip, wenn Tiere
und Menschen als Motive verwandt werden. Sie
sind anscheinend für diese Skufe derart beschwert durch
Bedeukungen, dasz sie sich ornamenkal kaum unkerzu-
ordnen vermögen.
Peker Paul 12—13 stahre.
Berhälknismäjzig rasch abec findet sich Peter Paul
zur Anerkennung des dienenden Charakters der zier-
kiiiistlerischen Forinen zurück, wie das Lie Figur 5
zeigk?* Er bringt auf dieser Stufe Formen von ein-
zigartiger Feinheit hervor.
' Geimue Aelchrclliuug der Lrgebulise in der ZeMchrif! für
uiigcwuudle Pfiichologle l>, 2I—L0: 7, 223—271: 8, 5l>7—548 imd
17, 258—23V. Dort ift uuch dl« oriiaiusiitale Eiilu>Icklu»li zweier
Älüdcheii bcschrieben.
' Wellere Beispiele u. °. O. Vl, Hest 1, Tafsl I.
" Weilere Vsispiels dasslbst VIII S. 524 und 525 unlen und
XV77, S. 2Ü5, Fig. 18 und 18.
Figur 10: Wohlgelimgen dcigegen ist der Fcicher
(Fig. 10 S. 200) nu-j nngefcihr der gleichen Zeit. stndes-
sen, liei aller iiiiszeren Verschiedenheit, die innere Ver-
wnndtschaft init Figur 0 ist offeiisichtlich. Sie besteht
in der Neigung, den Trcigergrund zu verlehen: Der
ituuge verwendet einen Lochcippcircit, durchlocht den
gesalteten Fächer in einer Welse, dast ein obcrer,
inittlerer und unkerer Krnnz von Lochpaaren enksteht,
fiigk ferner cinen Kranz von fiinf bunten Einzelpunlc-
Peker Paul ö;6.
Figur 1: Hier -kritt die „Arlinie" zweimal auf, ge-
schnitten von den fden Winkelbäiiderii der Figg. 2
und 3 Tafel IV und Fig. 1 Tafel V bei vcin Schel-
tema eiitsprechendeii) die ganze Breike des Teller-
randes durchmessenden Ziclizackliiiien, während bei
Figur 2 (aus ungefähr der aleichen Zeit) die Strukkur
des Tellers fast in der gleichen Meise versinnlicht
wird wie diejenige des steinzeiklichen Kruges (Fig. 3a
Tafel IV) in vorliegender Arbeik.
ten bei, die ihren Plah zwischen der oberen und der
miktleren Lochreihe in den tiefen Kantstellen erhal-
ten: und schliejzlich schneidet er noch am oberen Aand
Eclien aus. Die Berwandtschaft mit Durchbruchsarbei-
ten aus der Vronzezeit fäilt auf (vgl. Tafel II, Fig. 10
S. 233).
Peler Pnul N. (vgl. Tafel III).
Aujzerordenklich folgerichtig. verläuft die zierliiinst-
lerische Enkwlclilung Peker Paul N.'S, geboren am
22. November 1001. Ileber seine rhythmische Ent-
wiclilung aus der früheren Kinderzeit liegen leider
lieine Beobachtungen vor, die Zierversuche begannen
erst, als Peker P. in die Schule eingetreten war: sie
wurdeii bis ekwa zum vierzehnten Lebensjahr fort-
geseht.*
Aus der Fülle des zur Berfügung stehenden Ma-
kerials liLnnen nur wenige Beispiele mitgekellt
werden:
Löhepunlike aus der Zeit der primitiven Stufe bil-
den die Fig. 1 und 2. - . ...
Peter Paul 8;0.
Beim Uebergang zu gegenständlichen Formen wahrt
Peter Paul, oft unter Berwendung von sehr liunst-
vollen Ähykhmen, das reihende Berfahrrn (Figur 3)/
gehk aber sehr bald zur blojzen Häufung bei erzäh-
lendem Darstellen über (Figur 4). Vesonders gefähr-
det wird öas ornainenkale Grundprinzip, wenn Tiere
und Menschen als Motive verwandt werden. Sie
sind anscheinend für diese Skufe derart beschwert durch
Bedeukungen, dasz sie sich ornamenkal kaum unkerzu-
ordnen vermögen.
Peker Paul 12—13 stahre.
Berhälknismäjzig rasch abec findet sich Peter Paul
zur Anerkennung des dienenden Charakters der zier-
kiiiistlerischen Forinen zurück, wie das Lie Figur 5
zeigk?* Er bringt auf dieser Stufe Formen von ein-
zigartiger Feinheit hervor.
' Geimue Aelchrclliuug der Lrgebulise in der ZeMchrif! für
uiigcwuudle Pfiichologle l>, 2I—L0: 7, 223—271: 8, 5l>7—548 imd
17, 258—23V. Dort ift uuch dl« oriiaiusiitale Eiilu>Icklu»li zweier
Älüdcheii bcschrieben.
' Wellere Beispiele u. °. O. Vl, Hest 1, Tafsl I.
" Weilere Vsispiels dasslbst VIII S. 524 und 525 unlen und
XV77, S. 2Ü5, Fig. 18 und 18.